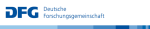Herr Müntefering, was kann man mit Reimen ausdrücken, was in anderen Textformen weniger gelingt?
Ich bin mir nicht sicher, ob Reime etwas anders oder Spezielles vermitteln können. Es bereitet mir einfach Freude. Ich schreibe und lese gerne, auch Reime und ähnliches. Sie machen die Sprache lebendiger. Als Nicht-Wissenschaftler strebe ich nicht danach, wissenschaftlich oder tiefgründig zu schreiben. Ich möchte auch keine Berichte verfassen, die wie Parteiprogramme wirken. Mein Ziel ist es, den Menschen etwas zum Nachdenken zu geben. Was sie davon halten, sei es auch Kritik, ist Teil der Interaktion mit den Lesenden. Das Leben ist voll von interessanten Themen.
Können Sie Ihren Schreibprozess beschreiben?
Ich sammle Gedanken auf Zetteln, sobald mir ein wichtiges Thema begegnet. Das reicht von politischer Kommunikation bis zu alltäglichen Begebenheiten. Mein Schreiben beginnt oft mit der Frage nach dem Sinn des Lebens, ein Thema, das viele beschäftigt. Obwohl meine Überlegungen nicht philosophisch oder wissenschaftlich fundiert sind, glaube ich, dass viele Menschen ähnlich empfinden. Ich genieße es einfach.
Sie sagten uns im Vorgespräch, dass Ihnen das Schreiben hilft, Ihre Gedanken zu sortieren. Was meinen Sie damit?
Ja, das liegt daran, dass man beim Sprechen oft das äußert, was einem spontan in den Sinn kommt, was nicht immer präzise ist. Beim Schreiben bemerke ich spätestens bei der dritten oder vierten Zeile Ungenauigkeiten. Das zwingt mich, neu nachzudenken und meine Gedanken klarer zu entwickeln. Ich versuche, meinen persönlichen Standpunkt einzubringen und einen Beitrag zur Diskussion zu leisten, ohne den Anspruch zu haben, wissenschaftlich zu argumentieren.
Haben Sie diese Methode auch während Ihrer aktiven Zeit in der Politik angewandt?
Ja, das habe ich immer so gemacht. Es war eine große Hilfe für mich. Ich hatte stets Zettel dabei, um schnell Notizen zu machen, denn oft fehlte die Zeit zum Nachdenken. Ich habe sogar neben meinem Bett Stift und Papier bereitgelegt, um Gedanken, die mir nachts kamen, festzuhalten. Zwar waren 95 Prozent davon am Morgen Unsinn, aber ich habe es dennoch aufgeschrieben. Es ist wichtig, das locker zu sehen. Ich hoffe, die Leser meines Buches gehen ebenfalls locker damit um und erwarten keine wissenschaftliche Abhandlung. Ich spreche über Probleme so, wie ich sie sehe, und das gilt auch für die Politik.

In Ihrem Stück „Zielansprachen“ zitieren Sie verschiedene Persönlichkeiten wie August Bebel, Helmut Schmidt und Ihre Mutter. Wie sind Sie zu dieser Zusammenstellung gekommen?
Als ordentlicher Autor schreibt man auch Kapitel, in denen steht, welche Persönlichkeiten einen besonders beeindruckt haben. Ich nenne zehn oder zwölf Menschen, von denen ich was gelernt habe. August Bebel war ein toller Mensch. Aber meine Mutter eben auch. Unmittelbar nach dem Krieg hat ein Bettler an unsere Tür geklopft. Er sagte „Guten Tag, junge Frau, ich habe Hunger.“ Das war für mich schon eine unglaubliche Anmache, für mich war meine Mutter natürlich eine alte Frau. Hunger hatte ich auch. Meine Mutter sagte: „Setzen Sie sich an den Tisch“. Er roch nicht besonders gut. Es gab dann etwas Suppe und Brot. Als er wieder weg war, sagte ich ihr: „Schön, dass du Menschen hilfst, aber hättest du ihn nicht im Flur warten lassen und Brot mitgeben können?“ Da sagte sie: „Man zwingt Menschen nicht, im Stehen zu essen.“ Das ist Respekt vor Menschen. Ich habe das nie vergessen.
Ein Zitat eines Genossen hat es sogar zum Buchtitel gebracht.
Der Genosse Karl aus Berlin, seinen Hausnamen weiß ich gar nicht mehr – wurde 100. Wir feierten das auf einem SPD-Parteitag. Wir fragten ihn also: „Sag mal, was ist das Wichtigste im Leben? Das musst du nach 100 Jahren doch wissen.“ Er sagte: „Du musst das Leben nehmen wie es ist, aber du darfst es nicht so lassen.“ Das fand ich stark.
Haben Sie das für sich schon eingelöst?
Kurz vor meiner Operation letztes Jahr wusste ich nicht, ob ich da heil herauskomme. Es war kritisch, am Herzen, sehr kompliziert. Ich habe nachgedacht: Hast du eigentlich noch Dinge, die du noch klären musst? Man schiebt das Sterben ja von sich weg. Dank der Ärztinnen und Ärzte ging alles gut. Ich bin jetzt so 75 Prozent wieder in Ordnung, muss aber noch trainieren. Nach acht Wochen liegen waren alle Muskeln weg. Für den Kopf ist das schwer auszuhalten. Deshalb ist es schön, dass ich wieder begrenzt Termine wahrnehmen kann. Davon lebe ich wieder auf.
Ein anderes Zitat in diesem Stück kommt von Herbert Wehner.
Ich bin 1975 in den Bundestag nachgerückt, da bekam ich eine Audienz beim Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner. Er paffte in seinem Büro. Der hatte keine Regale, der hatte seine ganzen Klamotten in Aktentaschen: eine für den Ortsverein, eine für den Parteitag – der konnte aufstehen, die Aktentasche nehmen, da war alles drin. Ich hab dann erzählt, wie die Welt ist und wie die Welt werden soll und dabei völlig die Zeit vergessen. Nach einer halben Stunde, pfff, musste er los. Er sagte: „Wir sehen uns wieder, pass auf, dass du nicht austrocknest.“ Über die Jahre habe ich kapiert, was er meinte: Das ist interessant, was du sagst, aber wenn du hier in die Mühle kommst, kann es sein, dass du alle großen Ziele vergisst. Bleib dran.
Was waren Ihre ersten Veröffentlichungen?
Das waren Leserbriefe zu Hause in der „Westfalenpost“. Mir gefielen manche Sachen nicht, die dort standen oder die im Ort passierten. Die Zeitung war für mich ein Gespräch. Auch heute stapeln sich die Zeitungen bei mir. In den Zügen lachen die Leute, wenn ich daraus Artikel ausreiße zum Nachlesen. Ich behandle Zeitungen wie Bücher. Ohne sie fängt der Tag nicht gut an.
Sie haben auch unter dem Pseudonym F. Merz geschrieben…
Damals kannte ich ihn noch gar nicht! Ich habe mich kaputtgelacht, als ich Friedrich Merz das erste Mal getroffen habe. Ich habe ihm das aber nie erzählt. Ich weiß gar nicht, ob er mir das glauben würde.
Im Kapitel „Augenblicke“ schreiben Sie über Alltagsbeobachtungen. Was im Alltag ist für Sie besonders interessant?
Mein eigentliches Thema ist: Älter werden in dieser Zeit. Das funktioniert heute anders als vor einhundert Jahren. Heute musst du mit 60, 65 nicht mehr sagen, du gehst in den Ruhestand. Das Wort regt mich auf. Darin steckt: beiseitestellen. Ich glaube, dass die Alten noch eine Rolle spielen. Wir lernen in der Schule fürs Leben, so sagen wir immer, dann für den Beruf, für danach aber nicht. Im Sauerland sagte man, übers Älterwerden musst du nicht reden, alt wirst du sowieso, und sterben tust du auch. Beides falsch. Du musst über beides reden, über das Älterwerden und auch über das Sterben, weil wir immer älter werden. Sterben ist ein Stück vom Leben, Sterben ist nicht außerhalb des Lebens, das ist ganz wichtig.
Versagen wir hier als Gesellschaft und in der Politik?
Ein schlauer Professor sagte mir einmal, die Gegenwart dauert drei Sekunden. Aber Gegenwart für den einzelnen Menschen ist sein ganzes Leben. Wir müssen mit den Alten über ihr Leben sprechen. Viele Jüngere interessiert das nicht. Ich weiß, das ist nicht böse gemeint. Bei einer Seniorenkonferenz in Witten sollte ich etwas vorlesen. Ich hatte keine Lust und sagte: „Ich erzähle mal vom 1. April 1946, da bin ich in die Schule gekommen.“ Da legten alle ihre Kuchengabeln hin und wir haben zwei Stunden geredet über die Zeit von 45 bis 50. Ich habe gemerkt: Sie haben niemanden mehr, mit dem sie reden können. Jeden Tag sterben Menschen ganz für sich allein. Jeden Tag. Wenn die Einsamen
Kinder wären – wir würden die Türen einschlagen und sie retten. Wir müssen soziale Kontakte organisieren! Und die Alten müssen mithelfen – sich zu Gruppen zusammenschließen, die voneinander wissen, miteinander reden.
Löst sich die Gesellschaft nicht insgesamt auf?
Die Einzelnen und der Staat sind noch da. Aber in der Gesellschaft dazwischen verändert sich manches. Zu meiner Zeit gingen die Menschen in die politische Partei, um zu erfahren, was Sache ist. Dort redeten die Menschen miteinander, tauschten Wissen aus und lernten aneinander. Jetzt haben viele elektronisches Wissen, aber das ersetzt nicht die Debatte in den Parteien.
Viele vergraben sich stattdessen in ihren Filterblasen.
Ich bedaure es sehr, dass die Stammtische, über die wir oft den Kopf geschüttelt haben, fast nicht mehr vorkommen. Die Kneipe, wo fünf oder acht miteinander quatschen über das, was ihnen einfällt, gibt es immer seltener. Diese Kommunikation auf der mittleren Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, gehört zum Austausch über die Fragen: „Was ist gesellschaftlich richtig? Was könnte besser werden?“
Ihre Frau ist Bundestagsabgeordnete. Sprechen Sie noch viel über Politik mit ihr?
Wir reden miteinander, wie das wohl bei allen Paaren der Fall ist. Natürlich reden wir auch über Politik. Aus der hohlen Hand gebe ich keine Ratschläge. In konkreten
Themen kennt sich meine Frau viel besser aus als ich. Wenn überhaupt, lasse ich mir vorher genauestens alles erklären.
Und Olaf Scholz?
Was für einen Rat könnte ich dem geben? Wie er seine Probleme zu lösen hat, weiß er hundertmal besser als ich. Ich kann ihm höchstens den Rat geben, mehr zu lachen. Aber wäre das glaubwürdig? Er ist eben keine Rampensau wie Schröder, der zum Bühnenrand stürmt. Er macht das anders.
Also haben Sie auch keinen Rat für die Koalition?
Einen einzigen. Sie sollte sich an die Koalition zwischen SPD und FDP 1972 erinnern. Willy Brandt hatte damals nur die zweitmeisten Stimmen. Er und Walter Scheel zogen sich mit 2 Flaschen Wein in die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen zurück. Am nächsten Morgen sagten sie, ja, wir machen eine Koalition. Lange Koalitionsgespräche gab es nicht. Vor der Kanzlerwahl gab es eine Fraktionssitzung der SPD. Jemand steht auf und sagte, Willy, was habt ihr denn vereinbart? Habt ihr etwas aufgeschrieben? Nein, haben wir nicht, sagte Willy. Aber Walter Scheel hat mir in die Hand versprochen, dass wir zusammen die nächsten 4 Jahre koalieren. Es gab Beifall und so kam es. Was ich sagen will: Ohne ein Grundvertrauen und den Willen zur Gemeinsamkeit geht es nicht.
Aber dafür gibt es doch den Koalitionsvertrag.
Es ist eines der Übel der Koalition, dass dieser Koalitionsvertrag so lang ist, dass er gar nicht mehr stimmen kann. Unser Koalitionsvertrag mit den Grünen 1998 hatte etwa 47 Seiten. Heute ist der Koalitionsvertrag zehnmal so dick. Jeder hat da seine Wünsche in der Euphorie untergebracht. Im Konfliktfall kann sich jeder auf irgendetwas berufen, was da drin steht. Dann kommt aber der bescheuerte Putin und fängt einen Krieg an und unser oberstes Gericht sagt, ihr könnt mit geliehenem Geld nicht so verfahren. Schon stimmt gar nichts mehr. Das ist aber kein Chaos, das ist falsch aufgeschrieben.
Wie geht es weiter?
Die Koalition deckt alle wichtigen Themen ab. Jetzt müssen die drei Parteien sich zusammenraufen. Da muss man Kompromisse machen, in der Koalition – und auch in der Partei. Ohnehin: Kompromisse sind unvermeidbar und oft auch klüger als Parteitagsbeschlüsse. In Koalitionsverträge kann man alles hineinschreiben, am Ende trifft alles auf die Realität. Das ist die Stunde der Wahrheit.
Sie sind 2013 aus dem Bundestag ausgeschieden. Gibt es bestimmte Aspekte Ihres politischen Lebens, die Sie vermissen?
Es ging ja noch weiter. Ich war damals 73, nach 38 Jahren im Parlament. Danach war ich sechs Jahre Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen und acht Jahre Präsident beim Arbeiter-Samariter-Bund. Da habe ich viele tolle Menschen kennengelernt. 2021 habe ich die ganzen Jobs niedergelegt. Nicht weil ich wusste, dass ich krank würde, aber irgendwie dachte ich, mit 81 ist auch mal gut. Nach meiner Krankheit bin ich jetzt so langsam wieder ein bisschen auf die Beine gekommen. Ich will nicht große Aufgaben übernehmen, denen ich nicht mehr gerecht werden kann. Aber ich will für mich noch das eine oder andere lernen durch lesen und mit Menschen sprechen.
Sie schreiben auch über aktuelle Themen in Ihrem Buch. Über die kommenden Wahlen schreiben Sie, es sei noch Zeit. Zeit wofür?
Zeit, um Tempo zu machen. Man sagt ja, wir machen acht Wochen Wahlkampf. Quatsch. Im Grunde baut sich das Vertrauen, das du brauchst für Wahlen, über die ganze Zeit auf – oder nicht. Ich habe ja auch Wahlkampf gemacht, 1995/1996 bis 1998. Wir sind extra aus dem Ollenhauer-Haus in ein eigenes Haus ausgesiedelt, mit einem roten Ballon obendrauf. Das war eine tolle Stimmung da. Aber Wahlkampf allein macht es nicht. Du brauchst auch Vorlauf. Du brauchst Leute, die wissen, wo das eigentlich hingehen soll. Wenn du versuchst, Leuten Geschichten von übermorgen zu erzählen, die sie nicht erkennen können, kommst du nicht weit. Du musst im Wahlkampf an die Probleme anklinken, die Menschen heute haben und aus der Perspektive, die sie heute haben. Und das mit dem Versuch, es besser zu machen und dafür Zustimmung zu gewinnen.
Und Vertrauen…
Ja, es ist eine Frage des Vertrauens im Menschen. Das haben wir damals bei Willy Brandt gemerkt. Von dem habe ich noch diese kleine rote Anstecknadel. 1972 haben wir für Willy Wahlkampf gemacht. Wir hatten wenig Geld für den Wahlkampf. Da kriegten alle diese rote Nadel. Ich hab noch ein paar Hundert Stück davon. Es ist Zufall, dass ich die jetzt anhabe, aber ich krieg ab und zu Briefe, wenn ich mal irgendwo im Fernsehen bin. „Ich bin Elisabeth“, schreiben sie, oder „Ich bin Maria. Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Du bist der Einzige, der noch die rote Nadel hat. Ich hab hier noch drei Stück.“ Die schicken sie mir. Ich freue mich sehr darüber. Die Nadeln sind ein bisschen kitschig, aber schön.
Sind Sie im Wahlkampf noch vorn dabei?
Wahlkampf macht mir Spaß. Und da, wo ich eingeladen werde, gehe ich dann auch zu dem einen oder anderen hin und erzähle was. Da spreche ich aber nicht über SPD oder die Politik, die da gemacht werden soll. Ich erzähle etwas über das Älterwerden der Menschen in dieser Zeit. Da kann ich was beitragen zur Orientierung und zur Demokratie. In dieser älteren Gruppe von Menschen sind sehr viele Wähler und Wählerinnen, die mit ihrer Partei sozusagen eine Lebenswahl getroffen haben. Die wissen auch genau: Die in der Partei machen auch Fehler, aber es waren doch immer die Besten, ich wähle die wieder. Das heißt, wer stabile Wahlergebnisse will, auch meine Partei, ist gut beraten, mit den Älteren zu sprechen und denen ein Signal zu geben: Es lohnt sich. Mach dein Kreuz wieder bei der SPD. Wenn Alte sagen, ich bin zu alt fürs Wählen, muss man sagen: Du bist mitverantwortlich für das, was mit deinen Enkelkindern passiert. Geh wählen und sorg dafür, dass das Ergebnis gut wird und die Demokratie gewinnt.
Herr Müntefering, Danke für das Gespräch.

Franz Müntefering: „Nimm das Leben, wie es ist. Aber lass es nicht so“, 2024, Dietz Verlag, 160 Seiten, 18 Euro
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 146 – Thema: Plötzlich Opposition. Das Heft können Sie hier bestellen.