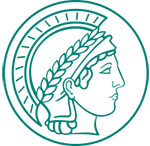Sollte die Ampelkoalition – was trotz interner Auseinandersetzungen wahrscheinlich ist – bis zum Ende der Wahlperiode halten, hätte die FDP dann 50 Jahre lang in Bundesregierungen gesessen. Das ist fast so lang wie die Unionsparteien mit 52 Jahren, mehr als die SPD mit 39 Jahren und deutlich mehr als die Grünen, die es dann auf elf Jahre bringen werden. In Kabinetten von sieben der neun Bundeskanzlern seit 1949 waren FDP-Bundesminister vertreten: bei Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Angela Merkel und nun bei Olaf Scholz. Mal pflegte man die FDP-Juniorpartner, manchmal triezte man sie. Diese agierten Mal aus einer Position der Stärke heraus, manchmal waren sie schwach. Traditionen bildeten sich heraus und Lehren wurden gezogen bis in die aktuelle Ampelregierung hinein.
In den Anfangsjahren der Bundesrepublik war die FDP zwar in Bundesregierungen mit der Union – von 1949 bis 1957 unter Adenauer und von 1961 bis 1966 nochmals unter Adenauer und dann unter Erhard. Aber Schlüsselressorts wie Innen, Außen, Verteidigung, Wirtschaft und Finanzen beanspruchten stets CDU und CSU. Die FDP bekam die schön klingende, aber einflusslose Aufgabe des „Vizekanzlers“, auch das Wohnungsbauministerium oder das Ministerium für Gesamtdeutsche Fragen. 1961 erlebte die FDP, dass sehr gute Wahlergebnisse Gefahren in sich bergen. Parteichef Erich Mende zog mit der Losung „Koalition mit der Union, aber nicht unter Kanzler Adenauer“ in den Wahlkampf. Die FDP erhielt 12,8 Prozent – ihr bis 2009 bestes Ergebnis. Aber Adenauer setzte sich noch einmal durch: Er blieb zwei weitere Jahre Kanzler. Die FDP wurde geziehen, „umgefallen“ zu sein. Ein Makel war das, der auch Jahre später immer instrumentalisiert wurde – je nach Bedarf und Kalkül mal aus der SPD, mal aus den Unionsparteien. Im damaligen Dreiparteiensystem konnte die FDP entscheiden, welche der beiden großen Parteien den Bundeskanzler stellte. Sie war vielen deshalb auch das „Waagscheißerle“ – jedenfalls solange sich die Volksparteien nicht wie erstmals 1966 zusammentaten.
Mit der Bundestagswahl 1969 begann für die FDP eine Blütezeit. Sie nutzte ihre Möglichkeiten, zwischen den beiden Volksparteien SPD und CDU/CSU zu entscheiden. Willy Brandt (SPD) wurde Kanzler, der FDP-Vorsitzende Walter Scheel wurde Außenminister. Die Liberalen waren stark genug, um in Schlüsselministerien einzuziehen: Neben dem Außenministerium sicherten sie sich die Ressorts für Inneres, Justiz und Wirtschaft. Nach Brandts Rücktritt 1974 wählte die FDP Helmut Schmidt zu seinem Nachfolger. Dafür forderte Scheel erfolgreich eine Morgengabe der SPD: Die Sozialdemokraten müssten seiner Wahl zum Bundespräsidenten zustimmen. Unter Schmidt und Genscher begann die CDU, die FDP heftig zu umwerben. Helmut Kohl pflegte Kontakt zu Genscher.
Folgenreicher Seitenwechsel
In der FDP gab es zwei Flügel: den wirtschaftsliberalen unter dem Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff und den sozialliberalen, angeführt von Innenminister Gerhart Rudolf Baum und einer Reihe von jüngeren FDP-Politikern. In der Mitte zwischen Rechtsliberalen und Linksliberalen operierte Genscher. Machtpolitisch war das klug. Genscher blieb zunächst treu auf Schmidts Seite. In den Bundestagswahlkampf 1980 gegen den Unions-Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß (CSU) zogen die Liberalen mit dem Motto, wer Schmidt als Kanzler wolle, müsse Genschers FDP die Stimme geben. Mit Erfolg: Die FDP erzielte 10,6 Prozent.
Doch Schmidt und Genscher vertrauten einander nicht. Vor allem in der Sicherheits-, Finanz- und Haushaltspolitik prallten unterschiedliche Ansichten aufeinander. Genscher und Lambsdorff brachen 1982 die Koalition. Nach 13 Jahren war die SPD/FDP-Ära beendet. Helmut Kohl wurde Kanzler. Der sozialliberale FDP-Flügel war empört. Er sah sich von Genscher und Lambsdorff hintergangen. Scharenweise verließen Politiker dieser Strömung ihre Partei. Die wenigen verbliebenen Sozialliberalen wie Baum und Hirsch wurden in Medien viel zitiert, waren aber ohne Einfluss.
Die verbliebenen „Sozialliberalen“ waren Feigenblätter in ihrer Partei. Die Sozialdemokraten wandten sich von der FDP ab und warfen ihr „Verrat“ vor. Auch in den meisten Bundesländern wollten sie mit den Liberalen nichts mehr zu tun haben. Mit den Grünen war ein neuer potenzieller Bündnispartner für die Sozialdemokraten entstanden. Einen weiteren Koalitionswechsel hätte die FDP nicht überstanden. Kohl freilich nutzte das nicht aus. Bei Koalitionsgesprächen fragte er: „Und was kriegt die FDP?“, wenn CDU und CSU einige ihrer Vorhaben durchgesetzt hatten. Ein Bündnis mit der FDP war ihm lieber als eine absolute Mehrheit der Unionsparteien. Hier hätte er auf Eigenmächtigkeiten der CSU Rücksicht nehmen müssen. So aber konnte er auf breiter politischer Klaviatur spielen. Wie unter Brandt und Schmidt wurden der FDP wichtige Ministerien überlassen: Auswärtiges Amt, Justiz und Wirtschaft. Die FDP dankte es ihm. Noch 1998 führte sie einen Wahlkampf getreu der Maßgabe, Kohl sei ein verlässlicher Partner. Koalitionsaussagen wurden zugunsten der Unionsparteien gemacht. Nicht ganz freiwillig: Auch im Spätherbst von Kohls Kanzlerschaft wäre der FDP-Wählerschaft ein Wechsel nicht zu vermitteln gewesen.
Unglückliche Liebesehe
Guido Westerwelles Aufstieg begann. Einerseits lehnte er ein „Wer Kohl will, muss FDP wählen“ ab. Andererseits bereitete er während der rot-grünen Jahre ein Bündnis mit Angela Merkels CDU vor. 2004 verabredeten sie gemeinsam und erfolgreich, Horst Köhler als Bundespräsidenten zu wählen. 2005 reichte es nicht für „Schwarz-Gelb“ – nicht wegen der FDP. Die Union schnitt zu schlecht ab. Vier Jahre später war es so weit. Für die FDP kamen schwere Jahre – trotz allem.
Dass Christian Lindner bei den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen 2021 das Finanzministerium – das aus seiner Sicht einflussreichste Ressort – für die FDP herausholen wollte, lässt sich durch einen Blick in die jüngere Vergangenheit erklären. Niemals sollte sich wiederholen, was der FDP widerfuhr, als sie zwischen 2009 und 2013 mit den Unionsparteien unter Führung Angela Merkels die Bundesregierung bildete. Was als natürliches Bündnis aus CDU/CSU und FDP begann, wurde eine Koalition, die so zerstritten war wie kaum eine sonst. 2009 hatten die Liberalen unter ihrem Vorsitzenden Guido Westerwelle einen monothematischen Wahlkampf geführt. „Arbeit muss sich wieder lohnen“ lautete ihr Motto, und sie forderten Steuersenkungen. Nie erzielte die FDP einen höheren Stimmenanteil als damals: 14,6 Prozent.
Schlecht wie nie zuvor schnitten die Unionsparteien ab: 33,8 Prozent. Merkels CDU und die CSU nahmen sich vor, dieses Ergebnis müsse ein Ausrutscher bleiben. Die FDP gehöre wieder auf „Normalmaß“ gestutzt, das irgendwo zwischen sechs und neun Prozent taxiert wurde. Dazu gehörte eine Politik, die FDP politisch und personell zu entkernen. Zum Wahlkampf der FDP hätte der Zugriff auf das Bundesfinanzministerium gepasst. Merkel aber ließ Westerwelle wissen, jedes Ministerium könne er haben – nur das Finanzministerium nicht. Sie hatte aus dem Bündnis mit der SPD und Finanzminister Peer Steinbrück gelernt, dass die Kanzlerpartei, besonders in Zeiten internationaler Bankenkrisen und der Krise des Euro, den Finanzminister stellen solle, ja müsse. Wolfgang Schäuble solle, ja müsse es werden. Westerwelle blieb nichts übrig, als stattdessen ins Auswärtige Amt einzuziehen.
Aus Schaden klug?
Das entsprach den Traditionen Bonner und Berliner Regierungskoalitionen. Seit 1966 besetzte immer der kleinere Koalitionspartner das Außenministerium. Hans-Dietrich Genscher, der dieses Amt zwischen 1974 und 1992 unter den Kanzlern Schmidt und Kohl ausgeübt hatte, riet Westerwelle dringlich dazu, an diesem Brauch festzuhalten. Der folgte dem Rat – erstens, weil Merkel es so wollte, und zweitens, weil Finanzpolitik nicht sein persönlicher Arbeitsschwerpunkt gewesen war. Doch in der FDP kam eine Debatte auf, der Parteivorsitzende hätte kämpfen müssen. Die Finanzpolitiker der FDP beklagten sich. Alsbald machten Merkel und Schäuble klar, dass Steuersenkungen vom Tisch waren.
Doch auch in der Außenpolitik wurde Westerwelle neben der Bundeskanzlerin zur Randfigur. Merkel reiste zu Gesprächen nach Washington, Moskau und Peking, Westerwelle nach Kairo und Südamerika. Innerparteiliche Debatten schwächten den FDP-Chef. Minister von CDU und CSU redeten schlechten über ihre liberalen Kabinettskollegen – sie verstünden ihr Handwerk nicht. Westerwelle wurde als Parteivorsitzender entmachtet. Auf einem Parteitag im Dezember 2012 amüsierte die Kanzlerin die Delegierten mit dem Spruch „Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen“. Ein Jahr später scheiterte die FDP bei der Bundestagswahl an der Fünfprozenthürde – erstmals seit 1949.
Nach seiner Rückkehr in den Bundestag ließ Lindner die Jamaika-Sondierungsgespräche mit Union und Grünen platzen („Besser nicht regieren als schlecht regieren“). Das hing auch mit dem Trauma zusammen, das seine Partei und er immer noch mit der Merkel-CDU verbanden. Dass die FDP in der schwarz-gelben Koalition Steuersenkungen selbst mit einem liberalen Finanzminister nicht hätte durchsetzen können, spielte – aus Sicht heutiger FDP-Akteure – aber keine Rolle. Ihre Partei hätte ihr Profil deutlich machen können. Sie hätte ihren Wählern zeigen können, kämpfen zu wollen. Die Partei habe aber unter Merkels „Machiavellismus“ gelitten, sagte der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke im vergangenen Frühjahr in einer Bundestagsdebatte. Merkel habe ihn hintergangen, hatte auch Westerwelle geklagt, als es zu spät war. Alles habe die FDP geschluckt und mit sich machen lassen, heißt es heute in ihren Reihen. Lindner hat die Konsequenzen gezogen. Er tut sein Möglichstes, sich gegenüber SPD und Grünen zu behaupten. Kanzler Olaf Scholz tut sein Bestes, die FDP bei Laune zu halten. Und niemand attackiert im Bundestag die CDU/CSU-Opposition wie die Spitzenleute der FDP.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 144 – Thema: Interview mit Can Dündar. Das Heft können Sie hier bestellen.