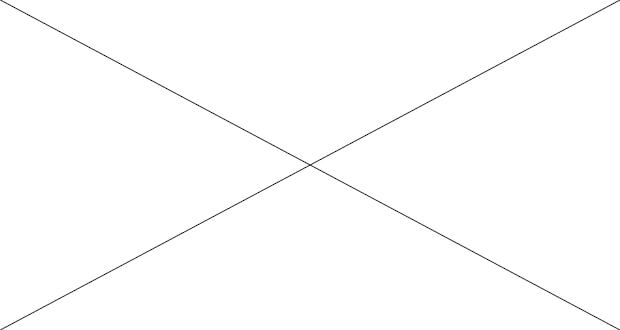p&k: Herr Professor Singer, Sie haben zum 50. Geburtstag der damaligen Oppositionsführerin Angela Merkel einen Vortrag gehalten. Da sagten Sie, dass menschliche Hirne mit der Planung gesellschaftlicher Entwicklung überfordert seien, wir kämen nur über Versuch und Irrtum weiter. Müssen wir uns von den großen Gesellschaftsentwürfen verabschieden?
Wolf Singer: Ich wollte damals ein Plädoyer für eine Irrtumskultur halten, denn politische und ökonomische Systeme sind dermaßen komplex, dass sie sich zwangsläufig nicht-linear entwickeln. In solchen Systemen sind Vorhersagen über die künftige Entwicklung fast unmöglich. Vielleicht lassen sich der erste und der zweite Entwicklungsschritt noch überschauen, aber dann gibt es so viele mögliche Varianten, dass völlig unklar ist, wie es weitergeht. Das bedeutet, dass auch das gezielte Eingreifen, das Drehen von Stellschrauben nicht notwendig den gewünschten Erfolg hat. Selbst wenn man alle Variablen kennen würde, ließe sich nicht langfristig voraussagen, was das Eingreifen in das System bewirken wird. Hinzu kommt, dass weder die Bundeskanzlerin noch sonst irgendein Fachmann alle Systemvariablen kennen kann.
Immer wieder diskutieren die Europäer über die Finalität der Europäischen Union. Kann man das also gleich bleiben lassen?
Singer: Nein, man muss natürlich eine Vision haben. Allerdings sollte man vorsichtig sein. Man sollte Ziele formulieren, zum Beispiel Frieden oder eine einheitliche Handelszone. Dann müsste man unter den möglichen Eingriffen, die zu diesem Ziel führen können, den im Augenblick vernünftigsten Weg wählen, wohl wissend, dass es ganz anders kommen kann als intendiert war. Dann kann man hinterher viel leichter sagen: „Wir hatten eine gute Absicht, doch leider hat das System anders reagiert, als wir uns vorgestellt haben. Deswegen werden wir uns jetzt neu aufstellen und etwas anderes versuchen.“ Das ist so ähnlich, wie die Evolution auch vorgegangen ist. Die hat das nicht intentional gemacht, aber es ist im Grunde der gleiche Mechanismus. Es wird ständig etwas verändert, zum Beispiel im Vier-Jahres-Rhythmus der Wahlperioden – das sind eigentlich System-Mutationen.
Herr Clement, Sie sprechen sich dafür aus, dass wir uns eine Art „Vereinigte Staaten von Europa“ zum Ziel setzen sollten.
Wolfgang Clement: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass das richtig ist. Aber dass wir auf dem Weg dorthin noch etliche Irrungen und Wirrungen vor uns haben, das ist unzweifelhaft. Und deshalb glaube ich auch, dass man auf diesen Wegen umsichtig sein und sich alle Optionen erhalten muss, damit man nicht an irgendeiner Weggabelung scheitert.
Glauben Sie auch, dass man hier nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ vorgehen muss?
Clement: Das tun wir ja permanent. Und das größte Beispiel dieser Art erleben wir derzeit: nämlich die Finanzkrise, die niemand von uns hat kommen sehen. In Deutschland waren wir ja auf dem Weg des Schuldenrückbaus, auf dem Weg zu einer nachhaltigen Finanzpolitik. Die Finanzkrise hat das alles zunichte gemacht, und nun beginnen wir wieder von vorn. Zu Europa: Verglichen mit den großen europäischen Visionen der 50er und 60er Jahre wurde im Laufe der Zeit unglaublich viel wieder zurückgenommen. Im Moment befinden wir uns leider wieder in einem Prozess der Renationalisierung. Wir müssen uns ständig bemühen, den europäischen Prozess in Gang zu halten. Rückschritte gehören dazu: So wird es zum Beispiel nicht einfacher, wenn wir es demnächst mit einer anderen, einer konservativen britischen Regierung zu tun bekommen sollten. Aber auch das darf uns nicht entmutigen.
Wird die europäische Idee nicht ohnehin nur von bestimmten Eliten verfolgt?
Clement: Das Problem ist, dass die so genannten Eliten, die politischen Eliten, zurzeit eher doppelzüngig argumentieren. Sie sprechen ständig von Europa. Aber beinahe jeder Politiker spielt in seinem nationalen Wahrnehmungsraum nicht selten die nationalen Interessen gegen Europa aus. Deswegen sind wir in einem Prozess voller Brüche und Widersprüche.
Manfred Pohl: Europa ist in den Herzen der Menschen noch nicht angekommen. Auf der einen Seite gibt es eine Renationalisierung, und auf der anderen Seite reden die Politiker davon, ein vereintes Europa aufzubauen. Ich glaube, die Menschen spüren diese Doppelzüngigkeit. Diese Doppelzüngigkeit hört nur dann auf, wenn wir wirklich ein vereintes politisches Europa haben, mit einem Präsidenten, der wirklich ein Präsident ist wie etwa der US-Präsident. So eine Symbolfigur würde Europa sehr gut tun. Europa hat auch keine gemeinsamen Rituale. Ich glaube, jede größere politische Einheit lebt von Symbolen und Ritualen. Der Frankfurter Zukunftsrat legt derzeit ein Projekt auf, um Europa in die Herzen der Menschen zu bringen: Wir wollen eine europäische Schreibwerkstatt für Jugendliche aus den 27 Mitgliedsstaaten der EU gründen. Es gibt ja bereits europäische Städtepartnerschaften. Vielleicht bekommen wir es eines Tages hin, dass es auch Zeitungspartnerschaften oder sogar eine europäische Zeitung gibt.
Singer: Was Sie hier gerade andeuten, Herr Pohl, das liefe darauf hinaus, durch Schaffung zusätzlicher Symbole einen Nationalstaat „Europa“ zu gründen, in dem die Unterschiede eingeschmolzen werden, so wie wir das aus den USA kennen. Aus systemtheoretischer Sicht ist das keine gute Lösung, denn es sind immer solche Systeme stabiler, in denen Pluralität erlaubt und erwünscht ist, die aber durch ein intelligentes Netzwerk von Kopplungen und Interaktionen als Ganzes stabilisiert wird. So macht es die Natur: Im Gehirn beispielsweise haben Sie ganz viele Nationalstaaten, die unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Die sind so intelligent miteinander verschaltet, dass sie insgesamt einen deutlichen Mehrwert erzeugen, sehr viel mehr, als wenn sie zentralistisch koordiniert und gleichgestellt würden. Meine Vision von Europa wäre eher eine, bei der die Pluralität geschützt wird. Denn dieses alte Europa ist unendlich viel kreativer als die USA. Wir sind bloß im Verkaufen unserer Kreativität nicht so gut, weil uns die Koordination fehlt. Aber ich würde lieber eine Struktur haben, in der die Individualität erhalten bleibt.
Aber muss sich nicht der Einzelne anhand von Symbolen mit Europa identifizieren können?
Singer: Nein. Die Leute müssen nur feststellen, dass die EU besser ist als anderes. Nehmen Sie das Internet: Das hat auch kein Mensch geplant. Ich glaube nicht, dass man unbedingt einen pyramidalen Aufbau mit einer Zentralregierung braucht. Das sind überkommene Vorstellungen.
Ist da keine übergeordnete Instanz notwendig, die das Ganze koordiniert?
Singer: Schon, das sollte dann aber nur ein Bewertungssystem sein, kein System, das eine Meta-Intelligenz hat und alles von oben lenkt.
Eine Europäische Kommission, die sich in nationale Wirtschaftsbelange einmischt, stört also nur?
Singer: Wenn sich zeigt, dass das System so nicht funktioniert, muss man es ändern. Probieren geht über studieren, das ist ein offener Prozess.
Clement: So wie die verschiedenen Teile des Gehirns abgestimmt und hochsensibel aufeinander reagieren, so muss das auch mit den Mitgliedsstaaten in Europa gehen. Momentan ist das nicht der Fall. Wir sollten versuchen, die Vielfalt Europas zu nutzen. Aber gleichzeitig muss dieses Europa in der Lage sein, auch geschlossen zu handeln. Deutschland allein ist nicht in der Lage, auf dem Weltmarkt zu bestehen, wir brauchen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und eine gemeinsame Außenpolitik. Wir leben in einem Zeitalter, in dem die USA ihre Vorherrschaft an die G20 abgeben, an andere Weltregionen. Und unter diesen Weltregionen ist Europa – obgleich wirtschaftlich am stärksten – zurzeit eine der schwächsten Stimmen. Im Verhältnis zwischen den USA und China wird sie kaum zur Kenntnis genommen.
Pohl: Die Geschwindigkeit, mit der die Welt sich verändert, ist ein Problem. Schon in zehn Jahren wird die Welt ganz anders aussehen als heute. Diese Geschwindigkeit hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Natürlich müssen wir die lokalen und regionalen Kulturen, die es in Europa gibt, erhalten. Aber dieses Europa braucht auch Symbole und Rituale, die für den Zusammenhalt sorgen. Und ich glaube, man muss eine politische Struktur haben, die dafür sorgt, dass Europa in der Welt noch gehört wird. Es hat keinen Sinn, sich an die USA anzuhängen und zu sagen: „Wir leben und sterben mit den USA.“
Was würde passieren, wenn sich Europa nicht zu einer politischen Einheit entwickelt?
Pohl: Dann droht Europa, bedeutungslos zu werden. Wenn wir nur noch Nationalstaaten sind und uns nur noch mit unserem nationalen Kram befassen, dann wird die Rolle Europas in der Welt eine sehr kleine sein. Die Länder, die wir heutzutage als Entwicklungsländer oder Dritte-Welt-Länder bezeichnen, sind Jahrhunderte lang von europäischen Staaten wie Frankreich, Großbritannien, Portugal und Spanien unterdrückt worden. Erst kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erlangten die meisten südamerikanischen und afrikanischen Staaten ihre Unabhängigkeit von den großen europäischen Kolonialmächten. Diese Länder gewinnen jetzt an Bedeutung – da sind Konflikte vorprogrammiert. Was mich vor allem als Historiker beschäftigt, ist, dass wir ein Europa zusammenschmieden sollen, dessen einzelne Länder über Jahrhunderte die Welt beherrscht haben.
Herr Clement, ist das Ziel von den „Vereinigten Staaten von Europa“ nicht sehr hoch gegriffen? Die USA entstanden ja auch nicht aus so starken Nationalstaaten heraus.
Clement: Ich gebe zu, dass der Begriff „Vereinigte Staaten von Europa“ den Eindruck erweckt, ich wolle die USA kopieren. Jedoch kann ich nicht von einer europäischen Vision sprechen, ohne sie auch dingfest und fassbar zu machen. Und dazu gehört nun mal, dass sich die Staaten Europas zusammentun und zu einer gemeinsamen Interessenvertretung kommen. Entscheidend ist, dass Europa, wie Henry Kissinger einmal gesagt hat, irgendwann eine eigene Telefonnummer hat, über die es erreichbar ist. Das heißt nicht, dass wir im Innenverhältnis alles platt machen sollten. Aber noch einmal: Was wir derzeit erleben, ist faszinierend. Die USA übergeben die Verantwortung an die G 20. Ein solcher Wandel wäre wohl früher nur in kriegerischem Konflikt zustande gekommen. Das ist atemberaubend, weil eine Weltmacht von sich aus andere mit in die Verantwortung einbezieht. Aber wo bleibt unser Europa?
Pohl: Was da passiert, widerspricht eigentlich jeder historischen Erfahrung. Auch in der Geschichtswissenschaft wird ein Umdenken notwendig sein. Geschichte muss generell neu bewertet und neu betrachtet werden. Ich glaube, die nächste Generation wird eine ganz andere Geschichte schreiben als die Generation, die sie bis jetzt geschrieben hat.
Herr Professor Singer, ist da womöglich doch mal die Vernunft in der Geschichte am Werke?
Singer: Vernunft und das Streben nach Macht haben immer schon die Politik regiert. Ich glaube nicht, dass frühere Machthaber unvernünftig waren. Nein, hier vollzieht sich ein ganz normaler evolutionärer Prozess. Wenn Sie einfache überschaubare Systeme haben, zum Beispiel Stämme, Familienclans oder kleine Ethnien, dann ist es besser, solche Systeme hierarchisch zu strukturieren und zentralistisch zu lenken. Wenn die dann auch in der Abgrenzung zu anderen Ethnien nicht zu viele komplexe Verbindungen haben, dann ist das wunderbar. Aber wenn die Systeme verflochtener und damit komplexer werden, wie es im Zuge der Globalisierung geschieht, dann funktioniert das nicht mehr. Dann wird die Sache unüberschaubar. Und hier müssen dann solche Systeme eingeführt werden, wie sie Herr Clement erwähnt hat. Man braucht immer wieder Knoten im Netz, die Steuerungsaufgaben haben. So können die einen für die Finanzen zuständig sein, die anderen für die Klimapolitik und so weiter. Dort muss möglichst viel Kompetenz gebündelt und Konsens hergestellt werden.
Aber können durch ein solches System Konflikte dauerhaft minimiert werden? Noch vor zehn Jahren gab es mitten in Europa einen Krieg.
Singer: Ja, aber sie sehen ja, wie wir den Krieg bewältigt haben. Dieser ist ganz anders bewältigt worden als die Kriege und Konflikte vorher. Hier hat sich eine Gemeinschaft darum bemüht, in Europa nationale Vorurteile durch intensive Kommunikation und Interaktion abzubauen. Hierarchische Strukturen werden durch mächtige horizontale Kopplungen zwischen den Staaten ergänzt. Wir haben außerdem verbindliche Menschenrechte und zumindest in weiten Teilen der Welt eine funktionierende Gerichtsbarkeit. Dass ich einen ehemaligen Staatspräsidenten wie Milošević vor Gericht sehen kann, ist eine Sensation. Wenn sich China eine Demokratie erlauben würde wie wir, dann zerbräche dieses Riesenreich sofort. Die sozialen Gradienten, die dort herrschen, sind so abenteuerlich groß, dass sie vorerst nur dirigistisch und mit einem strengen Korsett bewältigt werden können. Wenn dieses Korsett zusammenbräche, versänke China im Chaos.
Herr Clement, Sie mahnen immer wieder eine europäische Öffentlichkeit an. Glauben Sie, dass so etwas automatisch mit einer fortschreitenden wirtschaftlichen Integration kommt – oder muss man das anschieben?
Clement: Ich glaube, dass man es anschieben muss. Natürlich hat die wirtschaftliche Integration eine starke Dynamik. So ist zum Beispiel Nordrhein-Westfalen viel stärker mit den Benelux-Staaten verbunden als mit anderen Teilen Deutschlands. Für NRW ist der Flughafen Amsterdam wichtiger als der künftige Großflughafen Berlin. Und ich glaube, dass unsere heutigen föderalen Strukturen in Deutschland der europäischen Integration nicht standhalten können. Europa muss sich entwickeln. Gleichzeitig muss die Politik aber viel stärker über die Grenzen hinaus das Gespräch suchen. Und die Medien müssen hier mithelfen. Ich bin für das öffentlich-rechtliche System in Deutschland, aber ich frage mich, warum die gebührenfinanzierten Programme Europas sich nicht zusammentun und ein richtiges Europa-Programm auf die Beine stellen. Und zwar ein Vollprogramm, von morgens bis abends, rund um die Uhr. Das kann man in Englisch machen und mit den Nationalsprachen unterlegen.
Aber führen die wirtschaftliche Integration und das Internet nicht automatisch zu einem europäischen Bewusstsein, frei nach Karl Marx: Das Sein bestimmt das Bewusstsein?
Pohl: Nein, das reicht absolut nicht. Ein Beispiel: Als der Euro eingeführt wurde, wollten wir eine große Initiative in den zwölf Euro-Ländern starten. Die Menschen sollten große Euros bemalen, das Ganze sollte dann in eine Ausstellung münden. Dadurch wollten wir Emotionen wecken und eine Identifikation mit der neuen Währung und mit Europa schaffen. Der damalige Bundesbankpräsident hat das Projekt aber abgelehnt. Für ihn war das alles nur Quatsch. Er sagte, wenn die neue Währung erst im Umlauf ist, kommt jeder automatisch damit in Berührung. Heute ist der Euro in den Taschen der Menschen, aber noch lange nicht in ihren Herzen.
War die Einführung des Euro aus Ihrer Sicht so etwas wie eine historische Zwangsläufigkeit – oder war hier das Handeln von Persönlichkeiten wie Helmut Kohl entscheidend?
Pohl: Der Euro wäre so oder so gekommen. Und ich glaube, dass er richtig und wichtig ist, denn er ist ein positives Symbol für Europa geworden.
Clement: Da wären wir wieder bei den Anstößen, die man geben muss. Man muss immer eine bestimmte Trägheit überwinden. Die Frage ist nur, wie man sie überwinden kann. Nehmen wir zum Beispiel den Massentourismus in Europa: Wir fahren in andere Länder, und zwar gewissermaßen unter Ausnahmebedingungen. Die meisten Touristen verstehen kaum die Sprache ihres Reiselandes. Sie verhalten sich, als seien sie daheim…
Singer: Ich habe eine Vision, an der ich festhalte: Wer Außenminister werden möchte, muss nachweisen, dass er mindestens eine Fremdsprache spricht und mal ein Jahr lang als Rucksacktourist, abseits von roten Teppichen und 5-Sterne-Hotels, in der Welt unterwegs war. Ich würde auch einen Anreiz für Touristen schaffen. Man sollte deutliche Hotel- und Flugpreisreduzierungen für Menschen einführen, die über ein Minimum an Kenntnissen über Sprache und Landeskunde verfügen. Man könnte Tests einführen, und wer da gut abschneidet, bekommt den Urlaub für die Hälfte des normalen Preises. Diese blinde Fahrerei bringt nämlich nichts. Das schürt höchstens Vorurteile.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Zu Guttenberg – Politiker des Jahres. Das Heft können Sie hier bestellen.