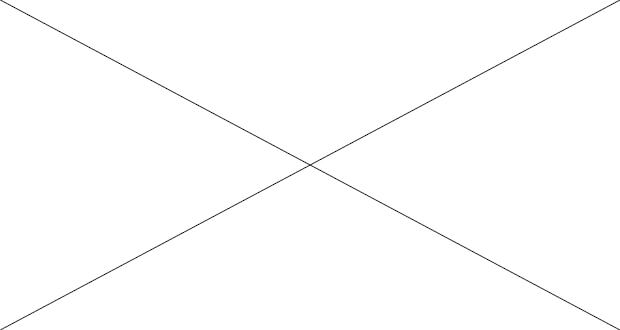p&k: Frau Pohl, wie steht es um den politischen Journalismus in Deutschland?
Ines Pohl: Da muss man unterscheiden zwischen Regionalzeitung und überregionaler Zeitung. Wir sollten nicht nur über die Bedrohung des Qualitätsjournalismus durch Online-Medien sprechen und dabei außer Acht lassen, was sich bei den Regionalzeitungen tut. Da ist der unabhängige Journalismus in großer Gefahr. Das hat viel mit der Konzentration des Zeitungsmarkts zu tun und der Anzeigenflaute.
Aber die überregionalen Zeitungen liefern Qualität?
Pohl: Ja, ich finde, bei überregionalen Zeitungen wird nach wie vor guter Journalismus gemacht. Deutschland ist traditionell nicht so herausragend im Investigativbereich, doch richten jetzt viele große Zeitungen Recherchepools ein. Ich bin übrigens neugierig, welche Entwicklungen es im Bereich Open Data und bei Seiten wie Wikileaks geben wird.
Herr Görlach, wie lautet Ihre Bestandsaufnahme?
Alexander Görlach: Wir erleben eine immer stärkere Zuspitzung auf die Persönlichkeit von Politikern. Das heißt, Journalisten personalisieren, weil die politischen Prozesse immer komplexer werden. So wird ernsthaft darüber diskutiert, ob Karl-Theodor zu Guttenberg auf einer Gala seine Fliegerkluft von der Afghanistanreise anbehalten musste, oder ob er sich nicht noch hätte umziehen können. Es sind eigentlich Zeiten für authentische Politiker, doch konterkarieren diese das alles durch die extreme Kontrolle, die sie etwa bei der Autorisierung von Interviews ausüben wollen. Deswegen ist der politische Journalismus sehr häufig frustrierend.
Pohl: Die Personalisierung findet nicht nur statt, weil die Materie und die Prozesse komplexer werden. Das hängt auch damit zusammen, dass die Kollegen immer weniger Zeit und Ahnung haben und jede Geschichte möglichst schnell bringen wollen. Dann schreibt es sich natürlich flott über die Farbe einer Krawatte. Doch wenn man sich mal wirklich mit einem Haushalt oder der Arzneimittelgesetzgebung beschäftigt, kostet das Zeit und Kraft. Unter Umständen muss man für bestimmte Geschichten auch Mut haben – gerade, wenn es um Lobbyismus und Wirtschaftszusammenhänge geht. Die Welt war früher auch schon kompliziert, aber die Redakteure hatten mehr Zeit.
Herr Görlach, sie haben einmal gesagt, die Nachricht sei kein Geschäftsmodell mehr, wohl aber ihre Deutung. Kann ein Medium auf die recherchierte Nachricht verzichten?
Görlach: Das bezog sich auf das Geschäftsmodell von „The European“. Im Web ist die Nachricht überall, und die Nachrichten sind auf allen Portalen gleich. Also muss man mehr bieten, nämlich eine Interpretation und intelligente Analyse der Nachricht. Es reicht ja nicht, immer nur zu schreiben „einerseits, andererseits“ und „es bleibt abzuwarten, ob …“.
Pohl: Die Aufgabe eines Journalisten ist es natürlich, Nachrichten einzuordnen, auch kommentierend einzuordnen. Aber es ist auch die Aufgabe, Nachrichten zu gewichten, im Sinne von: Diese Geschichte ist nur eine Meldung, aus dieser Geschichte machen wir mehr. Bei gewissen Themen, zum Beispiel Rechtsextremismus, setzen wir ein Zeichen für die Wichtigkeit der Nachricht, indem wir sie groß bringen. Nicht, dass wir sofort einen Kommentar schreiben würden, aber wir ordnen das Ganze entsprechend ein.
Görlach: Die Prozesse in der digitalen Öffentlichkeit unterscheiden sich an dem Punkt schon von der „klassischen“ Öffentlichkeit. Trotzdem glaube ich auch, dass es im Web eine einordnende Gatekeeper-Funktion des Journalisten braucht. Das wurde bei Wikileaks ganz deutlich, die Seite hat mit etablierten Medien auf der ganzen Welt zusammengearbeitet.
Der Druck auf die Journalisten nimmt zu, Redaktionen werden ausgedünnt. Ein investigativer Journalist ist aber unter Umständen monatelang an einem Thema dran, ohne dass etwas Verwertbares herauskommt. Kann die „taz“ sich so etwas leisten?
Pohl: Wir müssen es uns leisten. Wir hatten gestern eine große Redaktionsversammlung, bei der es genau um dieses Thema ging. Wir wollen durch schlankere Abläufe mehr Recherchekapazität schaffen. Wir müssen uns aber auch neue Techniken aneignen. Wir konnten jetzt ein paar junge Kollegen einstellen, die mit Open-Data-Quellen sehr gut umgehen können. Wir müssen uns in die Lage versetzen, die große Masse an Daten aufzubereiten, die heute frei verfügbar ist. Man kann etwa sehr gut darstellen, welche Spendenflüsse es über Jahre an die Parteien gegeben hat. Da ist viel Musik drin. Und ich glaube auch, dass man verstärkt Kooperationen eingehen muss, weil es immer öfter Menschen gibt, die dir Datensätze zuspielen.
Görlach: Ja, wir müssen kooperieren. Früher hat ein Journalist noch auf seinen Visitenkarten gehockt und seine Story ausgebrütet. So hätte der WDR in Köln den Teufel getan, eine Geschichte mit dem „Express“ oder dem Dom-Radio zu teilen. Das ist im Web anders: Da muss man Netzwerke schaffen. Wenn ich weiß, dass ein anderes Medium Expertise auf einem Gebiet hat, habe ich kein Problem damit, dort anzuklopfen.
Pohl: In den USA nutzen Journalisten schon vermehrt das Wissen der Netz-Communitys. Ich bin oft dort und verfolge die Entwicklung. Kooperative Ansätze sind gerade für uns bei der „taz“ interessant: In unserer Genossenschaft sind beispielsweise sehr viele Ärzte, weshalb wir eigentlich eine ganz große Kompetenz im Gesundheitswesen haben. Warum sollte die Redaktion sich nicht öffnen und diese Kompetenz nutzen?
Bislang gibt es eine Klasse von Alpha-Journalisten, die in Berlin das große Rad drehen: Da gibt es Deals mit Politikern, dass man Informationen zurückhält, wenn man später eine Exklusiv-Geschichte dafür bekommt. Geben künftig die Nerds den Takt vor, Nerds wie Wikileaks-Gründer Julian Assange?
Pohl: Es ist eine große Chance, dass all die Selbstverständlichkeiten im Journalismus aufgebrochen werden, auch die Absprachen mit einzelnen Medien. Wenn ein Politiker etwas der „FAZ“ steckt, weil die immer so nette Kommentare über ihn schreibt, ist das schlimm. Ich glaube, unser Selbstverständnis muss sich wandeln. Ich habe ja auch als Korrespondentin gearbeitet: Das ist schon bemerkenswert, was da an Deals läuft. Ich finde es super, dass das durch Wikileaks in Frage gestellt wird.
Görlach: Für Medien, die auf Nachrichtenjournalismus setzen, ist das natürlich wichtiger als für unsere Redaktion. Die Nachrichten-Industrie lebt nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Also werden Interviewpassagen, die knallen müssen, an die Agenturen gegeben. Welche Knaller das sein werden, wird vorher gerne mal mit den Interviewten abgesprochen. Und wenn dann die „Tagesschau“ eine Passage aufgreift und beispielsweise den „Spiegel“ als Quelle nennt, dann hüpfen die Kollegen, vor Stolz nahezu platzend, wild onanierend durch ihre Redaktion.
Pohl: Aber was hat der „Spiegel“ aus dem Wikileaks-Material gemacht? Der hat doch erbärmlich versagt: Die sichten die ganzen Daten und bringen dann dieses Zeug über Teflon-Merkel und den aggressiven Westerwelle auf dem Titel. Nichts Neues. Und erst im zweiten Teil standen dann die Sauereien über die Waffengeschäfte mit Spanien drin. Der „Guardian“ hat hier deutlich besser gearbeitet: Die haben sich jeden Tag ein neues Detail aus den Materialien rausgesucht und das gründlich aufgearbeitet.
Alan Rusbridger, der Chefredakteur des „Guardian“, hat übrigens gesagt: „Wir müssen uns darauf einrichten, Journalismus künftig mit weniger Leuten zu machen und demütiger werden.“ Müssen die großen Meinungsmacher demütiger werden, weil sie kein Deutungsmonopol mehr haben?
Görlach: Als ehemaliger Messdiener muss ich mich mit Demut auskennen. Es ist doch klar, dass Debatten wie die über den Einsatz in Afghanistan immer im Raum stehen und nicht so schnell abklingen. Man muss sich davon verabschieden zu meinen, man könne eine Debatte ganz alleine starten und vorantreiben. So wichtig ist kein Medium mehr. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem Meinungsjournalismus und investigativer Journalismus sich treffen: Wenn eine Debatte läuft, musst Du an der richtigen Stelle einhaken und die richtigen Fragen stellen.
Pohl: Demut ist nicht wirklich mein Begriff. Aber ich glaube, dass es ist richtig ist, sich wieder auf die Grundtugenden des Journalismus zu besinnen: dass man sorgfältig recherchiert, dass man seine Quelle belegt, dass man immer eine zweite Meinung einholt. Der schnelle, gemeine Journalismus ist für mich nicht die Zukunft. Journalisten sollten lieber mal einen Gang zurückschalten und noch einmal nachdenken, als schnell etwas rauszuhauen.
Haben Journalisten überhaupt noch Zeit zum Denken?
Pohl: Es ist sicher eine der größten Gefahren des Internets, dass wir uns nicht mehr die Zeit zum Denken nehmen. In der Medienszene herrscht eine unglaubliche Gehetztheit. Man muss ganz bewusst dagegenhalten. Es passiert noch etwas zwei Stunden vor Redaktionsschluss? Egal, dann machen wir halt nur eine Meldung. Wir bleiben bei unserem ausgeruhten Seite-Drei-Stück und machen die Geschichte morgen, vielleicht auch erst übermorgen, vielleicht erst in einer Woche. Da habe ich als Leserin tausend Mal mehr von, als wenn ich Dinge so zusammengeholzt in der Zeitung lese, die ich schon am Tag zuvor im Netz lesen konnte.
Görlach: Wir bringen eine Debatte auch lieber mal einen Tag später. Bei manchen Themen – etwa der Debatte um Gesine Lötzsch – weiß ich zwar, welche zwei, drei Autoren ich anrufen kann, die in der Lage sind, das Thema schnell richtig einzuordnen. Oft fragen diese aber auch: Reicht es, wenn ich Ihnen das morgen schicke? Und natürlich reicht das, weil ein durchdachter Text immer besser ist als ein Schnellschuss. Das war bei „The European“ von vorneherein der Ansatz. Es ist an sich ein Bruch mit der Web-Mentalität, es ist aber auch nicht leicht, weil einem das Thema womöglich schon in den Fingern juckt.
Bei Ihnen diskutieren auch Wissenschaftler und Intellektuelle politische Themen, nicht nur Journalisten. Stellen Journalisten noch die richtigen Fragen?
Görlach: Schauen Sie sich die Lötzsch-Debatte an. Im Web wird so etwas schnell rauf und runter diskutiert, und wenn man in der Redaktionskonferenz sitzt, haben das schon zehn andere kommentiert. Da ist es manchmal anstrengend, noch einen anderen Zugang zum Thema zu finden. Wir Journalisten haben auch bei Stuttgart 21 ganz lange die falschen Fragen gestellt. Ein Kollege von der „Zeit“ hat das neulich sehr gut dargestellt. Die Jungen wollen mehrheitlich diesen Durchgangsbahnhof, und die Älteren wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Umfragen hätten das nachgewiesen. Und da muss man drüber diskutieren. Es hat allerdings drei Monate gebraucht, bis jemand das mal aufgeschrieben hat.
Pohl: Stuttgart 21 ist ein gutes Beispiel. Es ist ja zunächst ein klassisches Regionalthema. Die Regionalzeitung hat aber erstmal gar keine Fragen gestellt, sondern sich alles eins zu eins von Mappus oder Oettinger oder Lothar Späth in die Kommentarspalten diktieren lassen. Die richtigen Fragen haben dann Kollegen von der „Süddeutschen“ und dem „Stern“ gestellt, die in den Archiven nachgesehen haben, wie damals die Verträge zustande kamen. Also, in weiten Teilen stellen die Journalisten nicht mehr die richtigen Fragen. Sie stellen viel zu wenig Fragen. Und dann beschäftigen sie sich eben damit, was Herr Guttenberg gerne frühstückt und wie das Tattoo von Frau Wulff aussieht.
Frau Pohl, Sie haben früher als Hauptstadtkorrespondentin gearbeitet. In Berlin laufen viele „Alphajournalisten“ herum. Die Leiter der Hauptstadtbüros sind meist Männer, Frauen die Ausnahme. Prägt das die Debatte?
Pohl: Ich glaube schon, dass Geschlechterverhältnisse auch etwas mit Inhalten zu tun haben. Da sind die Fragestellungen anders und vielleicht auch die Komplexität, die Dinge haben dürfen. Das ist jetzt natürlich stereotyp, aber ich denke, dass es unter Männern gerne mal etwas weniger komplex zugeht. Frauen sind unter sich auch so. Für den Journalismus besser wäre aber eine Mischung aus unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Ich finde es beschämend für die deutschen Medien, dass die „taz“ als einzige überregionale Zeitung eine weibliche Chefredakteurin hat. Wir schreiben das Jahr 2011!
Görlach: Ich habe das auch schon erlebt, wenn zehn, zwanzig Korrespondenten aufgereiht dasitzen. Das sind tatsächlich fast nur Männer, die dann alle auch ein bestimmtes Lebensalter haben. Die sind biographisch ähnlich, die tragen ähnliche Klamotten, die verdienen alle ähnlich. Denen gehts darum zu zeigen, dass sie das im Hintergrundgespräch Gesagte noch einen Tick besser verstanden haben als die anderen. Da spürt man oft so eine gewisse Herablassung, manchmal gepaart mit einem unscheinbaren Auftritt im ausgebeulten C&A-Anzug. Das ist so „old school“.
Pohl: Das gilt aber nicht nur für Männer, Frauen sind auch so. Doch was ist mit Menschen mit Migrationshintergrund? In der deutschen Medienlandschaft finden Sie nur vier Prozent Migranten. Das ist ja auch erbärmlich, das spiegelt überhaupt nicht die Gesellschaft.
Görlach: Allenfalls darf die Quoten-Muslima mal nach Mekka fahren.
Pohl: Aber dann darf sie auch nur über Kopftücher schreiben. Und wehe, wenn sie über Fußball oder eine Theateraufführung schreibt, die nichts mit Muslima oder sonst was zu tun haben.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe 7 Wahlen – wer gewinnt, wer verliert.. Das Heft können Sie hier bestellen.