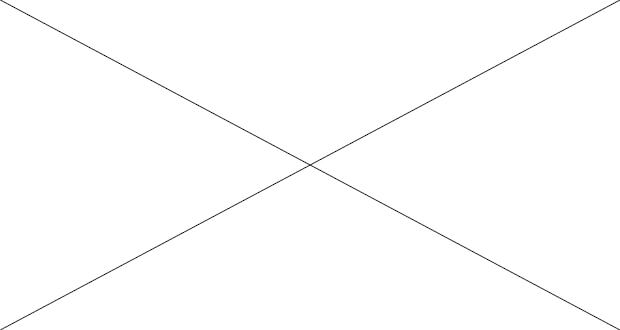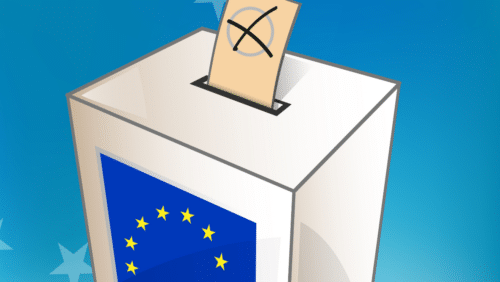p&k: Professor Green, hat Barack Obama mit seiner Präsidentschaftskampagne im vergangenen Jahr die Wählermobilisierung verändert?
Donald P. Green: Ich bin mir nicht sicher, ob er die Techniken der Wählermobilisierung wirklich verändert hat. Er hat jedoch viele bereits bestehende Annahmen bestätigt. Obamas Kampagne hatte zwei Vorteile: Sie verfügte über große finanzielle Reserven und viele freiwillige Helfer. Die Verbindung dieser zwei Faktoren sorgte dafür, dass Obama so viele Wähler mobilisieren konnte.
War der Ausgang der Wahl überraschend für Sie?
Nicht unbedingt. Es war aber spannend zu sehen, dass die Wahlbeteiligung, für amerikanische Verhältnisse, mit 56,8 Prozent am Ende noch höher war als angenommen. Im Vergleich zu 2004 haben neun Millionen Menschen mehr ihre Stimme abgegeben. Das lag zu einem großen Teil an Obamas Anhängern.
Im nächsten Jahr stehen in den USA Kongresswahlen an. Wird die Wahlbeteiligung dann wieder sinken?
Das glaube ich nicht. Durch unsere Studien haben wir herausgefunden, dass Bürger, die ihre Stimme einmal abgegeben haben, mit großer Wahrscheinlichkeit wieder zur Wahl gehen. Trotzdem wird die Wahlbeteiligung in den USA immer um die 60 Prozent liegen. Kein Vergleich zu europäischen Staaten.
Welche Rolle haben soziale Netzwerke wie Facebook, Myspace und Youtube bei der Wählermobilisierung gespielt?
Bei der vergangenen Wahl nur eine sehr kleine. Wenn ich mir das Ausmaß der gesamten Kampagne anschaue, dann waren diese Instrumente nur eine Art Nebenvorstellung. Trotzdem waren sie aus zweierlei Sicht wichtig für Obama. Zunächst haben Sie die Kosten für das Spendensammeln enorm gesenkt. In der Regel kostet es eine Kampagne sehr viel Geld, Spenden anzufragen. Obama konnte mit seiner Online-Strategie so viel Geld einsammeln, dass er nicht nur John McCain im Wahlkampf besiegte, sondern auch Hillary Clinton bei den Vorwahlen. Gleichzeitig gelang es Obama durch die sozialen Netzwerke, seine Anhänger zu bestimmten Zeitpunkten zu Diskussionen, Bürgerfesten und sonstigen Veranstaltungen zu lenken. Die Wahlhelfer bekamen so Hinweise, wo sie Plakate aufhängen und an welche Türen sie klopfen mussten.
Obama hatte mit my.barackobama.com ein eigenes Netzwerk aufgebaut, um seine Anhänger miteinander zu verbinden. Ein Erfolg versprechendes Modell für die Zukunft?
Auf jeden Fall. Ein solches Netzwerk kann die eigenen Anhänger noch stärker und vor allem schneller mobilisieren. Zwar kann ein Kandidat damit nicht unbedingt neue Wählergruppen erschließen, wohl aber die eigenen Unterstützer ansprechen und um Spenden bitten.
Ist John McCains Kampagne also an der technischen Überlegenheit der Obama-Kampagne gescheitert?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Beide Kandidaten hatten seit dem Beginn der Vorwahlen die gleichen Möglichkeiten, ihre technischen Instrumente auf- und auszubauen. Der größte Unterschied zwischen den beiden Politikern war, dass Obama bei den Kernwählern der Demokraten stärker akzeptiert war als McCain bei den Republikanern.
Im US-Wahlkampf machte sich auch die Webseite Moveon.org für Obama stark. Die Organisation verfügt über drei Millionen Anhänger, die sie mit einem Mausklick mobilisieren kann. Könnte es auch ein deutsches Moveon.org geben?
Eine Webseite wie Moveon.org kann auch außerhalb der USA Erfolg haben. In der Tat baut die Organisation auf deutschen Eigenschaften auf.
Inwiefern?
In Deutschland gibt es eine lange Tradition von politischen Clubs und Salons, die sich mit Parteien verbunden fühlten. In den USA war dies zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts auch so, starb dann aber aus. Als sich Moveon.org 1998 gründete, war das auch der Versuch, eine Art Nachbarschaftsnetzwerk aufzubauen. Damit wollten die Organisatoren die Politiker, die sich in der Regel mit nationalen Themen beschäftigen, auf ihre lokalen Probleme hinweisen. Moveon.org hat sich damit nicht nur zu einer wichtigen politischen, sondern auch sozialen Organisation entwickelt.
Die auch die schwache Bindung der US-Amerikaner an ihre Parteien ausgleicht?
Ja, zu einem großen Teil. In den USA sind vor allem langjährige Parteianhänger darüber frustriert, wie wenig Einfluss die Parteien haben, und wie schwach sie außerhalb der Wahlkampagnen auftreten.
Im vergangenen Jahr kam die zweite Auflage Ihres Buchs „Get out the vote“ heraus. Darin beschreiben Sie, wie wichtig Bürgerfeste am Wahltag für die Mobilisierung sind. Haben US-Politiker diesen Trend bereits erkannt?
Zurzeit spielen solche Feste noch keine größere Rolle. Was verwunderlich ist, denn das ist ein Trend, der nur darauf wartet, von Politikern und Parteien entdeckt zu werden. Sie könnten die Wähler vor der Wahl durch ein Fest an einem gemeinsamen Ort zusammenrufen und sie so noch einmal zur Wahl motivieren. Solche Veranstaltungen wären übrigens keine neue Erfindung, sondern eine Rückkehr zu alten Traditionen. Denn in den USA gab es solche Feste bereits im 19. Jahrhundert. Damals wurden die Wähler mit Aufführungen, Attraktionen und Whiskey zur Wahl gelockt.
Mit Whiskey?
Ja, damals gab es am Wahltag eine Menge Alkohol zu trinken. In der progressiven Ära, in der der Kongress viele soziale Reformen verabschiedete, wurde der Ausschank von Alkohol am Wahltag verboten und die Kabinen an ruhigeren Orten aufgestellt. In der heutigen Zeit müssen Politiker wieder den sozialen Charakter der Wahltage betonen und mehr auf Spaß setzen.
Solche Veranstaltungen könnten den festlichen Abschluss der beiden letzten Tage vor der Wahl bilden. Wann haben US-Politiker die enorme Bedeutung dieses Zeitraums entdeckt?
Vor ungefähr zehn Jahren. Aber erst seit dem Jahr 2000 versuchen die Parteien, die 48 Stunden vor der Wahl für die Wählermobilisierung zu nutzen.
Setzen sich solche Trends in einer digitalisierten Gesellschaft in Zukunft schneller durch?
Ja, davon bin ich überzeugt. Solche Innovationen können in der heutigen Zeit viel schneller die nationalen Grenzen überwinden als noch vor einigen Jahren.
In rund vier Wochen wählt Deutschland ein neues Parlament. Was sollten deutsche Politiker beachten, wenn es um die Schlussmobilisierung ihrer Wähler geht?
Ich weiß nicht genügend darüber, wie die deutschen Wähler auf den direkten Kontakt mit Wahlhelfern vor der Haustür reagieren. In den USA kommt es darauf an, mit einer möglichst großen Anzahl von gut ausgebildeten Unterstützer in die Stadtgebiete zu gehen, in denen der Kandidat oder die Partei die meisten potenzieller Wähler vermutet. Ziel muss es immer sein, die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Wahl zu steigern. Das ist in den USA besonders einfach, weil Parteien über ausführliche Wählerinformationen verfügen und einzelne Gebiete und Straßen genau einschätzen können.
Setzen die Parteien dabei nur auf die Informationen, die durch die Wählerregistrierungen verfügbar sind?
Natürlich greifen alle regulären Kandidaten auf diese Informationen zurück. Bei den Präsidentschaftskampagnen ist die Dimension des Wahlkampfs jedoch noch größer. Dort geben die Parteien umfangreiche Meinungsumfragen in Auftrag, um herauszufinden, wo sie auf die meisten Unterstützer setzen und wo sie durch eine Schlussmobilisierung noch Stimmen gewinnen können.
In Deutschland behindern gesetzliche Vorgaben einen solchen Wahlkampf.
Trotzdem können sich deutsche Politiker die Wahlergebnisse von der vergangenen Wahl noch einmal anschauen und überlegen, wo sie viele Unterstützer haben und wo sie die Bürger noch überzeugen müssen. Und die Parteien sollten darauf achten, während der Wahlkampagne Daten zu sammeln. Das könnte ausschlaggebend für die nächste Wahl sein.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Jetzt aber los! – Endspurt zur Bundestagswahl. Das Heft können Sie hier bestellen.