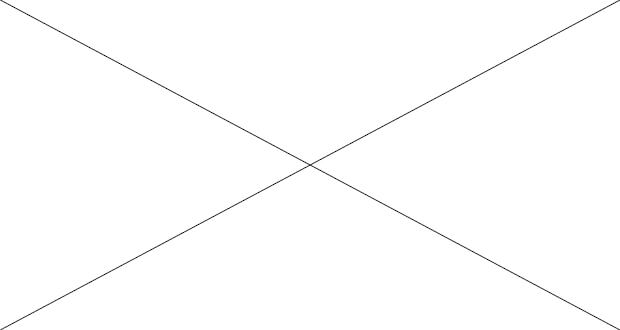p&k: Herr Köppel, in Griechenland gibt es Boykottaufrufe gegen Deutschland, und auch die Schweizer sind zurzeit nicht gut auf uns zu sprechen. Was machen wir falsch?
Hildegard Müller: Die Fälle Griechenland und Schweiz sind gar nicht miteinander zu vergleichen. Was in Griechenland abgeht, ist auch für die Schweizer ungeheuerlich. Da wird der Euro zum Instrument nationalistischer Ressentiments gemacht. Das gibt es in der Schweiz so nicht. Ich glaube, die Differenzen zwischen Deutschland und der Schweiz haben mit den Unterschieden in der Rechtsordnung zu tun. Die Deutschen wollen neue Regeln gegen Steuerhinterziehung, die Schweizer wollen ihre Regeln nicht ändern, darum geht es in dem Konflikt. Aber daraus auf eine generelle antideutsche Stimmung zu schließen, wäre übertrieben.
Es scheint, als würden die Schweizer die Deutschen als arrogant empfinden.
Zumindest die deutsche Schweiz fühlt sich immer speziell betroffen, wenn es um Deutschland geht. In der französischen und italienischen Schweiz ist das überhaupt kein Thema. Es gibt durchaus eine enorme Zuwanderung aus Deutschland in die deutschsprachige Schweiz, meistens in sehr gut qualifizierte Jobs. Mit der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ist einzelnen Schweizern jetzt der Gedanke gekommen, die Deutschen würden ihnen die Jobs wegnehmen. Das ist die Stimmungslage.
Die Töne, die Sie in der “Weltwoche” anschlagen, sind auch nicht immer zurückhaltend. Neulich haben Sie den Zuzug deutscher Arbeitskräfte in die Schweiz mit der DDR vor dem Mauerbau verglichen. War das nicht ein bisschen polemisch?
Überhaupt nicht. Man muss die Dinge beim Namen nennen. Meine Aufgabe ist es, Regierungen, auch die deutsche, kritisch zu beobachten. Dass ich daneben eine große Sympathie habe für Deutschland, wird in anderen Artikeln deutlich. Wir brachten eine “Hymne auf die Deutschen” aus Anlass von 60 Jahren Grundgesetz. Wir haben positive Worte für Frau Merkel gefunden, und ich habe zum Beispiel Herrn Steinbrück gelobt, als die Auseinandersetzung zwischen der Schweiz und Deutschland auf dem Siedepunkt war. Die Verdienste Deutschlands sind unbestritten, aber das Land muss sich doch fragen: Warum gibt es eine so hohe Schwarzmarktquote? Weshalb wandern so viele hervorragend qualifizierte Deutsche aus? Das Schweiz-Bashing bringt nichts. Die Regierung muss sich fragen, was sie unternehmen kann, um das Land wieder attraktiver zu machen. Immer mehr Steuerfahndung, immer mehr Kontrolle, das ist es nicht. Nur mit Repression und halbseidenen Datenkäufen zu reagieren, ist eine gefährliche Entwicklung.
In den vergangenen Jahren haben die Schweiz und die EU sich immer weiter angenähert. Ist der Steuerstreit ein Rückschlag auf diesem Weg?
Ein großer Teil des Schweizer Parlaments und der Verwaltung will in die EU. Auch die offiziellen Reaktionen der Regierung selbst waren im Fall der gestohlenen Bankdaten eher positiv. Man zeigte Verständnis für einen Ankauf. Die Bevölkerung hingegen war entsetzt und ist mehrheitlich für die Wahrung des Bankkundengeheimnisses – und sie ist nicht bereit, der EU beizutreten. Es gibt eine Kluft zwischen den politischen Eliten und einer soliden Bevölkerungsmehrheit.
Ist das Bankgeheimnis tatsächlich so konstitutiv für das Selbstverständnis der Schweizer?
Absolut. Denn das Bankgeheimnis wurde nicht für den Finanzplatz erfunden, genauso wenig wie das Ärztegeheimnis oder das Anwaltsgeheimnis von den Ärzten oder Anwälten erfunden wurde. Es ist ein Gesetz, das sich die Bürger selbst gegeben haben, um ihre Privatsphäre zu schützen. Man müsste hier eine Volksabstimmung durchführen, wenn man es abschaffen wollte.
Ist es in Anbetracht der politischen Kultur in der Schweiz überhaupt möglich, dass das Land eines Tages der EU beitritt?
Denkbar ist es. Die Schweizerinnen und Schweizer können alles an den Urnen entscheiden.
Aber wäre ihnen der riesige Apparat in Brüssel geheuer?
Da muss man erst die Frage stellen: Was ist die Schweiz? In Worten des deutschen Politologen Dolf Sternberger ist die Schweiz eine Ansammlung von Verfassungs-Patrioten. Was uns zusammenhält, ist unsere direktdemokratische Verfassung. Für die Schweizer ist diese eine Art gemeinsame DNS, und wenn sie durch einen möglichen EU-Beitritt in Frage gestellt wird, hat das eine ähnlich emotionale Aufregerkomponente, wie wenn ich in Deutschland den Sozialstaat in Frage stellen würde. Ich halte einen Beitritt derzeit für unwahrscheinlich.
Vielleicht könnte die direkte Demokratie der Schweiz ein Vorbild für Deutschland und die EU sein.
Die Vorteile direktdemokratischer Beteiligung sind etwas Großartiges – allerdings nicht für die politischen Eliten. Es ist unglaublich anstrengend: Wenn Sie in der Schweiz ins Parlament gewählt werden, können Sie nicht einfach vier Jahre unbehelligt regieren und sich sechs Wochen nach der Wahl von Ihren Wahlversprechen emanzipieren, wie es 2005 in Deutschland geschah, als die Mehrwertsteuer um drei Prozent erhöht wurde. In der Schweiz erinnert man die Politiker an ihre Wahlversprechen durch Referenden und Initiativen.
Sie haben als “Welt”-Chefredakteur über zwei Jahre in Deutschland gearbeitet. Was ist der größte Unterschied der politischen Kultur der beiden Länder?
Es gibt ein glänzendes Buch zur deutschen Geschichte namens „A mighty fortress“. Für den Autor Steven Ozment lautet die Leitfrage, warum der Begriff der Ordnung den Deutschen wichtiger ist als der Wert der individuellen Freiheit. Deutsche sind freiheitsliebend und, ähnlich wie die Schweizer, auch Föderalisten. Nur ist Deutschland ein großer Flächenstaat, der an der Hauptachse der Weltgeschichte liegt, während die Schweiz im Schutz der Berge ihre anarcho-demokratischen Strukturen erhalten konnte. Die Mentalität ist sehr ähnlich, aber die politische Geschichte ist aufgrund der geographischen Lage fundamental anders verlaufen. Für die Deutschen hat Sicherheit eine viel größere Bedeutung.
Gibt es Momente, in denen Sie sich nach Deutschland zurückwünschen – oder sind Sie eher froh, dass Sie wieder in der Schweiz sind?
Deutschland hat mir persönlich unglaublich gut gefallen. Ich war begeistert und habe eine ganz große Sympathie für die Deutschen. Das darf ich aber gar nicht erzählen, weil das ja fast schon unprofessionell für einen Journalisten ist, sich so romantisch einem Land zuzuneigen. Ich bin ein Schweiz-Fan, aber ich bin auch ein Deutschland-Fan.
Vor kurzem ist in der “Zeit” ein Porträt über Sie erschienen. Da hieß es: “Roger Köppel hat die ‘Weltwoche’ zur Speerspitze des Populismus gemacht, er spielt gezielt mit den Ängsten der Menschen.” Was sagen Sie dazu?
Das ist Unsinn. Populismus ist unseriös, da klingt Opportunismus und Windigkeit an. Das ist nicht mein Ansatz. Wir greifen ernsthafte Themen und Probleme auf, die verdrängt werden. Unser Motiv ist konstruktiv, die Sprache klar und deutlich. Was mich an der “Zeit”-Story irritierte: Der Autor, den ich sehr gut kenne und der auch bei der “Weltwoche” angestellt war, konfrontierte mich nicht einmal mit seinem Vorwurf (die Rede ist von Peer Teuwsen, Anmerkung der Redaktion). Offensichtlich will die “Zeit”, die auf dem Schweizer Markt Fuß fassen will, den Konkurrenten “Weltwoche” mit solchen unqualifizierten Anwürfen herabsetzen. Das ist nicht mein Stil.
Haben Sie damals Mitarbeiter von der “Welt” zur “Weltwoche” mitgenommen?
Nur ein paar, da die “Weltwoche” ein zu spezielles Profil hat. Beim Wechsel zur “Welt” hatte ich erwogen, ein paar Schweizer mitzunehmen, bin aber davon abgerückt. Man kann nicht mit einer Begleitarmee einmarschieren, wenn man ins Ausland geht. Ich wollte die Herausforderung alleine bestehen.
Wären deutsche Journalisten überhaupt integrierbar gewesen?
Ich habe einige Deutsche hier, und die haben keine Probleme. Übrigens sind Schweizer, die sich darüber beklagen, Deutsche würden ihnen Jobs wegnehmen, selbst schuld. Dann müssen sie sich mehr anstrengen. Wir Schweizer haben keine Rohstoffe, nur unser Hirn und unsere Arbeitskraft. Wir müssen eine Stunde früher aufstehen und eine Stunde länger arbeiten. Das ist das Geheimnis unseres Erfolgs.
Sie sind der lebende Beweis, da Sie angeblich jeden morgen um halb fünf aufstehen.
Ich versuche immer, zwischen vier und halb fünf aufzustehen, aber momentan bin ich nur noch bedingt Herr meines Stundenplans, weil ich seit kurzem einen kleinen Sohn habe und etwas übernächtigt bin. Da kann es sein, dass ich bis um viertel nach fünf schlafe und dann panisch aus dem Haus renne, weil ich den Eindruck habe, spät dran zu sein.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Nerven Sie nicht! – Der Knigge für den politischen Alltag. Das Heft können Sie hier bestellen.