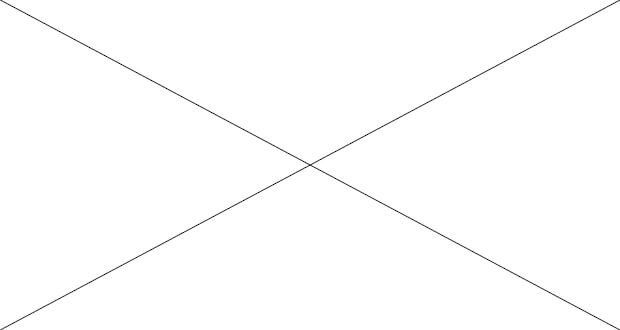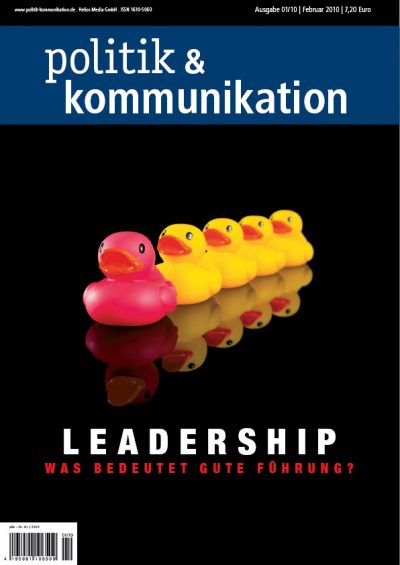p&k: Frau Myers, Sie haben sich bei Barack Obamas Wahlkampagne um die Finanzen gekümmert. Die Medien gaben Ihnen den Spitznamen „100-Millionen-Dollar-Frau“. Was mussten sie dafür tun?
Betsy Myers: Der Name hat einen einfachen Hintergrund: Als „Chief Operating Officer“ (COO) habe ich mich um das operative Geschäft und das Budget von „Obama for America“ gekümmert. Im Jahr 2007 haben wir insgesamt 103 Millionen US-Dollar eingenommen.
Was sagt diese Zahl über den US-amerikanischen Wahlkampf aus?
Vor allem, dass er sehr teuer geworden ist. Verglichen mit der Wahlkampagne von Bill Clinton im Jahr 1991 mussten wir bereits ein Jahr früher anfangen. Das liegt daran, dass die Vorwahlen sehr früh begannen. Clintons Kampagne verfügte 1991 nur über drei Millionen US-Dollar.
Wie hat die Obama-Kampagne das Geld eingesetzt?
Wir haben uns zunächst auf vier Staaten konzentriert: Iowa, New Hampshire, South Carolina und Nevada. Dort fanden 2008 die ersten Vorwahlen der Demokraten statt. Wir mussten uns dabei auf Iowa und New Hampshire konzentrieren. Wären wir dort auf einem der hinteren Plätze gelandet, wäre das Rennen bereits vorbei gewesen. Glücklicherweise gewannen wir Iowa. Für uns war das ein „Game Changer“: eine zukunftsweisende Wahl.
Wieviel Geld konnte die Kampagne insgesamt einsammeln?
Insgesamt rund 750 Millionen US-Dollar. Das ist eine einmalig hohe Summe. Sie verdeutlicht, in welche Richtung sich US-amerikanische Wahlkämpfe entwickeln werden. Wir sind jedoch stolz darauf, dass unsere Kampagne allein von Bürgern und ihren meist kleinen Spenden finanziert wurde. Von Unternehmen und Lobbyisten haben wir keine Spenden angenommen.
Wodurch unterschied sich die Kampagne von denen Ihrer Gegner?
Eines unserer Erfolgsgeheimnisse war das Ziel, die Kampagne wie ein Unternehmen zu führen. Wir wussten zu Beginn nicht, dass wir 100 Millionen US-Dollar einnehmen würden. Wir konnten zwar anhand der Quartalszahlen sehen, dass wir auf einem guten Weg waren; gleichzeitig bestand immer die Möglichkeit, dass die Kampagne nach den ersten Vorwahlen vorbei sein würde.
Was bedeutete das Ziel, die Kampagne wie ein Unternehmen zu führen, für Sie?
Als COO stellte ich Mitarbeiter ein, die in der Wirtschaft arbeiteten und nicht in der Politik. Es sollten vor allem keine Bürokraten sein. Denn für Obama war es genauso wichtig, dass die Kampagne flexibel und effektiv blieb.
Durch was zeichnete sich die Kampagne noch aus?
Für Obama war es wichtig, eine Kampagne zu betreiben, die auf Respekt aufbaut. Für ihn bedeutete das vor allem Respekt untereinander. Für mich bedeutete das: Kundenzufriedenheit. Der Umgang mit unseren Kunden, also den potenziellen Wählern, stand für mich von Beginn an ganz oben. Dazu gehörten der Umgang mit Bürgern, die in unsere Wahlbüros kamen, um sich zu informieren, sowie die Art, Telefonanrufe zu beantworten. Aber auch die Kommunikation unserer Zentrale mit den Büros in den einzelnen Bundesstaaten waren wichtig. Wir führten regelmäßige Telefonkonferenzen ein, an denen sowohl Mitarbeiter aus der Zentrale als auch den einzelnen Büros teilnahmen. Alle Probleme kamen dort auf den Tisch.
Obama entschied sich für seine Heimatstadt Chicago als Wahlkampfzentrale. Er sagte, dass das ein Schritt gegen die Lobbyisten in Washington sei.
Und er hatte Recht damit. Schauen Sie sich die Kampagne von Al Gore im Jahr 1999 an. Er fing in Washington an, wechselte dann aber in seine Heimat Tennessee. Obama konnte so nicht nur Chicago unterstützen, sondern auch der täglichen Gerüchteküche in Washington entgehen.
Und Sie sind auch nach Chicago gezogen?
Ja, 2007 bin ich nach Chicago gezogen. Im Laufe des Jahres teilte sich meine Rolle aber auf. Im Sommer wurde ich neben meiner Rolle als COO auch Vorsitzende der Frauengruppe in der Kampagne und am Ende des Jahres begann ich damit, durch die USA zu reisen. Mit den Büros in den einzelnen Staaten erarbeitete ich Strategien für den Wahlkampf; dabei ging es vor allem um unentschlossene Wählerinnen. Als diese Aufgabe am Ende immer mehr meiner Zeit beanspruchte, übergab ich meine Aufgaben als COO an meinen Stellvertreter. Erst ganz am Ende der Kampagne gab ich den Titel COO offiziell ab.
Wie oft haben Sie Ihre Familie während der Kampagne gesehen?
Das war der härteste Teil für mich. Am Anfang der Kampagne pendelte ich. Unter der Woche arbeitete ich in Chicago, freitags flog ich zu meiner Familie nach Boston. Im Sommer 2007 zogen mein Mann und meine Tochter zwar mit nach Chicago, jedoch musste ich zu diesem Zeitpunkt sehr viel reisen und war wieder von ihnen getrennt. Politische Kampagnen sind für Familien eine schwierige Angelegenheit. Nur wenige Personen aus dem engsten Kreis unserer Kampagne hatten Kinder.
Das heißt, nach Obamas Wahlsieg sind Sie aus Rücksicht auf Ihre Familie nicht mit ins Weiße Haus gegangen?
Nach zwei Jahren war mir klar, dass ich meiner Familie nicht mehr zumuten konnte. Ich arbeite gerne in der Politik – will aber immer auch die Freiheit haben, aussteigen zu können.
Obama ist nun seit knapp über einem Jahr Präsident. Geändert hat sich vor allem der Führungsstil im Weißen Haus: Der Präsident bemüht sich, zuzuhören und zu lernen. Ist das eine neue Art Politik, zu machen?
Dieser neue Stil zeigt sich nicht nur in Washington D.C., sondern auf der ganzen Welt. Die Zeiten haben sich verändert: Nur noch kommandieren und kontrollieren reicht mittlerweile nicht mehr. Es kommt darauf an, zuzuhören, authentisch zu sein und sich den Urteilen anderer zu befassen. All diese Eigenschaften werden zurzeit als Politikstil einer neuen Ära bezeichnet. Interessanterweise sind all das Eigenschaften, die wir eher Frauen zuordnen. In der Politik – aber auch in der Wirtschaft.
Trotzdem ist der Führungsstil des Präsidenten umstritten. Er sei zu zögerlich, sagen seine Kritiker.
Wenn die Öffentlichkeit oder die Medien seinen Führungsstil bemängeln, vergessen sie, dass es unmöglich ist, einen US-Präsidenten im Weißen Haus zu haben, der zuhört und abwägt, gleichzeitig aber leidenschaftlich ist und nach vorne stürmt. Obama übernahm die Geschäfte von einer Regierung, die das Land in einem desaströsen Zustand hinterlassen hat. Viele Probleme, beispielsweise die Wirtschaftskrise, die beiden Kriege in Afghanistan und im Irak sowie die Gesundheitsrefom, ging er direkt an – und wurde dafür kritisiert. In den USA kommt es oft vor, dass ein Präsident im ersten Amtsjahr einige Niederlagen einstecken muss. Das war bei Bill Clinton nicht anders.
Wodurch unterscheidet sich Obama von seinem Vorgänger Clinton?
Bill Clinton ist ein großer Charismatiker und einer der besten Menschenfischer weltweit. Er mag die Menschen und baut schnell eine Verbindung zu ihnen auf. Das lieben die Amerikaner an ihm, und deshalb konnte er auch die Monica-Lewinsky-Affäre überstehen. Die Menschen haben gefühlt, dass er ein guter Mensch war, der seine Aufgabe mit viel Leidenschaft ausübte. Während meiner Zeit im Weißen Haus scherzten die Mitarbeiter, dass Clinton den Zaun, hinter dem die Menschen bei Auftritten warteten, zweimal abschritt, weil er den Kontakt so gerne hatte.
Obama wirkt bei seinen Auftritten zurückhaltender.
Das entspricht seinem Naturell. Aber Obama ist nicht scheu, auch er geht gerne auf Menschen zu. Nur mit dieser Einstellung ist es überhaupt möglich, US-Präsident zu werden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Leadership – Was bedeutet gute Führung?. Das Heft können Sie hier bestellen.