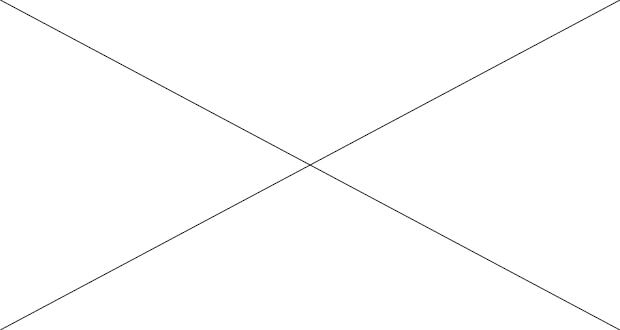Sprache ist Macht. Wie sehr das in der Politik gilt, musste Ende Oktober ein Mann erfahren, der eigentlich die Aufgabe hat, Deutschland ein positives Bild der schwarz-gelben Koalition zu verkaufen: Regierungssprecher Steffen Seibert. Der ehemalige ZDF-Journalist, erst seit Mitte August im Amt, stand im Zentrum eines Sprach-Konflikts: In der Bundespressekonferenz hatte Seibert über die geplante Neuordnung des EU-Stabilitätspakts gesprochen und erklärt, dass die Regierung den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel unterstütze. Kurz darauf musste sich Seibert dafür vor Außenminister Guido Westerwelle telefonisch rechtfertigen. Der Grund: Der Regierungssprecher hatte einen kritischen Westerwelle-Kommentar über Merkels Kurs verschwiegen – was den FDP-Chef erzürnte. Die Medien sprachen von einer Entschuldigung Seiberts, dieser verneinte. Es tue ihm „leid“, von „Schuld“ könne keine Rede sein.
Wenige Tage später erklärte Vize-Regierungssprecherin Sabine Heimbach die Irritationen zwischen ihrem Vorgesetzten und dem FDP-Chef für ausgeräumt. Schuld seien unklare Fragen an Seibert gewesen. Sprachliches Missverständnis oder nicht: Für Merkels Chefkommunikator eine unangenehme Lektion in Sachen Machtmittel Sprache. Dass aus der politischen Petitesse ein Thema für die Medien wurde, mag damit zusammenhängen, dass Seibert noch keine 100 Tage Chef des Bundespresseamts ist. Trotzdem war es im Berliner Politikbetrieb eine ungewöhnliche Ausnahme. Im Bundestag, in den Ministerien und in den Parteizentralen legen die Akteure jede Formulierung auf die Goldwaage. Für die Politiker bedeutet das Sicherheit – für die Bürger jedoch oft Langeweile.
Den Vorhang weggerissen
„Die Politikersprache in Deutschland ist wie ein Kieselstein: ohne Ecken und Kanten“, sagt Josef Klein, der am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin Politolinguistik lehrt und sich seit vielen Jahren mit dem Einfluss von Sprache in der Politik beschäftigt. Als Grund für die wenig elektrisierende Sprache sieht Klein das auf Kompromisse angelegte Staatssystem der Bundesrepublik. „Politiker versuchen Widerspruch zu vermeiden, weil sie potenzielle Wähler nicht provozieren wollen“, sagt er. Für Klein, der in den 70er Jahren selbst für die CDU im Bundestag saß, ist es deshalb nicht überraschend, dass der ehemalige Bundesbanker Thilo Sarrazin mit seinen Kommentaren über die Integrationspolitik tagelang die Nachrichten bestimmen konnte: „Sarrazin hat einen Vorhang weggerissen. Er hat das Tabu der Eliten gebrochen, über problematische Seiten der Zuwanderung öffentlich laut zu reden.“ Seit dieser Zeit nähmen auch Minister Begriffe wie „Integrationsverweigerer“ und „Deutschenfeindlichkeit“ in den Mund. Im Fall Sarrazin spricht Klein von einem Deutungsrahmen, den der Politiker verschieben konnte; „Frame“ lautet der englische Begrif dafür. Mit diesem Rahmen meint Klein – vereinfacht ausgedrückt – gesellschaftliches Wissen. Viele Informationen über ein Thema, Umwelt oder Familie beispielsweise, verleihen diesem in der alltäglichen Kommunikation erst ihren Sinn. Für Politiker kommt es darauf an, diese Rahmen zu beeinflussen, sie durch ihre Sprache zu „aktivieren“.
„Unterschiedliche Wert- und Sinnzusammenhänge definieren gewissermaßen das Spielfeld der Politik. Politische Akteure müssen diese in ihrer Kommunikation, ihrer Sprache, berücksichtigen und die eigenen Vorhaben wieder stärker mit Bezug auf diese Wertesysteme kommunizieren“, sagt Leonard Novy. Der Publizist und Fellow bei der Stiftung Neue Verantwortung setzt sich mit der Bedeutung von Sprache in der Politik auseinander. Wichtig für einen Redner sei jedoch, die Werte der Zuhörer nicht nur zu kennen, sondern die Debatte auch zu „framen“, sie also mit sprachlichen Mitteln wie Metaphern und Bildern zu prägen. Novy sagt, dass sich langsam auch in Deutschland die Framing-Strategie durchsetze, die maßgeblich durch den US-amerikanischen Linguistik-Professor George Lakoff (siehe Interview Seite 20) populär wurde: „Die Politik öffnet sich und sieht ein, dass sie ihre Gesetze lange Zeit vor allem technokratisch begründet hat, Politik nur als Vollzug sachlogischer Gegebenheiten verstanden hat.“ Die „Agenda 2010“ des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der damit die Sozialsysteme reformieren wollte, sei exemplarisch. „Die Agenda-Sprache hat nicht funktioniert. Schröder und sein Kabinett hatten vergessen, die Wertvorstellungen der Betroffenen zu berücksichtigen.“ So sagte Schröder in seiner „Agenda-Rede“ im März 2003 im Bundestag: „Entweder wir modernisieren, oder wir werden modernisiert.“ Mit dieser angedrohten Unvermeidlichkeit schreckte der damalige Bundeskanzler viele SPD-Anhänger ab.
Das Volk liebt klare Sprache
Zwei Mitglieder des Kabinetts demonstrieren täglich, wie groß die Rolle der emotionalen Ansprache geworden ist: Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und Arbeitsministerin Ursula von der Leyen sind Politiker, die wissen, dass ein großer Teil ihres politischen Erfolgs auf ihre direkte Ansprache der Bürger zurückzuführen ist. Beide sind rhetorisch geschickt, einfühlsam und intelligent – und doch scheiterte einer zuletzt mit dem Versuch, mit sprachlichen Mitteln politisch erfolgreich zu sein.
Polit-Star zu Guttenberg hat sich nach der Bundestagswahl getraut, das auszusprechen, was sein Amtsvorgänger Franz Josef Jung noch vermieden hatte. Im Zusammenhang mit dem Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan wandte sich zu Guttenberg gegen beschönigende Bezeichnungen wie „Stabilisierungseinsatz“, sprach zunächst von „kriegsähnlichen Zuständen“ und wenige Monate später dann von „Krieg“. Zwar fügte zu Guttenberg stets an, dass das „umgangssprachlich“ gelte, für die Berichterstattung spielte das jedoch eine untergeordnete Rolle. In der Truppe und beim Volk kam Guttenbergs Wortwahl gut an – in den Umfragen stieg der CSU-Mann zu Deutschlands beliebtestem Politiker auf.
Für Vazrik Bazil, Präsident des Verbands der Redenschreiber deutscher Sprache, hat zu Guttenberg mit seiner Wortwahl vor allem eines bewiesen: Mut. Denn es sei eine komplizierte Aufgabe gewesen, das Wort Krieg durchzusetzen. „Der Begriff hat in Deutschland eine schwierige Vergangenheit“, sagt Bazil. Zu Guttenberg habe jedoch gespürt, dass bei der Afghanistan-Mission der Bundeswehr der öffentliche Druck groß war. „Die Angehörigen, aber auch die Bevölkerung ganz allgemein, wollten Klarheit. Sie wollten, dass die Politik die Dinge beim Namen nennt.“ Der Verteidigungsminister hat das geschafft, was in der Sprachwissenschaft mit „Begriffe besetzen“ gemeint ist. Zu Guttenberg und seine Berater wussten um die Stimmung im Volk und entschieden sich dafür, den Einsatz in Afghanistan neu zu definieren. Doch wo sich der CSU-Politiker durchsetzen konnte, scheiterte Ursula von der Leyen.
Der Taxifahrer aus dem Iran
Mitte September arbeitete das Arbeits- und Sozialministeriun an einer Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze. Es fiel auf, dass von der Leyen in der Öffentlichkeit regelmäßig das Wort „Basisgeld“ benutzte und das als negativ besetzt geltende „Hartz IV“ mied. Viele Journalisten berichteten darüber und hakten im Ministerium nach. Dort erklärte ein Sprecher, dass es bei der Neuberechnung auch sprachliche Änderungen geben sollte. Ziel sei es, die Regelungen für die Bürger verständlicher zu machen. Wenige Tage später stoppte das Bundeskanzleramt von der Leyens Sprach-Plan: Das Basisgeld war damit gescheitert. Für von der Leyen eine seltene Niederlage. Die Niedersächsin ist geübt im Umgang mit Sprache. Bei Pressekonferenzen und in Diskussionsrunden glänzt sie durch druckreif formulierte Sätze. Spricht sie über die sozialen Zustände in Deutschland, beginnt von der Leyen ihre Sätze oft mit eindringlichen Geschichten – das „warme Mittagessen“ für Kinder aus Hartz-IV-Familien ist so ein Begriff, den die Politikerin besonders gern benutzt. Mit diesem „Storytelling“ erreicht sie ihre Zuhörer auf einer emotionalen Ebene. Doch trotz aller rhetorischen Fähigkeiten scheiterte Gefühlsministerin von der Leyen mit dem Basisgeld. Warum? Weil das Storytelling in Deutschland tatsächlich eher schadet, wenn den schönen Worten keine Taten folgen? Das zumindest sagt der Kommunikationswissenschaftler Alexander Ross, der sich für p&k die politischen Geschichtenerzähler in Deutschland genauer angeschaut hat.
„Von der Leyens Versuch, das ‚Basisgeld‘ im Sprachgebrauch zu etablieren, war vergebene Liebesmüh“, sagt Josef Klein. Die CDU-Politikerin habe einen negativ besetzten Ausdruck lediglich durch einen Euphemismus ersetzen wollen. „Der Begriff ist blass, der Inhalt der alte. Das hat die Bevölkerung mitbekommen.“ Der Politologe erklärt, dass bei zu Guttenberg das Gegenteil der Fall war. Dieser habe den Euphemismus „Stabilisierungseinsatz“ gegen den Begriff „Krieg“ eingetauscht, der dem Empfinden der Bevölkerung entsprach. Mit dieser Offenheit konnte der Verteidigungsminister die Deutschen für seinen Paradigmen-Wechsel gewinnen.
Einer, der die Sprach-Tricks der Politiker bis vor kurzem als Journalist und Autor aufgedeckt hat, ist mittlerweile dafür zuständig, sich eben solche Tricks auszudenken. Robin Mishra, ehemaliger Leiter des Hauptstadtbüros des „Rheinischen Merkurs“, ist seit Juni Pressesprecher von Bundesbildungsministerin Annette Schavan. „Als ausgebildeter Journalist schaue ich natürlich, welche Begriffe zu dem passen, was wir als Pressestelle wirklich anzubieten haben.“ Trotzdem: Schönreden wolle er nichts. Dafür lieber plastisch erzählen. Als Beispiel nennt er die Diskussion um die zügigere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland. „Bei so einem Thema bietet es sich an, an Geschichten anzuknüpfen, die jeder aus persönlicher Erfahrung kennt: beispielsweise den Taxifahrer aus dem Iran, der ein Ingenieurs-Diplom hat.“ So könne sein Ministerium verdeutlichen, dass es um rund 300.000 Menschen gehe. „Die Politik mit dem Alltag verbinden: Darum geht es im Kern“, sagt Mishra.
Lächerliche Werbesprache
Regelmäßig sitzt der Ministeriumssprecher mit seinen Mitarbeitern zusammen, um sich knackige Begriffe für verklausulierte Gesetzesvorhaben auszudenken. „Natürlich ist das nicht meine Hauptaufgabe, aber es gehört zu meiner Arbeit dazu.“ Haben Mishra und sein Team einen solchen Begriff gefunden, geht es darum, ihn in der Öffentlichkeit zu verankern. „Es ist erstaunlich, wie oft Politiker etwas wiederholen müssen, bis es tatsächlich im Kopf der Zuhörer angekommen ist.“ Mishra warnt jedoch davor, sich dabei auf Werbebegriffe zu verlassen. „Pressearbeit ist etwas anderes als PR-Arbeit“, sagt er – und fügt an: „Die Politik kann sich mit Werbesprache auch unglaubwürdig machen.“ Die „Ich-AG“, mit der die rot-grüne Regierung vor acht Jahren für eine neue Form der Selbstständigkeit mit Sozialversicherungsschutz warb, war so ein schiefes Bild, das bei vielen Deutschen Kopfschütteln auslöste. Gleiches galt für die Diskussionen um die schwarz-gelbe Gesundheitsreform. Bürgerversicherung, Kopfpauschale, Gesundheitsprämie: Nach der Bundestagswahl gingen CDU und FDP sowie SPD und Grüne mit jeweils eigenen Begriffen in die Öffentlichkeit und versuchten so, die Bürger für ihr Modell zu gewinnen. Für Josef Klein der falsche Weg: „Im Kampf um mediale Aufmerksamkeit setzen Politiker oft auf Schlagworte.“ Dabei besonders beliebt: negative Begriffe. Klein nennt als Beispiel die „spätrömische Dekadenz“, mit der FDP-Chef Guido Westerwelle Anfang des Jahres einen Sturm der Entrüstung entfesselte. „Eine schlechte Wahl“, sagt er. „Das war ein inakzeptabler Deutungsrahmen für das Hartz-IV-Problem.“
Westerwelle scheiterte mit dem Versuch, die Bürger mit seinem rhetorischen Geschick für sich zu gewinnen. Für den FDP-Chef sollte es der Auftakt zu einem beispiellosen Absturz in den Popularitätswerten sein – der bis heute anhält. Vielleicht ist Zoff mit dem Regierungssprecher jetzt die falsche Taktik.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Wie die Botschaft ankommt – Politik und Sprache. Das Heft können Sie hier bestellen.