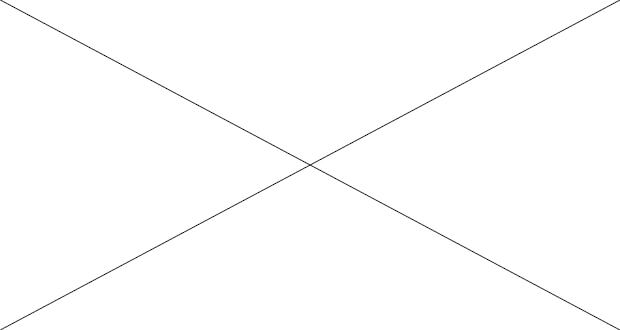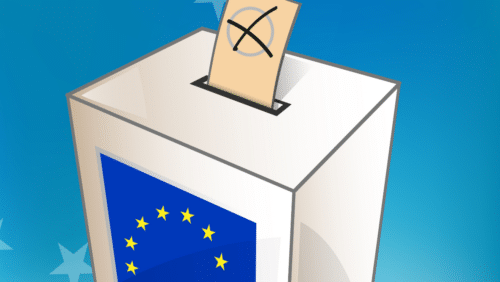Den amerikanischen Traum verteidigen – um nichts weniger geht es Anfang November in Washington DC. Zum fünften Mal hat die konservative Stiftung „Americans for Prosperity“ (AFP) zu ihrer jährlichen Konferenz „Defending the American Dream“ eingeladen. Thematischer Schwerpunkt: die „Schuldenpolitik von Barack Obama“. Ganz vorne im Washington Convention Center sitzt AFP-Gründer David Koch. Entspannt und gut gelaunt hört der schwerreiche Industrielle den Rednern zu. Direkt vor dem Kongresszentrum ist von der gelassenen Stimmung nichts zu spüren. Anhänger der „Occupy“-Bewegung demonstrieren lautstark gegen Koch. Ihr Vorwurf: Als Geldgeber der populistischen Tea-Party-Bewegung verhinderten David und sein Bruder Charles jeglichen politischen Fortschritt in der US-Hauptstadt. Als die Konferenz endet, bricht David Koch auf. Das Kongresszentrum verlässt er jedoch nicht durch einen Seiteneingang, er wählt den Haupteingang. Der 71-Jährige geht direkt an den Protestierenden vorbei, die wenige Minuten zuvor seinen Namen gerufen haben. Koch bleibt unerkannt. Die vom Wirtschaftsmagazin „Forbes“ überlieferte Begebenheit beweist: Längst sind David und sein fünf Jahre älterer Bruder Charles zu mächtigen Gegenspielern Obamas geworden – vor den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit konnten sich die Kochs jedoch lange Zeit verstecken.
Kerngeschäft Öl
Den Kampf gegen die Politik des US-Präsidenten finanzieren die beiden Brüder mit ihrem milliardenschweren Familienunternehmen Koch Industries. Dieses sitzt in Wichita, im US-Bundesstaat Kansas, und erwirtschaftet im Jahr rund 100 Milliarden US-Dollar – mehr als das Software-Unternehmen Microsoft und der Internetriese Google zusammen. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen – Charles fungiert als Vorstandsvorsitzender, David als sein Stellvertreter – rund 70.000 Mitarbeiter in 60 Ländern. Zu den hergestellten Produkten gehören unter anderem Kunstfasern, Kaffeebecher und Küchenrollen. Das Kerngeschäft ist jedoch: Öl. Die Koch-Brüder besitzen Pipelines, die quer durch die USA und Kanada verlaufen, und verfügen über zahlreiche Öl-Raffinerien. Eine profitable Mischung: Mittlerweile ist Koch-Industries der zweitgrößte private Konzern der USA. David Koch bezeichnete ihn selbst einmal als „das größte Unternehmen, von dem Sie noch nie etwas gehört haben“. Laut „Forbes“ können die Brüder auf ein privates Vermögen von je rund 25 Milliarden US-Dollar zurückgreifen. Auf der von dem Wirtschaftsmagazin jährlich erstellten Liste der reichsten Amerikaner teilen sie sich den vierten Platz.
Die Kochs sind klassische Libertäre – sie fordern drastisch reduzierte Steuersätze, minimale Sozialleistungen und vor allem: keine staatlichen Auflagen. Mit allen Mitteln wollen sie ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staats schützen. „Ihre Weltanschauung passt mit ihren wirtschaftlichen Interessen zusammen“, sagt Christoph von Marschall, der sich als US-Korrespondent des Berliner „Tagesspiegels“ regelmäßig mit den Koch-Brüdern beschäftigt. „So setzen sie sich als Öl-Produzenten beispielsweise für weniger staatliche Umweltrichtlinien ein.“ Zwar stellt Koch-Industries auf seiner Webseite zahlreiche Projekte vor, mit denen sie Abgase vermeiden und Energie sparen, viele Amerikaner wollen dem Unternehmen sein „grünes Gewissen“ aber nicht abkaufen. Für die Umweltschutzorganisation Greenpeace verfolgt die Firma schlicht eine „zerstörerische Agenda“. Auch aus der Wissenschaft kommt Kritik: In einer im Frühjahr 2010 veröffentlichten Studie führt die Universität von Massachusetts Koch Industries als einen der zehn größten Umweltsünder der USA auf. Kein Wunder, dass der 2009 mit ehrgeizigen umwelt- und sozialpolitischen Zielen gestartete Präsident Obama schnell zum Feindbild der Koch-Brüder wurde. „Es gibt niemanden in den USA, der so viel Geld für politische Zwecke gespendet hat wie die Koch-Brüder“, zitiert das Magazin „The New Yorker“ im August vergangenen Jahres Charles Lewis, den Gründer der Journalistenorganisation Center for Public Integrity. „Sie brechen systematisch das Gesetz. Sie manipulieren und verwischen ihre Spuren. So etwas habe ich in Washington noch nicht erlebt.“
Die „Tea Party“ als Machtmittel
Die Kochs setzen ihr Geld ein, um politischen Einfluss zu erlangen. Zwei Organisationen spielen dabei die Hauptrolle: AFP und Freedom Works (FW). Beide gingen 2004 aus dem Think-Tank „Citizens for a Sound Economy“, auf Deutsch: „Bürger für eine starke Wirtschaft“, hervor, den die Koch-Brüder Mitte der 80er Jahre gegründet hatten. AFP und FW setzen sich als vermeintliche Graswurzelbewegungen für niedrigere Steuern und reduzierte Staatsausgaben ein. Klassische Koch-Ziele. Während der Präsidentschaft des Republikaners George W. Bush hielten sich AFP und FW mit öffentlichen Kampagnen zurück. Bushs politische Agenda war maßgeblich von den Ideen erzkonservativer Berater geprägt – es gab keinen Grund, gegen die Politik des Präsidenten zu demonstrieren. Mit Obamas Einzug ins Weiße Haus änderte sich das. Inmitten der Finanzkrise kündigte der Demokrat an, die kollabierende US-Wirtschaft mit Staatshilfen zu retten. Dazu kam sein im Wahlkampf geäußertes Ziel, eine staatliche Gesundheitsvorsorge einzuführen. Für die Aktivisten der Tea-Party-Bewegung waren das die maßgeblichen Gründe für ihre Proteste. AFP und FW unterstützten die „Tea Party“ finanziell und organisatorisch. Mit Erfolg: Bei der Kongresswahl 2010 konnten die Republikaner – dank der Hilfe der Tea-Party-Aktivisten – das Repräsentantenhaus zurückerobern.
„Das Problem mit dem Libertarismus in den USA war lange Zeit, dass er zwar viele Anhänger hatte, es aber keine wirkliche Bewegung gab“, sagte der Historiker Bruce Bartlett einmal über die politischen Beweggründe der Koch-Brüder. Mit der „Tea Party“ habe sich das geändert. Bartlett: „Die Brüder wollen die populistische Bewegung kontrollieren. So versuchen sie, unbemerkt ihre eigenen Ziele durchzusetzen.“ Der linke Blog „Think Progress“ bezeichnete die Kochs jüngst als „die Milliardäre hinter dem Hass“.
So sehr das liberale Amerika mit den beiden Industriellen auf Kriegsfuß steht: Auch die Demokraten bauen auf einen Milliardär, der die Partei finanziell unterstützt: den Investor George Soros. Mit seinem Open-Society-Institut hat der 81-Jährige zahlreiche demokratische Kampagnen unterstützt – 2008 auch die des damaligen Präsidentschaftskandidaten Obama. Doch im Gegensatz zu den Koch-Brüdern unterstützt Soros zivilgesellschaftliche Projekte. Er setzt sein Geld nicht dafür ein, den eigenen Reichtum politisch abzusichern. Die Kochs machen das – und vertrauen dabei nicht nur auf AFP und FW.
1977 war Charles Koch einer von drei Gründern des konservativen Cato Instituts, heute einer der einflussreichsten Think-Tanks der USA. Laut dem Center for Public Integrity haben die Koch-Brüder der Denkfabrik alleine in den 80er und 90er Jahren rund elf Millionen US-Dollar gespendet. Cato verfasst Studien, die zahlreiche Zeitungen, TV-Sender und Webseiten weiterverbreiten. Kernthemen des Think-Tanks laut eigener Webseite: „Freiheit, schmaler Staat und freie Wirtschaftsmärkte“. Auch die Umweltpolitik gehört zu den Kernthemen der libertären Denkfabrik: 2008 schaltete Cato eine ganzseitige Anzeige in der „New York Times“, in der das Institut erklärte, warum Obamas These der wissenschaftlich belegbaren Erderwärmung falsch sei. Die ideologisch aufgeladenen und mit einem wissenschaftlichen Gütesiegel versehenen Studien beeinflussen längst die öffentliche Meinung.
Ein gekaufter Präsident?
Zurzeit sorgen die republikanischen Präsidentschaftskandidaten dafür, dass politische Schlagwörter wie Steuererleichterungen und Ausgabenkürzungen in politischen Diskussionen auftauchen. So zum Beispiel bei den von Millionen US-Amerikanern verfolgten TV-Debatten der Partei – oder jener AFP-Konferenz Anfang November in Washington. Als prominenten Redner konnte die Organisation unter anderem den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney gewinnen. Artig bedankte er sich bei David Koch für die Einladung: „Vielen Dank für all das, was Sie und AFP tun.“ Bei so viel demonstrativer Nähe fragen sich viele Amerikaner: Entscheiden am Ende gar die beiden Koch-Brüder mit ihrem Milliardenvermögen, wer ins Weiße Haus einzieht?
„Das glaube ich nicht“, sagt Christoph von Marschall. Natürlich, Geld sei wichtig. Anzeigen und TV-Werbung in den einzelnen Bundesstaaten zu schalten, sei nun mal kostspielig. „Aber“, fügt von Marschall an, „Geld ist nicht alles.“ Am Ende zähle der Kandidat. Dieser müsse glaubwürdig sein, für etwas stehen – und die Parteibasis begeistern. Ein solcher Kandidat fehle den Republikanern. Von Marschall ist sich sicher: „Das Geld der Koch-Brüder ist hilfreich. Aber selbst sie können mit noch so viel Geld nicht einen Politiker ins Weiße Haus bringen, den die Wähler nicht wollen.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Kretschmann – Politiker des Jahres. Das Heft können Sie hier bestellen.