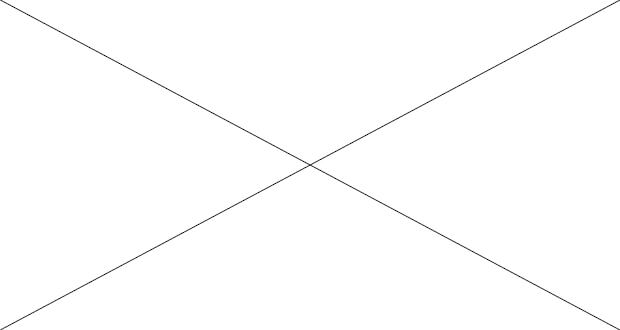Dieser 5. Mai ist ein besonderer Tag für Peter Krause. Der CDU-Politiker hat soeben den Bund fürs Leben geschlossen und schreitet, seine Braut im Arm, aus dem Weimarer Rathaus. Die Hochzeitsgäste werfen Reis auf das Paar. Auch Kjell Eberhardt, Staatssekretär im Thüringer Kultusministerium, ist da, um seinem designierten Chef zu gratulieren. Krause soll drei Tage später als neuer Thüringer Kultusminister vereidigt werden.
Doch dazu kam es nicht. Denn der 5. Mai ist auch der Tag, an dem Peter Krause lernt, was ein Politiker, der in Deutschland Karriere machen will, darf – und was eben nicht. Der promovierte Literaturwissenschaftler hatte 1998 vier Monate lang für die rechtslastige Wochenzeitung „Junge Freiheit“ als Redakteur gearbeitet und auch später noch für ähnliche Blätter geschrieben.
Nicht selten nutzen Politiker Tabubrüche, um sich gezielt über die Medien ins Gespräch zu bringen. Nachdem Dieter Althaus ihn als designierten Kultusminister vorgeschlagen hatte, produzierte Krause jedoch eineinhalb Wochen lang unfreiwillig Schlagzeilen. Krause sei jemand, der „zwischen Ultrakonservatismus und beginnendem Neofaschismus immer hin und her schwankt“, sagte etwa Bodo Ramelow, Spitzenkandidat der Linkspartei für die Landtagswahl 2009.
Empörung garantiert
In einer ersten Reaktion bezeichnete Krause die „Junge Freiheit“ als „anerkanntes Medium der deutschen Presselandschaft“. Dazu war – ohne sein Wissen und Zutun – eine seiner Rezensionen 2001 in der rechtskonservativen Zeitschrift „Etappe“ neben einer lateinischen Version des „Horst-Wessel-Liedes“, dem Kampflied der NSDAP, erschienen. Da Krause in so einem Umfeld publiziert hatte, konnte er nicht Thüringer Kultusminister werden. Zumal er gleichzeitig den Vorsitz im Stiftungsrat der KZ-Gedenkstätte Buchenwald übernommen hätte.
Am Ende gab Krause entnervt auf. Noch am Tag seiner Hochzeit ließ er eine Verzichtserklärung veröffentlichen: Er sehe keine Möglichkeit mehr, das sensible Amt in angemessener Sachlichkeit ausüben zu können, heißt es darin.
Der Fall Krause ist paradigmatisch für eine Empörungskultur in Deutschland, die im Namen der politischen Korrektheit beständig Opfer fordert – und häufig die Falschen trifft. Allzu oft ist der Vorwurf der sprachlichen oder geistigen Nähe zum Nationalsozialismus nur ein Mittel der Selbstvergewisserung. Eva Herman lässt grüßen. In der Politik ist der Nazi-Vorwurf tödlich.
Der Fall Krause, schreibt die „Neue Zürcher Zeitung“, zeige den „desolaten Zustand der öffentlichen Kommunikation in Deutschland, wenn es um die Verschränkung von Gegenwart und NS-Vergangenheit geht“. Schuld daran sei, sekundiert die „FAZ“, eine „Diktatur der Anständigen“, ein „linkes Empörertum“, das „politische Gegner gerne mundtot“ mache. In der Debatte hätten „Reflexe statt Reflexionen“ regiert, sagt Krause selbst. Er werde jedenfalls weiter „politisch unverkrampft“ agieren: „Ich bin nicht der Typ, der sich der Political Correctness beugt.“
Man kann Peter Krause einiges vorwerfen: Dass ein Demokrat nicht für eine Zeitung arbeiten darf, die ein Scharnier zwischen Konservatismus und rechtsextremen Spektrum bildet. Dass er sich nicht frühzeitig eindeutig davon distanziert hat. Dass er naiv war, starrsinnig vielleicht mitunter. Aber ein Neofaschist ist der konservative Intellektuelle sicher nicht. In seiner Heimatstadt Weimar ist Krause quer durch alle politischen Lager geschätzt. Auch konnten ihm keinerlei rechtsextreme Äußerungen nachgewiesen werden.
Dennoch geriet der Politiker in eine Schublade mit rechten Demagogen, die sich gerne als vermeintliche Tabubrecher inszenieren, um Ressentiments zu schüren. Ins Visier geraten dann die deutsche NS-Vergangenheit, Minderheiten, Ausländerkriminalität oder die Politik Israels, über die man wegen der herrschenden politischen Korrektheit angeblich nicht offen sprechen könne.
Erhöhte Sensibilität
Krause ist ehemaliger DDR-Bürgerrechtler. Er gehörte zu den Erstunterzeichnern des Neuen Forums in Jena. „Ich bin ein typischer 89er. Ich habe aus dem Erlebnis einer Diktatur die Erfahrung gemacht, dass Freiheit erstritten werden kann“, sagte er in einem Interview mit der „Welt“. Der Freiheitsbegriff von Ostdeutschen wie Krause ist aus der Erfahrung der Wiedervereinigung heraus mit der Nation verbunden. Krause habe sie als „Schutzraum der Freiheit“ erfahren. Im westdeutschen Diskurs ein Ding der Unmöglichkeit. Auf die heftigen Angriffe gegen sich war Krause nicht vorbereitet. „Im Osten sind bestimmte Reflexe einfach nicht so ausgeprägt“, sagt er.
Wo verläuft die Grenze zwischen Erlaubtem und Verbotenem in der Politik? Westdeutsche Politiker wissen spätestens seit dem „Fall Jenninger“, dass die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte erhöhte Sensibilität erfordert. Zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 hielt der damalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger am 10. November 1988 eine Rede im Bundestag, die erklären sollte, warum so viele Deutsche dem NS-Regime gefolgt waren.
Er tat das jedoch so ungeschickt – Jenninger sprach von einem „Faszinosum“ des Nationalsozialismus – und so empathisch, dass die Zuhörer meinen konnten, er identifiziere sich mit dem NS-Regime. Einen Tag später trat Jenninger zurück. Als Ignatz Bubis versuchsweise Teile der umstrittenen Rede im Jahr darauf vortrug, regte sich keinerlei Protest. Bei dem späteren Vorsitzenden des Zentralrats der Juden kam niemand auf die Idee, er würde Sympathien für den Nationalsozialismus hegen.
Vorsichtige Wortwahl
Der Begriff „Political Correctness“ war damals in Deutschland noch unbekannt. Heute würde Jenninger sofort als Opfer der politischen Korrektheit gelten. Was genau jedoch damit gemeint ist, kann so recht niemand sagen. Der Begriff „Political Correctness“ wurde in den USA geprägt. In Deutschland ist er längst zu einem Schlagwort in der öffentlichen Diskussion geworden. Ursprünglich ging es dabei um Sprachregelungen, die das Ziel hatten, rassistische und sexistische Konnotationen aus dem Sprachgebrauch zu tilgen.
Talleyrands Bonmot, die Sprache sei dem Menschen gegeben, um seine Gedanken zu verbergen, wird durch „Political Correctness“ auf den Kopf gestellt. Die Sprache bestimmt das Denken, lautet die Prämisse. In der Sprache spiegeln sich schließlich die Normen einer Gesellschaft. Politisch korrekte Sprache hat zum Ziel, das Denken zu ändern und dadurch die Gesellschaft toleranter und friedfertiger zu machen. Sie ist so, positiv verstanden, Ausdruck einer Zivilgesellschaft, die Diskriminierungen entschlossen bekämpft und zu verhindern sucht. Und sie betrifft besonders Politiker. Kaum eine andere Berufsgruppe muss derart darauf achten, durch ihre Wortwahl die Öffentlichkeit – und damit potenzielle Wähler – nicht gegen sich aufzubringen. „Politiker müssen Rücksicht auf die gewachsene Sensibilität des Publikums nehmen“, sagt Horst Dieter Schlosser, Erfinder der Aktion „Unwort des Jahres“.
Politische Vorreiter
1971 konnte Franz-Josef Strauß noch unbehelligt sagen: „Ich will lieber ein kalter Krieger sein als ein warmer Bruder.“ Eine solche schwulenfeindliche Äußerung würde dieser Tage keinem Spitzenpolitiker mehr durchgehen.
Auch bei der verbalen Gleichberechtigung von Frauen gehen die Volksvertreter voran. Kein Politiker kann es sich mehr leisten, neben den „Bürgern“ nicht auch die „Bürgerinnen“ anzusprechen. Die politische Kultur hat sich gewandelt. Minderheitenschutz beginnt heute schon in der Sprache.
Politische Korrektheit fordert aber auch Gegner heraus. Sie sehen im Bemühen um politische Korrektheit die real existierende Spielart des „Neusprech“ aus George Orwells Roman „1984“: ein Repressionsinstrument, das Sprach- und Denkverbote fördere. Anders als bei Orwell komme die Gleichförmigkeit der Sprache nicht von einem staatlichen Unterdrückungsapparat, sondern aus der Gesellschaft selbst. „Der Mensch ist eben harmoniebedürftig“, sagt Schlosser.
Unschuldige Wörter
Was als gut gemeinte Aktion begann, hat sich längst zu einer Konsenssprache verselbständigt, die auf allerlei reale oder vermeintliche Befindlichkeiten Rücksicht nimmt – und so Probleme verschleiert statt sie zu benennen. Und es kann noch schlimmer kommen. „Allzu gut gemeinte Wortmonster“, sagt Schlosser, „können ihrerseits diskriminierend wirken.“
Ein Beispiel: die politisch korrekte Bezeichnung „Menschen mit Migrationshintergrund“. Die tauche unter den Einsendungen zum „Unwort des Jahres“ immer wieder auf, erzählt Schlosser. Die Einsender seien jedoch nicht etwa Deutschstämmige, sondern zugewanderte Ausländer, die das Label als Behinderung empfänden.
„Das Wort an sich ist ja meist unschuldig“, sagt Schlosser. Es seien häufig nicht die Ausdrücke, die diskriminieren, sondern der Kontext, in dem sie gebraucht werden. Die Bezeichnung „Ausländer“ verliere eben erst dann ihre Neutralität, wenn sie permanent in negativen Zusammenhängen auftauche.
Mit einer einfachen Umbenennung ist es nicht getan. Das zeigt das Beispiel der Sinti und Roma. Der Begriff „Zigeuner“ ist wegen der rassistischen Verwendung im Nationalsozialismus aus dem Sprachgebrauch weitgehend verschwunden.
Um einen diskriminierenden Hinweis auf die Ethnie von Straftätern zu vermeiden, ersetzten deutsche Behörden die gebräuchliche Bezeichnung „Sinti und Roma“ durch „Menschen mobiler ethnischer Minderheiten“. Polizisten kürzten die Formel bald zu MEM ab. Gewonnen war durch die politisch korrekte Sprachvolte nichts, im Gegenteil: Ein neues Stigma war geboren. Nun waren es die „Mems“, die straffällig wurden – und jeder Beamte wusste, wer gemeint war.
Geht es nach dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz, ist politische Korrektheit deshalb Teufelszeug. „Das, was man Political Correctness nennt, ist die aktuelle Rhetorik des Antichristen“, findet Bolz. Der Antichrist, heißt es in der Bibel, komme als jemand daher, der Sicherheit und Frieden verkünde.
Fatale Folgen
Hinter dem „Dialog der Kulturen“ verbirgt sich für Bolz die geistige Kapitulation, hinter „sozialer Gerechtigkeit“ der Neid. Wer sich permanent hinter einer Wohlfühlrhetorik versteckt, läuft nach dieser Lesart der politischen Korrektheit Gefahr, unhinterfragbare Dogmen zu schaffen – und das selbständige Denken zu verlernen.
Für die Politik kann das fatale Folgen haben. Fragen, die gesellschaftliche Relevanz besitzen, müssen Politiker offen und von allen Betrachtungswinkeln aus ansprechen können. „Tabus sind für die Lösung politischer Probleme hinderlich“, sagt der Politikberater Klaus-Peter Schmidt-Deguelle.
Wer sich Tabus auferlegt, weil es gerade nicht opportun oder politisch korrekt erscheint, über ein Thema zu reden, entzieht es dem gesellschaftlichen Diskurs – und verhindert damit vernünftige politische Entscheidungen. Das kann niemand wollen. Zumal gezielte Zuspitzungen für Politiker sogar nützlich sein können. Bescheren sie ihnen doch unter den Marktgesetzen der Mediendemokratie garantierte Aufmerksamkeit. Clevere Politiker nutzen Grenzüberschreitungen, um Themen auf die Agenda zu setzen und Debatten anzustoßen.
Finger in die Wunde
Nicht jeder hat das Zeug dazu. Thilo Sarrazin schon. Die Medien gieren nach den kessen Sprüchen des Berliner Finanzsenators. Bei Sarrazin ist Aufregung garantiert. Ob er nun einen Hartz-IV-Speiseplan aufstellt, um zu beweisen, dass man sich von 4,25 Euro am Tag gut ernähren kann. Ob er seine Beamten als „bleich und übel riechend“ wegen der hohen Arbeitsbelastung bezeichnet oder den Flughafen Tempelhof ein Filetstück nennt, „aus dem schon die Maden herausschauen“. Sarrazin spricht Klartext und schafft es so, den Finger in die Wunde zu legen.
Das provoziert natürlich auch Gegner. „Der Umstand, dass ich eine Sache direkt anspreche und auf den Punkt bringe, ist als solcher schon ein Schock für viele Leute“, sagt er. Oft genug auch für seinen Chef, Berlins Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Der rüffelte Sarrazin wiederholt für seine unorthodoxen Aussagen abseits aller offiziellen Sprachregelungen. Gleichwohl, vermutet Sarrazin, „in der Stille seines Herzens“ sei Wowereit „nicht undankbar“, dass es jemanden in seiner Mannschaft gäbe, der die Dinge auf den Punkt bringe.
Es sind Einzelkämpfer wie Sarrazin, die in der öffentliche Diskussion Perspektiven abseits politisch korrekter Pfade eröffnen. Das macht sie nicht gerade beliebt. Nicht bei der Öffentlichkeit und nicht bei ihrer Kollegen. Dennoch: Wenn auch nicht jeder einer Meinung mit ihnen ist, zwingen sie Andere zur Auseinandersetzung mit ihnen.
„Einen Beitrag zum Erkenntnisfortschritt“ nennt Sarrazin seine meist spontanen Einwürfe. Beleidigen, darauf legt er Wert, wolle er niemanden. Gutes Benehmen ist dem Finanzexperten wichtig. „Man darf ja nicht zum Verhaltensgestörten werden, wenn man mal eine Lippe riskiert“, sagt er.
Nur einmal, als sich gegen die erhöhten Kita-Gebühren in Berlin Protest regte, vergriff sich auch der geübte Provokateur Sarrazin im Ton. Es werde ja so getan, „als ob der Senat Kinder ins Konzentrationslager schicken wollte.“ Der einzige Spruch, für den der Berliner Finanzsenator sich je entschuldigte. Agendasetting auf Kosten der Opfer des Nationalsozialismus – da war eine Grenze überschritten. „Absolute Tabuzonen darf man nicht betreten, weil die Reaktionen völlig unvorhersehbar sind. Die eigene Botschaft kommt dann auch nicht rüber“, sagt Sarrazin.
Ansonsten will er auch weiter sagen, was ihm passt. Schon aus Gründen der Gesundheit. „Ich komme nie zu einem politischen Gemütsstau, weil ich immer rechtzeitig Dampf ablasse.“ Das bewahre ihn vor dem Herzinfarkt. Andere Politiker zerbrechen sich den Kopf darüber, wie sie in die Öffentlichkeit geraten könnten. Sarrazin hat das längst nicht mehr nötig. Bei jeder noch so unbedeutenden Veranstaltung, die er besucht, sitzen Journalisten und hoffen, den nächsten skandalträchtigen Ausspruch aufzuschnappen.
Vom Ende her denken
„Medien forcieren Tabubrüche, weil sie Schlagzeilen produzieren wollen“, sagt Schmidt-Deguelle. Politiker müssen sich aber im Klaren darüber sein, dass die Medien zwar deutliche Worte von ihnen fordern, sie aber hinterher diejenigen verdammen, die sie gebrauchen. Provokationen wollen deshalb gelernt sein. „Politiker müssen gezielte Tabubrüche vom Ende her denken“, sagt Schmidt-Deguelle. Das heißt: vorher überlegen, welche und wie viele Gegner sie auf den Plan rufen werden und ob deren Gegnerschaft ihnen nutzen wird. Und natürlich das passende Thema wählen.
Junge können es sich dabei eher erlauben, politisch unkorrekt aufzutreten. Als der Vorsitzende der Jungen Union Philipp Mißfelder im Sommer 2003 forderte, 85-Jährigen keine künstlichen Hüftgelenke mehr auf Staatskosten zu gewähren, ging ein Aufschrei durch die Republik. Mißfelder brachte sämtliche Rentner und Sozialpolitiker und sogar weite Teile der eigenen Partei gegen sich auf. Die „Bild“-Zeitung beschimpfte den damals 23-Jährigen tagelang als herzlosen „Milchbubi“. Er bekam sogar Morddrohungen.
Dennoch war die Aktion rückblickend ein PR-Coup für den Nachwuchspolitiker. Mit seiner provokanten Äußerung hatte Mißfelder ein Thema gesetzt und das eigene Profil geschärft. Er entschuldigte sich dafür, möglicherweise Menschen verletzt zu haben. Doch in der Sache blieb er hart. Das ließ aufhorchen. Mißfelders Botschaft lautete: Ich traue mich etwas und habe Stehvermögen. Dass sein Vorschlag ethisch umstritten war, machte da nichts. „Später wird so etwas ohnehin als Jugendsünde verbucht“, sagt Schmidt-Deguelle.
Nutzen und Schaden
Auch der 63-jährige Sarrazin kann es sich leisten, die Grenzen des Sagbaren auszuloten. Seine Finanzpolitik ist erfolgreich, dank eines rigiden Sparkurses erzielte die Bundeshauptstadt im vergangenen Jahr erstmals seit Jahren einen Haushaltsüberschuss.
Anders als viele Parlamentarier ist Sarrazin nicht auf die Wählergunst angewiesen und finanziell unabhängig: Er gilt immer wieder als Anwärter auf einen Posten bei der Bundesbank und ist dank seiner langjährigen Tätigkeit als Staatssekretär, bei der Deutschen Bahn und der Treuhand finanziell abgesichert. Er muss diesen Job nicht machen und kann deshalb sagen, was er für richtig hält.
Das kann sich auch für die Parteien lohnen. Nonkonformisten wie Sarrazin erschließen ihnen neue Wählerschichten. Denn sie verschanzen sich nicht hinter einer Konsensterminologie, sondern sprechen eine Sprache, die die Bürger verstehen. Sie vernebeln potenziell unangenehme Themen nicht durch Euphemismen. Kampfeinsätze heißen bei ihnen nicht „Friedensmissionen“. Sie glauben daran, dass die Menschen wissen wollen, worum es eigentlich geht und vermeiden Scheingefechte.
Sie können ihrer Partei aber auch erheblich schaden: Zu viele Abweichler mit provokanten Positionen verwischen das Profil einer Partei – und verprellen möglicherweise deren traditionelle Wähler.
„Wenn Einzelkämpfer das Bild einer Partei bestimmen, wird es gefährlich“, sagt Schmidt-Deguelle. Als Jürgen Möllemann im Bundestagswahlkampf 2002 ein umstrittenes Flugblatt veröffentlichte, in dem er die Juden Ariel Scharon und Michel Friedman scharf angriff, wirkte das so, als wolle die FDP den Antisemitismus salonfähig machen. Für die liberale Partei ein fataler Eindruck.
Das Satiremagazin „Titanic“ nutzte die Aufregung zu einer ihrer bekannten Aktionen. Mit einem als „Guidomobil“ getarnten VW-Golf fuhr sie in die Eisenacher Fußgängerzone und stellte fingierte FDP-Plakate mit antisemitischen Parolen („Judenfrei und Spaß dabei“, „Gib endlich Friedman“) auf. Ziel der Satire: Die Denkmuster hinter dem politischen Tabubruch offen zu legen.
Der Skandal war perfekt, als sich der einheimische FDP-Kreisvorsitzende mit den Redakteuren vor den Hetzplakaten ablichten ließ. Er musste daraufhin zurücktreten. „Verlogenheit und Heuchelei“ in der Politik seien beliebte Ziele der „Titanic“, sagt Redakteur Martin Sonneborn. „Wenn jedermann im Lande klar aussprechen würde, was er denkt, würde ein Moment entfallen, über das man sich lustig machen kann.“ Die Satire ermögliche es, „über die Dinge lachen zu können, die man sonst mit der Waffe bekämpfen müsste.“
Seit 2004 sitzt Sonneborn sogar einer eigenen satirischen Kleinpartei vor: Der „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“, kurz: Die Partei.
Populismus pur
„Bis auf wenige Ausnahmen“ äußerten Politiker sich ohnehin populistisch und opportunistisch, findet er. Warum da nicht gleich eine eigene Partei gründen, um „diesen ganzen Polit-Quatsch“ ad absurdum zu führen? Und so initiiert Die Partei permanent lustige und völlig folgenlose politisch unkorrekte Aktionen.
Ihr wichtigstes Versprechen: Sie will die Berliner Mauer wieder aufbauen, um die „Zweiteilung Deutschlands in kultureller und sozioökonomischer Hinsicht“ auch formal zu vollziehen. Die „Titanic“, sagt Sonneborn, habe Die Partei gegründet, „um ganz offiziell ein bisschen an diesem Tabu zu kratzen.“
Politiker tun sich mit solcherlei Satire traditionell schwer. Sonneborn kann sich noch genau erinnern, wie Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee „die Kinnlade heruntersackte“, als er diesem in einer Talkshow versicherte: „Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, ich wiederhole: mein Ehrenwort, dass mit uns an der neuen Mauer, die wir errichten werden, kein Schießbefehl zu machen ist.“
Merke: Eine gute Satire persifliert die Tabus der Politik mit einer hintergründigen Friedensrhetorik, bei der selbst der Antichrist noch etwas lernen könnte.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Im Schatten – Deutschlands Redenschreiber. Das Heft können Sie hier bestellen.