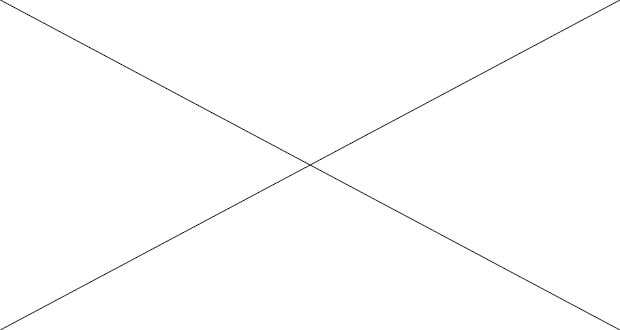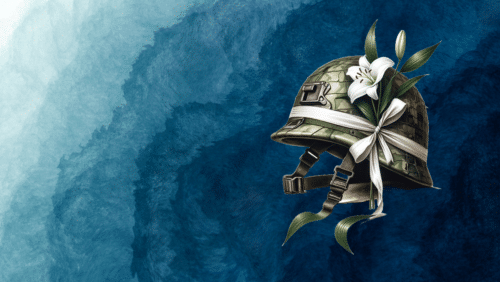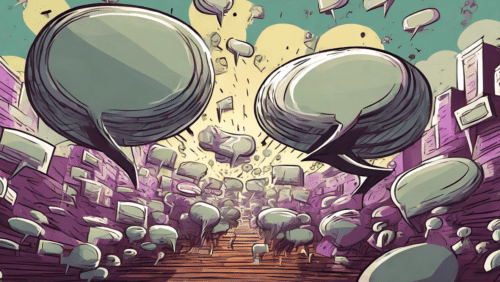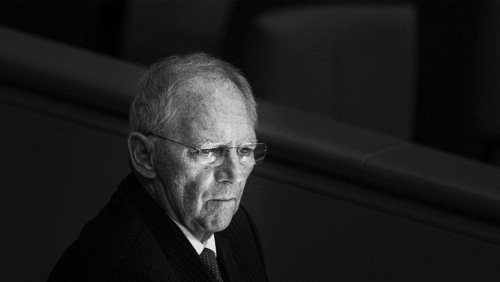Es ist ein Traum in schwarz und weiß. Und es ist der Traum jedes Pressesprechers: „Tagesschau“ und „Heute“ berichten, Clippings sonder Zahl, und am Ende rollt eine Debatte ganz nach Wunsch von einem Ende der Republik zum anderen. Dieser Traum verbirgt sich hinter einer Formulierung, die so oder leicht abgewandelt zum Standard jeder Nachrichtensendung, jeder Zeitungsseite zählt: „ … wie eine heute veröffentlichte Studie zeigt.“
Pisa-Studie und Stern-Report, Sinus- und Iglu-Studie, Herbstgutachten und Shell-Jugendstudie: Tagtäglich verweisen die Medien tausendfach auf wissenschaftlich fundiertes Expertenwissen, das hochkomplexe Sachverhalte in übersichtliches Studienformat verpackt. Und es dann noch einmal in Form von Zusammenfassungen, Abstracts und Executive Summaries derart verdichtet, dass es für den schnellen Überblick in einer 30 bis 60-minütigen Pressekonferenz reicht. Allein „Google-News“ listet unter dem Suchwort „Studie“ 28.500 Treffer von Medienberichten auf, die auf Studien, Gutachten und andere Expertisen verweisen.
„Wie eine heute veröffentlichte Studie zeigt“: Für Pressesprecher und PR-Leute bieten Studien ein verlockendes Potenzial, das es zu entwickeln gilt. Schließlich ist oft schon die Vorstellung einer Studie per se ein berichtenswertes Ereignis, wie Kerstin Maria Rippel, stellvertretende Kommunikationschefin des Bundesverbands Neuer Energieanbieter berichtet. Der Verband setzt in seiner PR- und Lobbyarbeit bewusst auch auf Studien, um seine Anliegen der Öffentlichkeit oder auch Experten verständlich zu machen: „Die Komplexität des Energiemarkts führt dazu, dass Journalisten froh sind, wenn es klar verständliche Studien gibt, die diese Komplexität herunterbrechen“, sagt Rippel.
Medien sind aufnahmebereit
Eine Aussage, die nicht allein auf das Thema Energiemarkt zutreffen dürfte. Generell gilt nach Einschätzung von Konrad Mrusek, FAZ-Wirtschaftskorrespondent in Berlin: „Wenn Studien oder Umfrageergebnisse genau die gängigen Erwartungen erfüllen, dann laufen sie in den Medien voll durch und treffen auf höchste Aufnahmebereitschaft,“ so Mrusek. „Dabei müsste man als Journalist eigentlich besonders misstrauisch sein, wenn wissenschaftliche Ergebnisse sozusagen genau ins Bild passen.“ So verlangt denn der Umgang mit Studien auf Medienseite vor allem Professionalität. „Journalisten geraten in Not, weil die Sachverhalte, über die sie berichten müssen, immer komplexer werden“, sagt Josef Zens, der lange als Wissenschaftsjournalist arbeitete und heute Sprecher der 82 Leibniz-Institute ist. „Gleichzeitig haben der Termindruck und die Umschlaggeschwindigkeit von Einzelthemen zugenommen, hat sich die Zahl der Sendeplätze im Wissenschaftsjournalismus deutlich erhöht“, beschreibt Zens die Risiken für eine fundierte Berichterstattung. „Andererseits war es noch nie so einfach wie heute, Sachverhalte zu verifizieren.“ Es müsse nur eben auch gemacht werden: „Investigativer Journalismus bedeutet letztlich auch nichts anderes als pingelig sein, nachfragen und immer wieder nachfragen“, erklärt Zens und beschreibt damit Arbeitsmethoden, die letztlich auch die Grundlage allen wissenschaftlichen Arbeitens darstellen.
Diese Risiken im Blick, arbeitet die Leibniz-Gemeinschaft derzeit an einem Grundsatzpapier, das klarstellen soll, welchen Leitlinien die Leibniz-Institute bei der Politikberatung folgen sollen. Unter anderem sollen die Leitlinien auch sicherstellen, dass zwischen Auftraggebern wissenschaftlicher Studien wie Ministerien oder Verbänden und den Auftragnehmern auf Wissenschaftsseite Klarheit über den Umgang mit den Studienergebnissen herrscht. Dass hierfür gerade in der Politikberatung Klärungsbedarf besteht, zeigt sich beispielsweise immer dann, wenn Ministerien unerwünschte Inhalte zurückzuhalten versuchen. Zuletzt war dies im Vorfeld des sogenannten Bildungsgipfels zu beobachten. Eine kurz zuvor öffentlich gewordene Studie über die abschreckende Wirkung von Studiengebühren auf die Studienbereitschaft hatte für politischen Wirbel gesorgt – zusätzlich befeuert durch Berichte, das Ministerium habe die Veröffentlichung der bereits vorliegenden Studie auf die Zeit nach dem Gipfel verzögern wollen.
Zum Agenda-Setting genutzt
„Wie eine heute veröffentlichte Studie zeigt“: Welche Eigendynamik wissenschaftliche Studien entfalten können, wie sehr sie weit über die Tagesaktualität hinaus zum Agenda-Setting beitragen können, zeigt das Beispiel des Korruptionsindex’ von Transparency International (TI). Praktisch über Nacht machte der Index die Anti-Korruptions-Organisation weltweit bekannt und verhalf den Transparenz-Wächtern zu einem Wachstum, das in der NGO-Geschichte seinesgleichen sucht.
Dabei beruhte der einzigartige Erfolg des TI-Index’ auf einem Zufall und einem Missverständnis. So waren es im Wortsinn erste Studien, methodische Fingerübungen, die 1995 eher zufällig in die Hand von Journalisten gerieten. Und ein Missverständnis lag insoweit vor, als Journalisten und Politiker in aller Welt bis heute nur zu gerne glauben, mit dem Index ein Instrument in der Hand zu haben, welches das Ausmaß der Korruption im weltweiten Vergleich zeigt – in einem harten Ranking von „blütenweiß sauber“ bis „durch und durch korrupt“.
Tatsächlich jedoch maß und misst der erstmals 1995 veröffentlichte Index lediglich das von Experten und in Befragungen geschätzte Ausmaß der Korruption. Ein bedeutender methodischer Unterschied, weshalb der Index denn auch vollständig Corruption-Perceptions-Index, also Korruptions-Wahrnehmungs-Index heißt. Schließlich macht es einen Unterschied, ob Experten, Geschäftsleute und Bürger zu Erfahrungen und Einschätzungen befragt werden oder ob das exakte Ausmaß von Korruption gemessen wird (was im weltweiten Vergleich methodisch nicht zu leisten sein dürfte).
Das Beispiel des TI-Index’ zeigt zweierlei: Zum einen die enorme Durchschlagkraft wissenschaftlicher Studien, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt ein komplexes Thema in verdichteter Form in den Mittelpunkt der politischen Debatte stellen. Zum zweiten veranschaulicht der TI-Index die hohe Bedeutung einer intensiven Kommunikation der methodischen Grundlagen. Schließlich sind die Ergebnisse des Index’ bei zahlreichen Regierungen rund um den Globus alles andere als willkommen – und laden dazu ein, die Autoren des Index’ fehlender wissenschaftlicher Grundlagen zu bezichtigen. Ein Vorwurf, der umso eher verfängt, je weniger in vielen Ländern schlecht ausgebildete, oberflächlich recherchierende Journalisten die wissenschaftliche Substanz selbst überprüfen können.
Club of Rome war Vorreiter
Und noch etwas zeigt der Corruption-Perceptions-Index von TI: Die Pionierrolle von NGOs, wenn es gilt, der eigenen Agenda eine fundierte wissenschaftliche Basis zu geben. Noch vor TI gehörten hier beispielsweise der WWF und Greenpeace zu den Vorreitern beim Agenda-Setting mit Forschungsergebnissen. Eine Schlüsselrolle spielte hierbei auch die 1972 veröffentlichte Studie „Limits to Growth“ des Club of Rome. Bis heute prägt die auf deutsch unter dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“ bekannte Studie die Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte. Ihr durchschlagender Erfolg beruhte auf einer Kombination mehrerer Faktoren: Die wissenschaftliche Verankerung an einem Ort der internationalen Spitzenforschung wie dem Massachusetts Institute of Technology. Die jeder einseitigen Einflussnahme unverdächtigen Förderung durch eine Stiftung wie der Volkswagen-Stiftung. Und noch etwas war entscheidend: „Was die Kritiker übersahen, ob wissenschaftlich oder nicht, war, dass „Grenzen des Wachstums“ genau das schonungslose Instrument war, das man benötigte, um die Aufmerksamkeit der Welt zu erregen“, wie sich Rennie Whitehead, einer der Gründer der kanadischen Gesellschaft des Club of Rome, erinnert. Ein Traum in Schwarz auf Weiß eben.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Verhandeln – Die vernachlässigte Kunst. Das Heft können Sie hier bestellen.