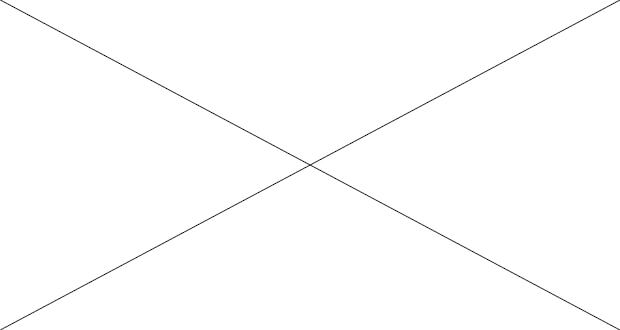Ihre Welten haben nichts miteinander zu tun und berühren sich doch täglich. Sie verstehen einander nicht und sind zugleich aufs Engste aufeinander angewiesen. Sie wollen beide die Welt erklären und reden doch aneinander vorbei.
Die Rede ist von Journalisten. Und von Experten. Von echten Experten und von Talkshow-Experten – wer weiß das schon so genau?
Sie brauchen einander, das ist klar. Keine Talkshow, kein Politmagazin kommt ohne Experten aus, diejenigen also, die sich in Universitäten oder an Max-Planck-, Leibniz- oder Helmholtz-Instituten hauptberuflich der wissenschaftlichen Arbeit widmen. Sie erklären die Welt, machen Komplexes weniger komplex.
Ob im Radio, bei der Zeitung, im Fernsehen oder im Online-Magazin: Als Experten sind diese Wissenschaftler vor allem deshalb unersetzlich, weil sie sich absetzen von dem Stimmengewirr der Interessenverbände und Lobbygruppen, weil sie hell beleuchtete Schneisen schlagen ins verwirrende Dickicht der politischen Meinungen und Anschauungen. Den Zuschauern und Lesern bietet dies Orientierung und Übersichtlichkeit.
Und Journalisten setzen auf die Glaubwürdigkeit der Experten, weil ihre Präsenz auf Bildschirmen und Zeitungsseiten das Eindruck vermittelt, dass es doch so etwas gibt wie Objektivität und Wahrheit. Auch die Wiederkehr der immer gleichen Experten vermittelt Zuschauern und Lesern das Gefühl, die Welt wäre weniger kompliziert, weniger unübersichtlich, weniger widersprüchlich, wenn nur die Experten mehr zu sagen hätten. Tatsächlich sind bei den Anne-Will- und Maybrit-Illner-Themen denn auch immer wieder die gleichen Experten zu sehen und zu hören: Gesundheit? Jürgen Wasem oder Karl Lauterbach. Rente? Bernd Raffelhüschen. Parteien und Diäten? Hans Herbert von Arnim. Terror? Rolf Tophoven. Jugendkriminalität? Christian Pfeiffer.
Nur eine kleine Schar
Bei einer Sonnenfinsternis verdunkelt der aus astronomischer Sicht winzig kleine Mond das Licht der unendlich viel größeren Sonne. Ein wenig erinnert das an die Omnipräsenz der nahezu verschwindend kleinen Zahl an Talkshowexperten im Verhältnis zum übrigen Heer der Wissenschaftler, die schlicht im Dunkeln bleiben. Dies spricht nicht gegen die wenigen Vertreter der einzelnen Fachdisziplinen, die es bis auf die Bildschirme geschafft haben, eher im Gegenteil. Aber es zeigt doch einen allzu kleinen Ausschnitt dessen, was Wissenschaft leisten und an Welt-Erklärung bieten kann.
Einen weiteren Vorteil bietet es Journalisten, Experten zu Wort kommen zu lassen. Diese dürfen, was ihnen weitgehend verwehrt ist: eine politische Position vertreten, politische Handlungsoptionen entwickeln. Nachricht und Kommentar sind strikt zu trennen? Kein Problem – der passende Experte ist schnell gefunden, der in Zitat oder O-Ton exakt die Position vertreten kann, die dem sachlichen Bericht den nötigen Dreh gibt.
Medienauftritte fördern das Image
Umgekehrt sind auch Wissenschaftler auf die Medien angewiesen. Im Kampf um Fördermittel und vielversprechende Nachwuchswissenschaftler zählen für Hochschulen und Forschungsinstitute jenseits harter Rankings auch „weiche“ Faktoren wie Image und Reputation. Dies belegt etwa eine kürzlich veröffentlichte internationale Studie des Forschungszentrums Jülich, für die allein in Deutschland 400 Wissenschaftler befragt wurden. Andere Wissenschaftler suchen die medial vermittelte Aufmerksamkeit von Politik, Unternehmen oder Verbänden, um an Drittmittel, an Forschungs- und Beratungsaufträge heranzukommen. Und schließlich gibt es viele Wissenschaftler, die mit ihren Erkenntnissen über Krebsvorsorge oder Klimaschutz, über Bildungsnotstand oder Biogasgewinnung mitten hinein wollen in den gesellschaftlichen Diskurs – weil ihnen Fortschritt, Wandel und Veränderung ein Anliegen sind. Auch hierfür sind sie auf mediale Vermittlung angewiesen.
Doch so sehr beide Seiten einander brauchen: In der Praxis haben sie immer wieder handfeste Probleme miteinander. Zwar befindet die unter Leitung des Kommunikationswissenschaftlers Hans Peter Peters entstandene Jülicher Studie, „dass die Beziehungen der Wissenschaft zu den Massenmedien sowohl auf institutioneller Ebene als auch für die Forscher selbst einen hohen Stellenwert besitzen.“ Und auch die internen Normen der Wissenschaftsgemeinde stellten „keine ernsthafte Barriere gegen Medienkontakte ihrer Mitglieder dar“.
Und doch kommt es zu Konflikten zwischen den beiden Systemen Wissenschaft und Medien – etwa wenn Arbeitsweise und Methoden schlicht inkompatibel sind. Ein Beispiel ist die jüngste Auseinandersetzung über den Molekularbiologen Hans Schöler, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Biologie in Münster. Schöler hatte auf einer wissenschaftlichen Tagung im Juli in Berlin vorgeschlagen, für wissenschaftliche Vorträge über bisher unveröffentlichte Forschungsergebnisse eine Vertraulichkeitsverpflichtung auch für Journalisten einzuführen. Für besondere Furore sorgte der renommierte Forscher, als er auf dem Berliner Kongress einen Vortrag an der entscheidenden Stelle mit dem Hinweis abbrach, es seien Journalisten im Raum. „Spiegel Online“ titelte daraufhin, Schöler wolle Journalisten verbieten lassen, von Fachkongressen zu berichten.Hinter der bizarren Auseinandersetzung steckt die Furcht der Medien, nicht als erste über die wissenschaftliche Sensation oder den medizinischen Durchbruch berichten zu können. Und auf der anderen Seite die Furcht der Forscher, selbst auf Fachtagungen nicht mehr ohne Sorge vor verfrühter Veröffentlichung über bislang ungesicherte Hypothesen und vorläufige Erkenntnisse debattieren zu können. Kein Zufall sicherlich, dass sich der Streit um Verschwiegenheitsregeln ausgerechnet am Thema Stammzellforschung entzündete.
Veröffentlichungen zählen
Probleme bereitet vielen Wissenschaftlern eine intensive Medienarbeit auch an anderer Stelle: Häufig stimmen die Anreize für den einzelnen Wissenschaftler einfach nicht. So ist bei wissenschaftlichen Evaluationen in der Regel das entscheidende Kriterium die Zahl und Qualität der wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Was zählt, sind „referierte“ Publikationen in „A-Journals“ – und selbst die prägnantesten und intelligentesten Zeitungszitate, Gastkommentare oder Kolumnen sind hierbei schlicht irrelevant. Außerdem fürchten viele Wissenschaftler, ihre Erkenntnisse nicht mehr in renommierten Fachblättern wie „Science“, „Nature“ oder „American Economic Review“ veröffentlichen zu können, wenn sie bereits ihren Weg in die Massenmedien gefunden haben.
Ein weiterer Effekt der dysfunktionalen Kommunikation zwischen Medien und Wissenschaft war jüngst am Phänomen der so genannten „Klimaskeptiker“ zu beobachten. Diese bestreiten, dass der Klimawandel durch menschliche Einflüsse ausgelöst ist, beziehungsweise bestreiten sie ihn überhaupt. Weniger interessant als die Argumente der Klimaskeptiker ist in unserem Zusammenhang die Tatsache, dass sie mit ihren Thesen überhaupt auf derart breiten Widerhall in vielen Medien stoßen – und dies obwohl beispielsweise die Arbeit des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ein in der Geschichte der Wissenschaft wohl beispielloses Unterfangen an Gründlichkeit des wissenschaftlichen Arbeitens darstellt.
Ist also zwischen Journalisten und Experten alles verloren? Sind Wissenschaft und Journalismus auf ihrer Suche nach Welterklärung dazu verdammt, aneinander vorbeizukommunizieren? Nun, durchaus hoffnungsvoll stimmt, wen wundert’s, die Aussage von Experten. So zitiert die deutsche Ausgabe von Wikipedia in ihrem Beitrag über „Experten“ die Experten Schumacher und Czerwinski sowie Chi, Glaser und Farr mit dem Befund: „Echte Experten sind in der Lage, Abstraktionen über mehrere Sachgebiete hinweg zu leisten. Sie erkennen große Bedeutungszusammenhänge und sie achten mehr auf Strukturen als auf oberflächliche Eigenschaften.“ Journalisten werden das gerne hören.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe wir wollen rein – Bundestag 2009. Das Heft können Sie hier bestellen.