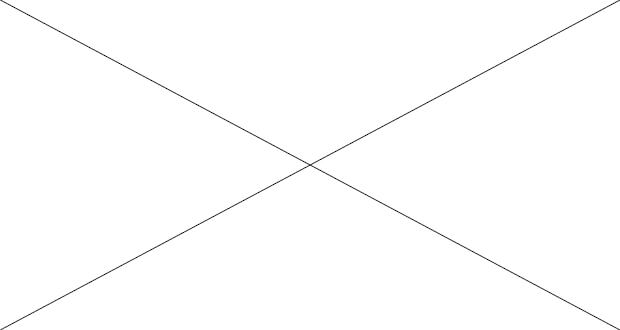p&k: Herr Professor Korte, der Bundestagswahlkampf 2009 wird rückblickend gern als Kuschelwahlkampf bezeichnet, weil die Protagonisten so brav und artig miteinander umgingen. Werden wir auch diesmal um eine ordentliche Wahlschlacht betrogen?
Karl-Rudolf Korte: Davon gehe ich nicht aus. In der letzten Wahlperiode waren Union und SPD Partner in einer Großen Koalition. Sie konnten daher im Wahlkampf nicht mit harten Bandagen gegeneinander kämpfen und haben sich klugerweise darauf beschränkt klarzumachen, dass es keine Neuauflage der Großen Koalition geben würde. Die Wähler konnten die Koalition insofern nicht abwählen, weil sie ohnehin nicht mehr antreten wollte. Das war eine sehr besondere Situation. So wenig polarisiert kann es diesmal nicht zugehen.
Wirklich Lust auf Konfrontation scheint die Bundeskanzlerin aber auch diesmal nicht zu haben. Bisher hat sie ihren Herausforderer Peer Steinbrück mehr oder weniger weggeschwiegen.
Das ist richtig. Als Kanzlerpräsidentin wird sie sich auch nicht mit der Person des Herausforderers auseinandersetzen, sondern darauf verweisen, dass er – bei Einbindung in die Kabinettsdisziplin – ein verlässlicher und wichtiger damaliger Finanzminister war.
Wie wird sich Merkel im Wahlkampf inszenieren?
Sie wird sich als Euro-Krisenmanagerin präsentieren, denn mit dieser Krise ist ihre Kanzlerschaft eng verbunden. Wirkung entfalten kann diese Strategie aber nur, wenn die Euro-Krise weiter anhält. Außerdem wird sie auf das ein oder andere Modernisierungsthema setzen, das sie in der Union bereits durchgesetzt hat. Und dann soll der Wähler entscheiden, welche Partei mit ihr in der Regierung vertreten sein soll.
Einen klassischen Lagerwahlkampf wie in Niedersachsen wird es im Bund also nicht geben?
Nein. Die Situation ist eine völlig andere, weil mindestens fünf Parteien in den Bundestag einziehen werden. Sicherlich werden die Parteien einen Lagerwahlkampf andeuten, um die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Aber die Paradoxie gegenüber dem Wähler wird darin bestehen, dass sie sich zugleich alle Optionen offenhalten werden, um auch lagerübergreifend eine Regierung bilden zu können.
Das klingt nach einer echten Herausforderung für die Wahlstrategen und Kampagnenmacher.
Ja, weil Multioptionswahlkämpfe immer schwierige Wahlkämpfe sind. Auf der einen Seite müssen die Parteien eine gewisse thematische Offenheit signalisieren. Auf der anderen Seite brauchen sie allerdings auch einige Stammwählerthemen, um ihre Kernanhängerschaft zu binden.
Welche Bedeutung hat das Ergebnis der Niedersachsenwahl für den Bundestagswahlkampf?
Der Ausgang der Landtagswahl in Niedersachsen hat eine große Bedeutung, vor allem in Hinblick auf die FDP: Die Liberalen haben wieder Siegeraura, und die wird ihnen enormen Auftrieb geben. Die Mobilisierungsidee für Rot-Grün ist mit Hannover wieder abrufbar. Aber im Kern bedeutet die Wahl von Hannover, dass es einen Wahlkampf um Koalitionsoptionen geben wird.
Aber das überraschend gute Ergebnis von Hannover hat die FDP doch nur den vielen taktisch denkenden CDU-Wählern zu verdanken.
Das trifft sicherlich zu. Aber das wird bei der Bundestagswahl nicht anders sein. Es gibt immer mehr Wähler, die ganz ratiosnal auf dem Koalitionsmarkt unterwegs sind und ihre Stimmen auf zwei Parteien verteilen. Von diesem Trend zum Stimmensplitting profitieren kleinere Parteien wie die FDP.
Andererseits dürfte eine Neuauflage der schwarz-gelben Koalition im Bund für Merkel an Reiz verloren haben, da sie dann auf unabsehbare Zeit gegen den nun von Rot-Grün dominierten Bundesrat regieren müsste.
Nun, sie hatte auch bislang keine eigene Mehrheit im Bundesrat. Aber natürlich haben sich durch die Landtagswahl in Niedersachsen die Kräfteverhältnisse auch innerhalb der Koalition verschoben. Seit Hannover ist die FDP eng an die CDU gekettet, aber das gilt keineswegs umgekehrt.
Was bedeutet das für die Wahlkampfstrategie der Union?
Zwei Szenarien sind denkbar: Entweder geht die Union wie vor vier Jahren eine Art Arbeitsteilung mit der FDP ein und weist den Liberalen ein Thema zu, mit dem diese beim Wähler funktional punkten können. Oder sie setzt auf „Union pur“ und verzichtet im Wahlkampf auf den Hinweis, dass das ein oder andere Thema inhaltlich durch die FDP abgedeckt werden könnte.
Sie sagten eben, dass mindestens fünf Parteien im nächsten Bundestag sitzen werden. Heißt das, dass Sie den Piraten eine realistische Chance geben, auf Bundesebene ins Parlament einzuziehen? Viele haben die Partei nach ihrem Wahldebakel in Niedersachsen bereits für erledigt erklärt.
Das sehe ich anders. Die Piraten werden weiterhin eine Rolle spielen, weil sie aus der digitalen Gemeinde heraus die Konfliktlinien zwischen Freiheit und Sicherheit neu und anders definieren als die etablierten Parteien. Und das ist nach wie vor attraktiv für Menschen, die in der digitalen Welt zu Hause sind.
Was ist bei den Piraten in Hannover schiefgelaufen?
Es fehlte ihnen an einem professionellen Wahlkampf. Als die Piraten das erste Mal in Berlin auftauchten, waren sie mit witzigen und originellen Plakaten aufgefallen. Sie haben ganz traditionelle Wahlkampfmittel geschickt für sich zu nutzen gewusst. Das war in Hannover nicht zu erkennen.
Wie müssen die Piraten ihren Bundestagswahlkampf jetzt ausrichten?
Vor allem müssen sie versuchen, Protestwähler mit einem Faible für das Nicht-Etablierte zu gewinnen. Und natürlich sollten sie nach wie vor auf ihre beiden Kernthemen Netzpolitik und Transparenz setzen.
Auch die Linken haben in Niedersachsen einen Dämpfer erhalten. Welche Konsequenzen hat das für ihren Bundestagswahlkampf?
Sie werden ostdeutsche Themen akzentuieren, um ihre Kernanhängerschaft ansprechen. Im Osten ist die Linke nach wie vor eine regional verankerte Volkspartei. Um den Wiedereinzug in den Bundestag muss sie sich daher keine Sorgen machen.
In einer rundum guten Ausgangslage für die Bundestagswahl scheinen nur die Grünen zu sein. Woran liegt das?
Zum einen verfügen die Grünen über eine basisdemokratisch gewählte und legitimierte Spitze. Das ist ein großes Pfund für die Bundestagswahl. Und was Niedersachsen betrifft: Da konnten sie die größten Zuwächse im konservativen ländlichen Bereich erzielen. Das sichert ihnen zwar nicht zwangsläufig Mehrheiten in diesen klassischen CDU-Domänen, aber es ist doch ein sehr nachdenkenswertes Ergebnis. Jetzt dürfen sie aber nicht den Fehler machen, sich im Wahlkampf zu eng an die SPD zu binden. Die Grünen bleiben die Partei der wertorientierten, besorgten Mitte.
Die SPD hofft darauf, endlich aus dem Umfragetief herauszukommen. Wie kann das gelingen?
Mit Teambildung und mit vorzeigbaren, authentischen Themen. Steinbrück spiegelt nun einmal nicht das soziale Kompetenzzentrum der SPD wider. Es ist nichts Verwerfliches daran, im Wahlkampf auch auf andere Personen zu setzen, die in einer Regierung wichtige Funktionen übernehmen würden.
Eine Wahlkampfstrategie ist bei der SPD bereits erkennbar: Nah ran an den Wähler, und zwar ganz altmodisch im persönlichen Gespräch.
Ja, dieser Trend zurück zur klassischen Flugblattstrategie deutet sich schon seit einigen Jahren an. Die Parteien setzen wieder verstärkt darauf, ihre Unterstützer vor die Tore großer Werksgelände zu schicken, um den Beschäftigten Flugblätter und Wahlprospekte in die Hand zu drücken. So kommt man mit ihnen ins Gespräch.
Wie lässt sich dieser Retro-Trend erklären?
Eine große Rolle spielen natürlich die USA als Vorbild. Mich hat es beeindruckt zu beobachten, wie viele Bürger im vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf von Haus zu Haus gezogen sind, um für „ihren“ Kandidaten zu werben – und das ganz ohne persönlichen Vorteil. In Deutschland werden wir eine „Bürgerbewegung“ in diesem Ausmaß aber nicht erleben.
Warum nicht?
Weil ein solches Engagement ein klares Bekenntnis zu einer Partei voraussetzt. Und genau das ist das Problem: Wer bekennt sich zum Beispiel so weit zur FDP, dass er für sie an einer fremden Tür klingeln würde? Dazu gehört viel Selbstbewusstsein. Bei uns finden die Parteien schlichtweg nicht genug Unterstützer, die bereit sind, für sie von Haustür zu Haustür zu ziehen.
Dafür setzt sich SPD Kanzlerkandidat Peer Steinbrück zu fremden Leuten ins Wohnzimmer, um mit ihnen über Politik zu reden. Ein Erfolg versprechendes Format?
Auf jeden Fall. Wenn etwas im Wahlkampf wirkt, dann die interpersonale Kommunikation. Politik ist immer medienvermittelt, aber die Auseinandersetzung mit dem Vermittelten geschieht zumeist im Alltagsgespräch. Und wenn ein Politiker Teil dieses Alltagsgesprächs ist, kann er etwas auslösen: Er kann jemanden motivieren, wählen zu gehen, er kann diese Person auch motivieren, ihn zu wählen. Eine Erfolgsgarantie ist ein persönliches Gespräch zwar nicht, aber in der Regel wird der Versuch belohnt.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Die Kanzlermacher – Zu Besuch in Deutschlands Wahlkampfagenturen. Das Heft können Sie hier bestellen.