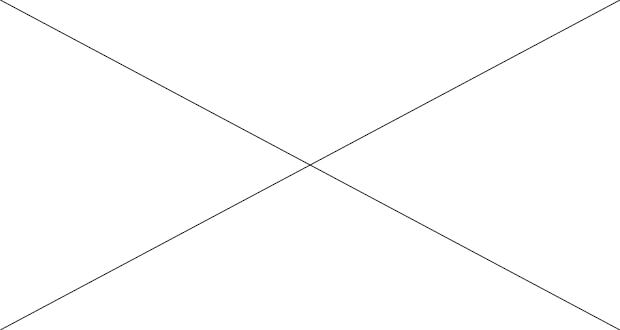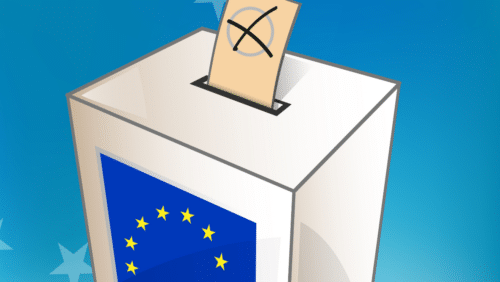Beim Gang durch Berlin-Mitte, vorbei am Auswärtigen Amt, in Richtung des Hausvogteiplatzes bleibt Andrea Fischer immer wieder stehen und schaut auf die bunten, eng aneinandergereihten Townhouses, die hier das Stadtbild prägen. Das teuerste Appartement in einem der mehrgeschossigen Neubauten soll kürzlich für 15.000 Euro den Besitzer gewechselt haben – pro Quadratmeter. Fischer ist unschlüssig, ob ihr die Architektur gefällt. So oder so: Bald könnte sie für diese Gegend verantwortlich sein.
Andrea Fischer, ehemalige Bundesministerin und Bundestagsabgeordnete, kandidiert als Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Berlin-Mitte. Der Bezirk zeichnet sich durch zahlreiche Kontraste aus: neu und alt, Ost und West, reich und arm. Wie eng all das zuweilen beieinander liegt, lässt sich am Hausvogteiplatz in etwa erahnen. Von den Holzbänken am Springbrunnen – die Townhouses im Rücken, der mondäne Gendarmenmarkt nur wenige Meter entfernt – kann man die bis zu 25-geschossigen DDR-Bauten der Leipziger Straße sehen. Dort hat Fischer einen Eindruck davon bekommen, was bis zur Wahl – und vielleicht auch danach – auf sie zukommt. Auf einer ihrer ersten Wahlveranstaltungen beschwerten sich die Mieter darüber, dass der rot-rote Senat Müllschlucker in Hochhäusern nur noch unter strengen Umweltauflagen erlaubt. Die Kollegin von der Linken habe unter dem Eindruck erboster Wähler angekündigt, die Änderung der Bauordnung noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, erzählt Fischer und lacht teils amüsiert, teils verächtlich. Und sie? „Ich habe gesagt, dass ich mich mit den Details noch nicht beschäftigt habe.“
In diesen Momenten klingt die 51-Jährige wie eine politische Quereinsteigerin, die sich den Regeln des Wahlkampfs widersetzt. Und in gewisser Weise ist sie das. In den vergangenen neun Jahren hat sie vieles gemacht, aber keine Politik. Seit 2006 arbeitet sie als Beraterin für die Gesundheitswirtschaft – erst als Partnerin bei der Kommunikationsagentur Pleon, seit 2009 selbständig. Wenn Journalisten Fischers Tätigkeit beschreiben, nennen sie sie üblicherweise Pharma-Lobbyistin. Es gibt in Deutschland angenehmere Berufsbezeichnungen. Fischer nimmt es so hin: „Aufregen müsste ich mich nur, wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte.“ Sie selbst sagt, sie vermittle zwischen Pharmaindustrie und Öffentlichkeit. Sollte sie nicht Bezirksbürgermeisterin werden, will sie das weiterhin tun. Ihr Mandat für die Bezirksverordnetenversammlung will sie in jedem Fall annehmen.
Die Rückkehr in die Politik – noch dazu in die Kommunalpolitik – stößt bei vielen Menschen auf Unverständnis. Deren Argument: Wenn man – wie Fischer – mit 38 Jahren Bundesministerin gewesen sei, gebe es keine Steigerung mehr. Für Fischer ist gerade das ein Argument für ihr Engagement. „Ich habe keine Idee von Aufstieg mehr“, sagt sie und lacht: „Das entspannt ungemein.“
Fischer, die Bundesministerin. Als die Grünen 1998 erstmals in die Bundesregierung einzogen, war sie – neben Joschka Fischer und Jürgen Trittin – eine von drei grünen Ministern. Bis sie 2001 wegen des BSE-Skandals von ihrem Amt zurücktrat. Seitdem lebt sie mit dem Ruf der gescheiterten Ministerin. Fischer nimmt es gelassen: „Angesichts der Tatsache, dass das Amt auf vier Jahre angelegt war, bin ich gescheitert.“ Ein Jahr später war ihre politische Karriere abrupt beendet. Bei der Listenaufstellung des Berliner Landesverbands zur Bundestagswahl 2002 erlitt sie eine „demütigende Niederlage“, wie sie selbst einräumt. Seitdem war politisch nichts von ihr zu hören. „Ich bin damals vom Platz gestellt worden“, sagt Fischer, „es gehört sich nicht, vom Spielfeldrand aus zu kommentieren.“ Hat sie nach dieser Enttäuschung darüber nachgedacht, die Grünen zu verlassen? Andrea Fischer wirkt plötzlich sehr ernst und nimmt sich Zeit für eine Antwort. „Nein, ich habe nicht vergessen, dass ich eine Grüne bin“, sagt sie nach einer Weile. Die CDU habe ihr einmal angeboten, für den Bundestag zu kandidieren. Sie hat es nicht getan, weil sie die Frage nach dem Warum nicht hätte beantworten können.
Jetzt will sie zurück auf den Platz. Dort warten – statt Energiewende und Eurokrise – Automatencasinos, Schulpolitik und Müllschlucker. „Müllschlucker sind für mich mittlerweile ein Symbol für Kommunalpolitik geworden“, sagt Fischer und lacht ihr lautes Fischer-Lachen, „solche Themen treiben die Leute um.“
Fischer selbst treibt etwas anderes um. Ihr Thema ist die Integration. Das ist – zumal in Berlin – nicht sonderlich originell, aber man nimmt ihr das Anliegen ab. Ob sie damit ihre Wähler erreicht? Die potenziellen Grünen-Wähler sind vor allem junge, gut ausgebildete Menschen mit entsprechendem Gehalt. Es sind nicht diejenigen, die von den Integrationsbemühungen der Bezirksbürgermeisterin Fischer profitieren würden. Die gibt sich optimistisch: „Es gibt viele Berührungspunkte zwischen Grünen und Liberalen. Der Unterschied ist, dass Grüne wissen, dass es nicht nur um ihre Freiheit geht.“
Sollte Fischer die Wahl gewinnen, wird sie Verständnis brauchen. Die Kassen sind leer und die Spielräume eng. „Na und, Geld ausgeben kann jeder“, entgegnet Fischer. „Es mag sein, dass ich morgens aufwache und mich ärgere, zu wenig entscheiden zu können. Umso mehr ist Phantasie gefragt“, sagt sie – und lacht.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Kampf ums Internet – Die Lobby der Netzbürger formiert sich. Das Heft können Sie hier bestellen.