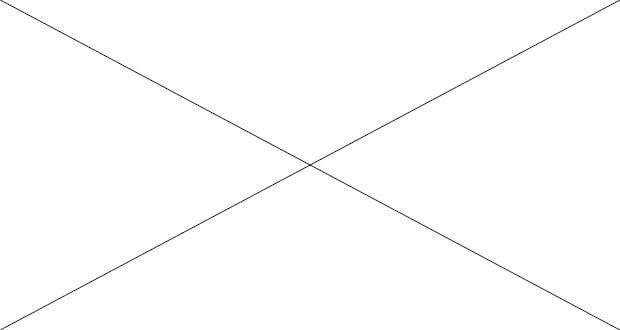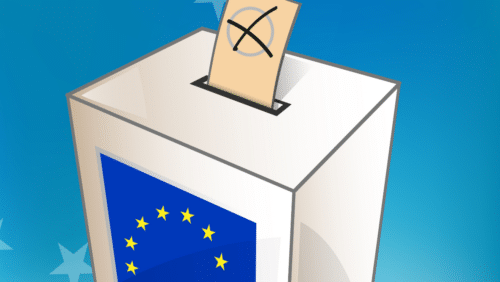Zu den Klängen von David Bowies Song „Heroes“ steigt der künftige Bundeskanzler Gerhard Schröder am Abend des 27. September 1998 auf die Bühne vor dem Erich-Ollenhauer-Haus in Bonn. Dort, vor der damaligen Parteizentrale der Sozialdemokraten, lässt sich der Sieger der Bundestagswahl von seinen begeisterten Anhängern feiern. Eine Hand zum Schröder-typischen Victory-Zeichen geformt, winkt der Spitzenkandidat in die Menge. Im Hintergrund leuchtet eine blaue Wand mit rotem Punkt, der das Schlagwort der „neuen Mitte“ symbolisiert. Das klassenkämpferische Rot der Sozialdemokraten ist zu einem Accessoire geworden, es fügt sich in einen Markenauftritt ein, den die Partei seit mehr als einem Jahr kontinuierlich aufgebaut hat. Pünktlich zum Ende der betulichen Bonner Jahre konzipierte die Werbeagentur KNSK ein Design, wie es die deutsche Politik noch nicht gesehen hatte. „Ein Meilenstein“, schwärmen Experten noch heute. Selbst die „New York Times“ fand damals lobende Worte für die SPD-Kampagne.
Medienwirkung war alles
Das Design des SPD-Bundestagswahlkampfs 1998 schien die Verwandlung vorweg zu nehmen, die die deutsche Politik in der Berliner Republik vollziehen sollte: amerikanischer, moderner und medial perfekt inszeniert. „Die Partei hat 1998 verschiedene Medienkanäle, Wahlkampfphasen und Organisationstypen erstmals systematisch zusammengeführt und professionalisiert“, sagt Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie Allensbach. Damals sei das Verhältnis von Optik und Inhalt komplett gekippt: „Vorher hieß es, Medienwirkung spiele für die Wahlentscheidung gar keine Rolle, nachher war Medienwirkung plötzlich alles“, so der Experte für visuelle Kommunikation.
Seitdem tritt die Entwicklung des politischen Designs jedoch auf der Stelle. Seit der Bundestagswahl 1998 hätten die Parteien sogar – bis auf wenige Ausnahmen – einen Rückschritt in die 1960er Jahre gemacht, urteilt Detmar Karpinski, Geschäftsführender Gesellschafter von KNSK: „Da war eine Menge Schrott dabei.“ Die Parteien stehen vor einem grundlegenden Problem: Sie machen Jahr für Jahr in jedem Wahlkampf dasselbe Angebot. Die Union versuchte bis in die jüngste Vergangenheit, mit Werten und Wirtschaft zu punkten, die SPD wirbt mit dem Versprechen sozialer Gerechtigkeit, die FDP verspricht mehr Netto vom Brutto, und die Grünen setzen sich als Garanten einer nachhaltigen Entwicklung in Szene.
Vor der Bundestagswahl 2013 steht die deutsche Politik vor einer Herausforderung. Die Parteien müssen sich auf viel diffuseren Kanälen vermarkten. Online- und Offline-Elemente, Anzeigen, Plakate und Webseiten müssen optisch miteinander verknüpft sein. Das Design ist ein entscheidender Baustein: „Die Parteien müssen ihre Markenidentität durch einen extrem hohen Wiedererkennungswert aufbauen“, sagt Thomas Petersen. Dafür seien klar verständliche Botschaften wichtig: „In der visuellen Umsetzung ihrer Kampagnen sollten die Parteien auf größtmögliche Klarheit, Erkennbarkeit und Einfachheit setzen.“ Nur so wird es künftig möglich sein, sich in der Flut von Informationen, visuellen Reizen und politischen Angeboten von der Konkurrenz abzusetzen – und die Wähler an die Urnen zu locken.
Bis dahin steht den Parteien viel Arbeit bevor. Die neuen Herausforderungen der Politik gehen mit Umwälzungen in der Medienlandschaft einher. „Die Innovationsrhythmen werden schneller, die Aufmerksamkeitsspanne verkürzt sich – deshalb müssen Parteien kontinuierlich unverwechselbar kommunizieren“, sagt Kajo Wasserhövel, ehemaliger Wahlkampfmanager der SPD. Um darauf auch im Design reagieren zu können, muss der bisherige Produktionsprozess umgekehrt werden. „Die Corporate Identity der Parteien wird künftig immer über das Netz geprägt, um das Tempo zu halten“, prognostiziert Wasserhövel, der heute Geschäftsführer einer Agentur für Strategieberatung ist.
Sinnliche Erfahrungen
Eine Entwicklung hin zum Primat des Online-Designs hält auch Oliver Zeisberger für dringend notwendig: „Bislang richtet sich das Webdesign der Parteien zu stark nach dem Design der Printprodukte“, so der Geschäftsführer der auf Online-Kommunikation spezialisierten Agentur Barracuda. Da bleibe wenig Raum, um einen eigenen, den Inhalten entsprechenden Look zu etablieren. Das Design werde stattdessen oft durch große Pixelflächen in der Parteifarbe bestimmt. Dass es anders geht, hat Zeisberger mit seiner Agentur beim Online-Auftritt der nordrhein-westfälischen SPD bei der vergangenen Landtagswahl bewiesen: „Dort haben wir die Webseite an einer Stelle mit einer digitalen Kreidetafel bestückt, an anderen Stellen Worte in einer Kohlestift-Optik unterstrichen.“ Das Ziel: die Webseite greifbar und wiedererkennbar zu machen. „Im Idealfall lässt das Design einer Webseite beim Nutzer sinnliche Erfahrungen im Kopf entstehen“, so Zeisberger. Das Leinenmuster, das den Hintergrund der SPD-Webseite bildete, ist anschließend sogar in den Offline-Wahlkampf eingeflossen – als Hintergrund für Wahlplakate.
In den USA beginnen viele Politiker zwei Jahre vor einer Wahl damit, im Netz ein einheitliches Erscheinungsbild zu etablieren. Für Zeisberger eine zeitgemäße und vorausschauende Art, mit politischem Design zu arbeiten. Zuerst müssten Politiker entscheiden, wie die Wähler sie wahrnehmen sollen, dann erst könnten die Werbeprofis ein passgenaues Online-Design entwickeln: „Entscheidend ist, das Design von den Inhalten herzuleiten, für die ein Kandidat steht.“ Das machte auch das erfolgreiche Design der Obama-Kampagne im US-Präsidentschaftswahlkampf 2008 aus. Beispielhaft dafür steht das berühmt gewordene blau-weiß-rote O – das Logo der Kampagne.
Politisches Design im Online-Zeitalter ist jedoch längst mehr als Farbe, Schriftart und Fotoauswahl. Nutzerfreundlichkeit hat sich zu einem unverzichtbaren Design-Baustein entwickelt. „Die Designer müssen sich ständig hinterfragen, ob sie es nicht noch einfacher und übersichtlicher machen können“, sagt Zeisberger. Ein Design, das diese Ansprüche erfüllt, müsse deshalb vor allem für die Mitglieder in den Bezirks-, Kreis- und Ortsverbänden nutzbar sein, so der Barracuda-Chef. „Die beste Corporate Identity kann am fehlenden Handwerkszeug vor Ort scheitern.“ An eine gelungene politische Symbolik formuliert er deshalb den Anspruch: „Sie muss unzweifelhaft mit Partei und Kandidat zusammenhängen, flexibel einsetzbar und für alle Beteiligten nutzbar sein.“
Für die Polit-Designer bringt das Web 2.0 auch Fallstricke mit sich. „Für Parteien ist es extrem schwierig, einen klar definierten Markenkern mit einem einheitlichen Erscheinungsbild online durchzusetzen, weil die Parteibasis mit den interaktiven Medien völlig neue Spielräume hat und somit Einfluss nimmt“, gibt Coordt von Mannstein, Chef der gleichnamigen Werbeagentur, zu bedenken. Dabei ist gerade die Gesamtstrategie für einen wirksamen Werbeauftritt entscheidend: „Die Botschaften werden in den neuen Medien schnell verwässert – deshalb spielt die signalhafte Wiedererkennbarkeit, das Gesamtdesign politischer Kommunikation eine immer größere Rolle.“
Florett oder Säbel
Das Wahljahr 2011 war für die Parteien ein willkommener Testlauf. In sieben Bundesländern – in Stadtstaaten und Flächenländern, in Ost und West – fanden Landtagswahlen statt. Jede Partei fand sich mal in der Rolle des Herausforderers, mal in der als Regierungspartei. Zwei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl sind das ideale Bedingungen, um Instrumente zu testen, Trends zu bestimmen und die Ergebnisse auszuwerten. „In basisnahen Landtagswahlkämpfen zeigt sich, wie stabil eine Partei inhaltlich und optisch aufgestellt ist“, sagt von Mannstein. Der Professor für visuelle Kommunikation warnt jedoch davor, erfolgreiche Design-Elemente aus dem Landtagswahlkampf eins zu eins in den Bundestagswahlkampf zu übertragen. Es mache einen Unterschied, ob der Wahlkampf sich in der Stadt oder auf dem Land abspielt: „Plakate in Schwarz-Weiß-Ästhetik können Sie in Großstädten machen. Auf dem Land kommen die nicht an.“ Auch Schriftart und Schriftgröße müssten immer wieder aufs Neue an den Kandidaten und die Botschaft angepasst werden: „In Semantik und Typographie drückt sich aus, ob Sie Politik mit dem Florett oder mit dem Säbel machen“, so von Mannstein.
Der Werber glaubt, dass das Design der Parteien im Herbst 2013 von großer Bedeutung sein wird. Die Grünen könnten dann von ihrer passenden Corporate Identity profitieren: „Themen, Werte und Personen stimmen mit dem Design überein“, sagt von Mannstein. Die Parteifarbe könnte sich als großes Plus erweisen. Die kleinen Parteien sprechen eine bestimmte Klientel an – ein eindeutiges Erscheinungsbild ist dabei unabdingbar. Das geht so weit, dass der grüne Hamburger Landesverband, der seit seiner Gründung im Jahr 1980 als Grün-Alternative-Liste (Gal) firmiert, darüber nachdenkt, das Corporate Design der Bundespartei zu übernehmen – inklusive des Namens Bündnis90/Die Grünen. Mit dem angepassten Design – so die Überlegung in der Hansestadt – könnte die Gal vom bundesweiten Aufwind der Grünen profitieren.
Die FDP hingegen steht derzeit vor einem Problem. Die Liberalen hätten als Marke momentan „generell verschissen“, urteilte der schleswig-holsteinische FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki jüngst im Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“. Dabei war gerade der Markenauftritt lange Zeit eine Stärke der FDP. „Mit dem charakteristischen Gelb und Blau setzt sich die Partei von der Konkurrenz ab“, sagt Coordt von Mannstein. Wenn die Stimmung für die Partei schlecht ist, gerät der Wiedererkennungseffekt allerdings zum Nachteil. In diesem Fall müsse man die traditionellen Farben etwas vernachlässigen, so von Mannstein. Wie das funktionieren kann, war Anfang des Jahres in Hamburg zu beobachten. Im Wahlkampf setzten die Liberalen zwar auf Gelb und Blau – stellten jedoch das Blau in den Vordergrund.
Show, don’t tell
Dass das Vertrauen in die etablierten Parteien zunehmend verloren geht, könnte bedeuten, dass im Bundestagswahlkampf die Kandidaten in den Vordergrund rücken. Die Union hat bereits 2009 auf ihr Spitzenpersonal gesetzt. Das Konterfei der Kanzlerin und der Minister prägten die Plakate, dazu ein blauer Hintergrund und kurze, knackige Slogans. Die SPD hat in den Landtagswahlkämpfen dieses Jahres ebenfalls weitestgehend auf das traditionelle Rot verzichtet. In den Wahlkämpfen in Hamburg und Berlin kam die Farbe – bis auf das Parteilogo – kaum vor. Für Detmar Karpinski ergibt es durchaus Sinn, auf die immer wiederkehrenden Motive und Farben zu verzichten. Er stellt einen anderen Anspruch an modernes Design: „Die Menschen müssen sich und ihre Bedürfnisse in den Plakatmotiven wiedererkennen“, sagt der KNSK-Chef. Das sei der Berliner SPD gelungen. Die Plakate erklären dem Wähler nicht mit Slogans, wofür die Partei steht, sondern vermitteln ihm ein Gefühl dafür – show, don’t tell. Die minimalistische „Berlin-Verstehen“-Kampagne der Hauptstadt-SPD stieß beinahe durchweg auf positive Resonanz – und könnte mit ihrem modernen Design wegweisend für die kommende Wahl sein.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Think-Tanks – Ihre Strategien, ihre Ziele. Das Heft können Sie hier bestellen.