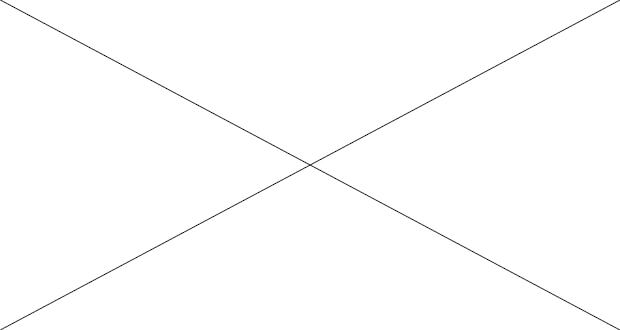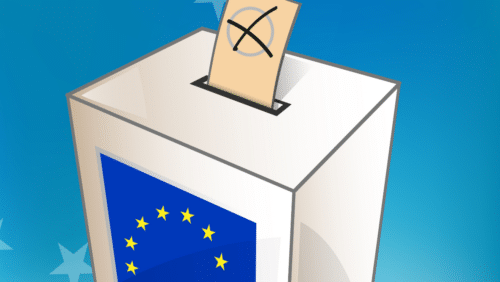Wird sich die Überzeugung des Parteivorstands der Linkspartei, man würde „durch die Wirtschaftskrise im Selbstlauf stärker, wenn man nur radikal genug gegen den Kapitalismus wettere“ bewahrheiten („FAZ“)? Die „Süddeutsche Zeitung“ sorgt sich im Herbst 2008 schon um eine mögliche Verstärkung postdemokratischer Tendenzen. Einigen Linksradikalen geht die Polarisierung noch nicht weit und noch nicht schnell genug. Die „WAZ“ befürchtet gar eine Abkehr vom Parlamentarismus.
Als Partei hat die Linke inzwischen einen festen Platz im gewählten Spektrum der Parteienlandschaft. Eigentlich könnte sie entspannt der Wahl entgegenblicken. Bedient sie doch gerade die Interessen der von der Wirtschaftskrise am stärksten betroffenen Menschen: die der Benachteiligten und Ausgegrenzten. Ihr Erfolg könnte zum Selbstläufer werden, wenn sie nur eindringlich genug ihre Wahlkampfparolen bemüht. Meinen die einen. Ihr Erfolg müsste wie das Angebot eines lang ersehnten, sozialen Schutzschirms Millionen von Menschen mobilisieren und politisieren. Meinen die anderen.
Die Wahlergebnisse sprechen aber eine andere Sprache. Sie verharren vielfach im einstelligen Bereich. Mancherorts sinken sie bereits deutlich. Auf Bundesebene haben sie sich hinter den Grünen und der FDP auf niedrigem Niveau eingependelt. Wie ist dies zu erklären? Gewiss spielen innerparteiliche Prozesse eine wichtige Rolle. Der Machtkampf zwischen radikalen Fundamentalisten, die eher antikapitalistische Ressentiments bedienen und Realpolitikern, die pragmatische Politik vor Ort machen wollen, aber oft von den Landeslisten verdrängt werden, spitzt sich mancherorts zu. Der Einfluss von Sektierern wie Sahra Wagenknecht und der Personenkult à la Oskar Lafontaine wachsen. Aber auch bei anderen Parteien gibt es diese Flügelkämpfe, die Grundsatzdebatten und den Personenkult. Was also macht den Unterschied aus? Warum also wird die Krise nicht zur Steilvorlage für die Linkspartei?
Die Suche nach der Antwort spiegelt grundsätzliche Probleme von Krisenpolitik wider: Die Linkspartei versteht nicht die Menschen in ihrer Krise. Krise ist für sie, man könnte beinahe sagen, primär eine sozio-ökonomische Kategorie. Menschen sind aber mehr und etwas anderes als Kategorien. Die Linkspartei bestimmt gemäß sozialistischer Tradition ihre Zielgruppen nach demographischen und soziologischen Kriterien und nicht nach emotionalen Milieus. Dies spiegelt sich unter anderem in einer eher intellektuellen statt emotionalen Sprache wider, die auf die meisten Menschen befremdlich wirkt. Sie verschließt sich daher gegenüber der psychologisch-emotionalen Dynamik der Krise. Ökonomische Krise und materielle Armut sind aber immer auch emotional verarbeitete Krise und Armut. Die Linkspartei kann daher nicht gemeinsam mit den Menschen aus der Erfahrung aller Beteiligten lernen, um gerade über diesen Lernprozess politisch zu motivieren und zu mobilisieren.
Die Weltwirtschaftskrise von 1929 hat die Politik damals vor ähnliche Herausforderungen gestellt wie die gegenwärtige Krise. Es ging um drei zentrale Fragen: Was müssen Politik und Wirtschaft für die Bewältigung der Krise tun? Was macht die Krise mit den Menschen? Und was heißt dies für Politik?
Arbeitslosigkeit bewirkt nicht zwingend Politisierung
Vor knapp 80 Jahren hat man diese Aspekte konkret empirisch-wissenschaftlich beforscht. Die Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ befasst sich mit den Menschen, die damals durch die Schließung des größten Unternehmens in einem österreichischen Ort auf einen Schlag arbeitslos wurden. Damals waren 77 Prozent der Bevölkerung, also der ganze Ort davon betroffen. Eine Gruppe von Sozialwissenschaftlern untersuchte erstmals wissenschaftlich die aus einer solchen Katastrophe entstandenen Folgen. Sie gingen der Frage nach: Was macht die Krise mit den Menschen? Wie reagieren die Menschen auf die Krise, und was heißt dies für ihr politisches Bewusstsein und für ihr politisches Handeln? Das wesentliche Ergebnis der Studie gleich vorweg: Arbeitslosigkeit und Armut führen nicht zwangsläufig zur Entwicklung von politischem Bewusstsein, zu politischem Handeln oder gar Protest. Stattdessen eher zu Resignation, Apathie und Depression.
Die Forschergruppe wollte einerseits empirisch, quantitativ und qualitativ, sorgsam forschen. Andererseits aber auch nahe genug an den Menschen sein, um sie als Forscher zur Mitarbeit an der Studie zu bewegen sowie den Menschen in ihrer Not konkret zur Seite zu stehen. Für die damalige Zeit bahnbrechend war die Untersuchung der materiellen Situation der arbeitslosen Menschen, aber auch die Beschreibung und Analyse der psychischen und sozialen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf einzelne Menschen sowie auf die gesamte Gemeinschaft des Ortes. Die Forschergruppe gewann zunehmend den Eindruck einer „abgestumpften Gleichmäßigkeit“. Sie erlebte das Dorf als eine resignierte Gemeinschaft, die zwar im Alltag funktionierte, aber „die Beziehung zur emotionalen Zukunft verloren hatte“. Die arbeitslosen Bewohner von Marienthal verfielen daher zusehends in Apathie. Man arrangierte sich schließlich mit der „trostlosen Lebenslage“, was sich wiederum auf alle Familienangehörigen übertrug. Die Menschen erlebten diese Art von Gleichgültigkeit als Bedeutungslosigkeit von Gegenwart und Zukunft. Die psychosoziale Verarmung als emotionale und soziale Auswirkung von Armut spiegelte sich in vier Typen. Während 112 Familien als „ungebrochen“ galten, galten 330 Familien als „resigniert“, 11 waren „verzweifelt“ und 25 völlig „apathisch“.
Dies stellt für Politik und für Parteien, damals wie heute, eine besondere Herausforderung dar. Sehen sie sich doch konfrontiert mit der materiellen Not, aber auch mit der psychosozialen Verarmung, der schwindenden emotionalen Ansprechbarkeit der Menschen.
Drohung des „sozialen Tods“
Die Erfahrung von Arbeitslosigkeit gleicht der Erfahrung von Verlassenheit (Bourdieu). Mit Bourdieu könnte man von der Drohung des „sozialen Tods“ sprechen, weil „wesentliche Anreize, Dringlichkeiten, Hoffnungen, Investitionen und Zeiten mit der Arbeit verbunden sind und bei Arbeitslosigkeit verloren gehen“. Die Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ spiegelt und diskutiert die Logik der Resignation, des Rückzugs, die emotionale Flucht in Illusionen anstelle von solidarischem, politischem Handeln. Gebrochenheit und Abgleiten als weitverbreitete Folge von Arbeitslosigkeit (Wacker) wird, so die Studie, nicht als persönlicher Defekt verstanden, sondern als Demoralisierung durch Arbeitslosigkeit sowie deren subjektiv gebrochene Erfahrung und Deutung. Neuere politische, sozialpsychologische Studien zeigen, dass die Wirkungen von Arbeitslosigkeit bei „guter“ sozialer Sicherung komplexer sind. Dies muss nicht unbedingt heißen, dass ein Mehr an materieller Hilfe auch einer besseren subjektiven, emotionalen Verarbeitung von Armut führt.
Wer linke Politik betreibt, wird durch die Ergebnisse der Studie einerseits desillusioniert, andererseits aufgefordert, sich den Menschen auf eine andere Art zu nähern, will man dem in der psychologischen Fachsprache so genannten Motivationsmodus Rechnung tragen. Die Parteien sollten drei zentrale Motivationsmodi berücksichtigen: Zum einen die „Herkunftsmotivation“ eines Menschen, bei der es darauf ankommt, wo jemand wohnt, welches Alter und welchen Beruf er hat (Rentner, Stadtbevölkerung, Grundschullehrer, Jugendlicher). Die „Verwendungsmotivation“ entspringt der psychologischen Verfasstheit oder Gestimmtheit, die sich in der konkreten Gestaltung der eigenen Lebenspraxis ausdrückt (etwa ein Grundschullehrer, der als alleinerziehender Vater Erbe eines größeren Vermögens ist, Campingurlaub favorisiert und Bezirksmeister im Billard ist). Die „Identifikationsmotivation“ schließlich spiegelt die Glaubens- und Überzeugungshaltung der Menschen im jeweiligen emotionalen Milieu (etwa Menschen, die sich als Hartz-IV-Empfänger arm fühlen oder Akademiker, die sich mit einem Einkommen von 3400 Euro arm fühlen).
Menschen wollen das Gefühl haben, von Politik gesehen zu werden. Man will gemeint sein. Parteien tun gut also daran, spezifische Antworten für die Menschen in ihren jeweiligen emotionalen Milieus zu finden. Wollen sie Politikverdrossenheit erfolgreich bekämpfen, müssen sie raus aus ihrem eigenen sozialen Kokon. Sie müssen das Wagnis eingehen, wieder identifikatorisches Vorbild zu sein, anstatt sich im Wettbewerb „Wer macht die meisten Versprechungen“ zu verlieren.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Beruhigungsmittel- Regierungskommunikation in der finanzkrise. Das Heft können Sie hier bestellen.