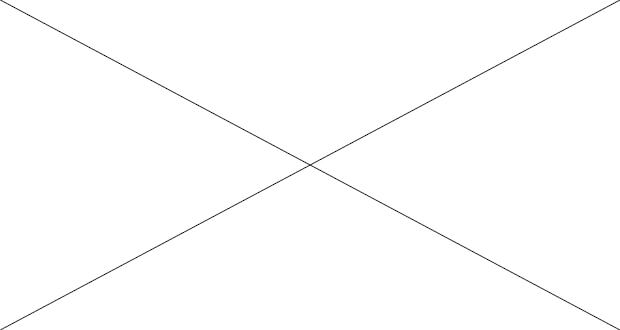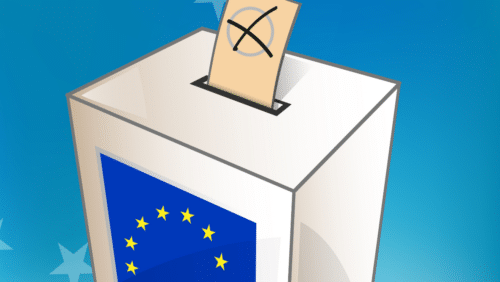p&k: Herr Nelson, Sie sind Experte für Internetwahlkampf. Einige Beobachter sagen, diese Form des Wahlkampfs sei ein Hype ohne großen Inhalt. Was sagen Sie dazu?
Terry Nelson: Als die Menschen vor 12 oder 14 Jahren begannen, Internetseiten zu machen, hätte eine fehlende Internetseite keine Wahlniederlage bedeutet. Aber in den USA haben wir gesehen, dass das Internet mit der Zeit immer wichtiger für Wahlkämpfe geworden ist, und dass sich Wahlkämpfe durch das Internet entwickelt haben.
Gehen diese Veränderungen und Fortschritte in ihrem Geschäft durch das Internet schneller voran, als es früher der Fall war?
Nelson: Ja. TV-Wahlwerbung war ein großer Fortschritt, aber man käme nicht auf die Idee, zu sagen, dass sie den politischen Wahlkampf komplett verändert hat. Über das Internet kann man das jedoch sehr wohl sagen: Es hat die Art verändert, Geld zu sammeln, Wähler zu mobilisieren und Botschaften zu kommunizieren. Das sind die drei kritischen Punkte einer jeden Kampagne. Es ist die weitreichendste Veränderung in der Kommunikation, die wir seit langem erlebt haben. Und diese Veränderungen werden weiter gehen. Vor vier Jahren haben wir nicht über Facebook gesprochen und vor zwei Jahren nicht über Twitter. Wenn ich wüsste, worüber wir in zwei Jahren reden werden, müsste ich in drei Jahren nicht mehr arbeiten.
Herr Güldenzopf, ist der Internetwahlkampf in Deutschland so wichtig wie in den USA?
Ralf Güldenzopf: Das Internet ist ebenso wichtig, wir nutzen es aber zu wenig. Das größte Problem hier sind die fehlenden Ressourcen – vor allem Geld. Das Internet wird nur alle vier Jahre in der Hochzeit des Wahlkampfs für politische Kampagnen genutzt. Notwendig wäre es aber, das Internet vier Jahre lang zu nutzen, dort kontinuierlich die politischen Debatten zu führen, die dann im Wahlkampf fortgeführt werden.
Nelson: Es geht bei allen Möglichkeiten, die das Internet bietet, aber vor allem um die Botschaft. Wenn du keine Botschaft hast, nützt dir die beste Technik nichts.
Bereits 2004 haben Sie in der Bush/Cheney-Kampagne das Internet offensiv genutzt. Auch der Demokrat Howard Dean hat das bei seiner Kampagne zur Präsidentschaftskandidatur intensiv getan. Warum ist das Medium trotzdem so sehr mit Barack Obama verbunden?
Nelson: Um fair gegenüber Howard Dean zu sein – was ich normalerweise versuche zu vermeiden – muss ich gestehen, dass seine Kampagne tatsächlich neue Wege gefunden hat, Menschen anzusprechen und zu rekrutieren. Ihm standen jedoch noch nicht diese technischen Anwendungen zur Verfügung, die heute eine so große Rolle spielen. In der Bush/Cheney-Kampagne haben wir das Internet ebenfalls innovativ genutzt, aber das Netz war in unserer Kampagne nicht zentral. Obama hatte den Vorteil, sich von Anfang an als internetaffin und modern zu präsentieren. Damit war er sehr erfolgreich.
Güldenzopf: Es ist extrem wichtig, eine umfassende Datenbank anzulegen, was die Verantwortlichen der Bush/Cheney-Kampagne bereits 2002 begonnen hatten. Für die Organisatoren ist das viel wichtiger, als etwa ein schönes Logo zu haben. Mit den technischen Möglichkeiten von 2008 wäre auch 2004 schon eine eindrucksvolle Internetkampagne entstanden.
Nelson: Um eines klarzustellen: Geld löst eine Menge Probleme. Obama hat Werbung in Computerspielen geschaltet, was ich nicht unbedingt für eine kluge Idee gehalten habe. Aber wenn du genug Geld hast, kannst du so etwas versuchen. Er war trotzdem nicht der erste Kandidat, der das Internet innovativ genutzt hat. Die Obama-Kampagne stand auf den Schultern derer, die in den Jahren zuvor neue Möglichkeiten des Onlinewahlkampfs ausprobiert haben.
Also hat neben Botschaft und Kandidat doch die Technik einen wesentlichen Unterschied zwischen 2004 und 2008 ausgemacht?
Güldenzopf: Vieles, was den Online-Wahlkampf 2008 sichtbar gemacht hat, gab es 2004 noch nicht: Youtube und Twitter waren noch nicht da. Facebook war gerade erst gegründet worden. Die wirkliche Revolution waren jedoch die Datenbanken, wie sie spätestens seit 2004 zum Einsatz kommen.
Gerade im deutschen Wahlkampf ist kritisiert worden, dass die Internetkampagnen unecht und hölzern wirkten. Gibt es Kandidaten, für die das Internet im Wahlkampf eher von Nachteil ist?
Güldenzopf: Internet hin oder her, nicht jeder ist ein Obama. Er ist ein absolutes Ausnahmetalent als Politiker und passt perfekt ins Internet. Dennoch glaube ich nicht, dass es einen Kandidaten gibt, der das Internet nicht erfolgreich nutzen kann. Es ist – gerade in Deutschland – viel wichtiger, Datenbanken zu haben, Unterstützer und Parteimitglieder online zu informieren, einzuladen und Argumente zu liefern, als Will-I-Am irgendwelche Lieder singen zu lassen. Nicht jeder Kandidat muss einen Podcast machen, um ein Internetkandidat zu sein. Es reicht, wenn er beispielsweise eine ordentliche Facebook-Seite hat und E-Mail sowie Newsletter richtig nutzt.
Ist weniger manchmal mehr?
Güldenzopf: Könnte man so sagen. Authentizität ist das Schlüsselwort. Man kann natürlich üben, mit dem Internet als visuellem Medium umzugehen, aber wenn es nicht passt, muss man es nicht machen. Ich glaube, man sollte sich auf das konzentrieren, was man kann.
Es ist einfach, über das Internet an einer politischen Kampagne teilzunehmen, jedoch deutlich schwieriger, die Politik wirklich zu beeinflussen. Besteht darin die Gefahr, die Bürger zu enttäuschen?
Nelson: Ja. Das ist immer eine Gefahr. Ein Teil des Problems ist, dass Menschen während des Wahlkampfs aufgrund verschiedenster Themen zusammenkommen und es unmöglich ist, es ihnen allen Recht zu machen. Die Politik wird also immer einige ihrer aktivsten Unterstützer desillusionieren. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Regierung und Wahlkampf, und es ist eine sehr große Hürde, die Begeisterung aus dem Wahlkampf in den Regierungsalltag zu übertragen. Ich selbst war während der Bush-Administration an derartigen Versuchen beteiligt.
Am 2. November finden in den USA Zwischenwahlen statt: Könnte die demokratische Partei die Mehrheiten im Kongress verlieren?
Nelson: Die Möglichkeit besteht, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie die Mehrheit im Senat verlieren werden, da vorwiegend demokratische Staaten neue Senatoren wählen. Um die Kontrolle im Repräsentantenhaus zu erlangen, müssten die Republikaner 39 Sitze hinzugewinnen. Sogar Obamas Sprecher Robert Gibbs hat gesagt, dass das passieren könnte – und meiner Meinung nach wird es auch so kommen. Es wäre interessant, zu erfahren, wie Obama bei einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus oder im Senat versucht, seine Politik durchzusetzen.
Güldenzopf: Man wird das erste Mal messen können, wie die Leute auf den Präsidenten Obama reagieren und nicht auf den Kandidaten. Mit Blick auf den Golf von Mexiko und die Gesundheitsreform kann man sagen, dass das Internet da nicht allzu sehr geholfen hat. Das Bohrloch war ja nicht schneller zu, nur weil man einen Internetpräsidenten hatte. Ich bin gespannt, was gerade die kleineren Kampagnen, wie für den Kongress oder Gouverneursposten, an Ideen und Instrumenten zeigen werden – denn für seine nationale Kampagne hat Obama ja fast 700 Millionen Dollar ausgegeben.
Erwarten Sie von den Wahlen in den USA neue Trends, die auch für Deutschland interessant sind?
Güldenzopf: Wir werden uns die Zwischenwahlen jedenfalls sehr genau anschauen. So ein Prozess der Ernüchterung tut nach 2008 sicher allen gut. Was die Parteien mit begrenztem Budget machen, wie sie es schaffen, Wähler zu mobilisieren, das wird zwar nicht die Zeitungen oder die Blogs füllen, aber das Fachpublikum wird sehr genau hinschauen.
Abgesehen vom Repräsentantenhaus und Teilen des Senats werden im Herbst auch 36 Gouverneure gewählt. Werden die Gouverneurswahlen eher von lokalen Themen bestimmt oder sind auch sie Referenden über den amtierenden Präsidenten?
Nelson: Bei den Wahlen in den Bundesstaaten spielt auch deren Finanzlage eine große Rolle. Aber die generelle Stimmung wird das Ergebnis der Gouverneurswahlen definitiv beeinflussen. Die Republikaner werden von der Schwäche der Demokraten auf Bundesebene profitieren können. Es wird aller Voraussicht nach große Zugewinne geben.
In einer Podiumsdiskussion haben Sie gesagt, dass Wut eine sehr motivierende Kraft ist. Motivierender als Zufriedenheit?
Nelson: Ja.
Bedeutet das, dass Obamas Gesundheitsreform eher republikanische Wähler motiviert als demokratische?
Nelson: In den aktuellen Umfragen sieht man große Unterschiede in der Wahlbegeisterung der Parteianhänger. Es gibt viele Demokraten, die von Obama enttäuscht sind. Er hat einiges getan, um seine Wähler zu demotivieren.
Güldenzopf: Es ist nicht so, dass alle Demokraten glücklich mit der Gesundheitsreform sind. Nicht nur die Republikaner rechts außen haben Probleme mit der Reform.
Nelson: Das stimmt. Es gibt eine große Unzufriedenheit bei den Demokraten. Wenn es die nicht gäbe, wären die Abstände in den Umfragen nicht so groß.
Von Unzufriedenheit profitiert auch die Tea-Party-Bewegung ist. Wie einflussreich ist diese Gruppe?
Nelson: Sie sind einflussreich und haben es geschafft, viele Leute zu motivieren, aktiv zu werden und sich zu engagieren. Viele Mitglieder der Tea-Party sind sehr unzufrieden mit beiden politischen Parteien. Es ist kein homogener Zusammenschluss von Republikanern, sondern ein Bündnis von Menschen, die sehr stark auf das Problem der Staatsausgaben und die wachsende Staatsverschuldung fokussiert sind. Meiner Meinung nach ist die Beteiligung dieser Menschen am politischen Prozess eine gute und gesunde Sache für eine demokratische Gesellschaft. Wenn es den Parteien aber nicht gelingt, die Unzufriedenheit dieser Leute zu lindern, könnte das allerdings das Zwei-Parteien-System destabilisieren. Aber das ist eine langfristige Entwicklung.
In Deutschland geht immer wieder das Gespenst einer konservativ-liberalen Partei rechts von der CDU um. Kann die Union aus den Entwicklungen in den USA lernen und die Unzufriedenen stärker einbinden?
Güldenzopf: Es wird auf jeden Fall genau hingeguckt. Aber die Tea-Party-Bewegung ist ja noch keine eigene Partei. Es gibt viele Republikaner, die sich als Tea-Party-Kandidat sehen. Was dort gefordert wird, sind eigentlich ureigenste Werte der Republikaner. Von daher gehe ich davon aus, dass es in den USA eher ein Flügel der Republikaner wird und keine eigene Partei. Man muss solche Strömungen allerdings, genau wie in Deutschland, ernst nehmen und einbinden. Dann gewinnen sowohl die Engagierten als auch die Partei.
Beeinflusst das Auftauchen der Tea-Party-Bewegung die Kampagnenarbeit der Republikaner? Ist es schwierig, sowohl die Mehrheit anzusprechen als auch diejenigen, die diese allgemeine Unzufriedenheit spüren?
Nelson: Ich denke nicht. Die Themen, die die Tea-Party-Anhänger motivieren, sind momentan mehrheitsfähig im Land. Wenn die Tea-Party sich an einem umstrittenen Thema orientieren würde, wäre das ein wirkliches Problem für republikanische Kandidaten. Die Tea-Party ist in einigen Staaten und Distrikten so wichtig, dass republikanische Kandidaten auf ihre Forderungen reagieren müssen. Sie müssten sich dann entscheiden, ob sie die Partikularinteressen der Tea-Party-Anhänger oder die breite Schicht ihrer anderen Wähler enttäuschen wollen. Aber das Problem sehe ich bei dieser Wahl noch nicht.
Was ist das Hauptthema der Zwischenwahlen? Ist es die Wirtschaft oder geht es eher um ideologische Fragen?
Nelson: Die Umfragen zeigen, dass das Hauptthema Arbeitsplätze sind. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei etwa zehn Prozent. Die inoffizielle Arbeitslosenquote hingegen liegt bei fast 20 Prozent. Auch die Staatsausgaben spielen eine große Rolle. Viele Leute glauben, dass wir das Land finanziell ruinieren, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wirtschaft und Arbeit sind die beiden wichtigsten Themen, die Reduzierung der Staatsausgaben kommt direkt danach.
Ist es möglich, dass die Zwischenwahlen einen republikanischen Kandidaten als Favorit für die Kandidatur bei der Wahl 2012 hervor bringen?
Nelson: Nein. Ich denke dass es dafür zu früh ist. Momentan gibt es ein paar potenzielle Kandidaten, die durchs Land ziehen, für sich werben, Geld sammeln. Aber die Republikaner sind aktuell sehr auf die Zwischenwahlen 2010 fokussiert, und ich denke, dass das auch genau der Fokus ist, den die Partei haben sollte.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Raus aus der Mühle – Warum Politiker zurücktreten. Das Heft können Sie hier bestellen.