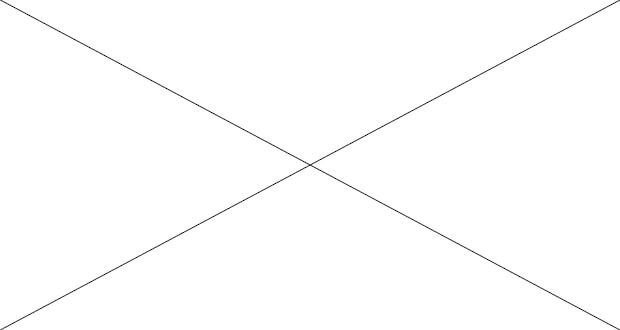Der Parteitag in Leipzig war ein voller Erfolg für die CDU. Die Partei zeigte sich geschlossen, Angela Merkel rief die Union zum wirtschaftlichen Reformmotor des Landes aus und grenzte sie scharf von der politischen Konkurrenz ab. Mitglieder und Mandatsträger waren geeint in dem Wissen um eine christdemokratische Identität. Die CDU war ganz bei sich – und voller Zuversicht für die kommende Bundestagswahl. Das war im Jahr 2003.
In diesem November fand erneut ein CDU-Parteitag in Leipzig statt, doch die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Partei hat sich von alten christdemokratischen Gewissheiten verabschiedet: die Wehrpflicht ausgesetzt, das Elterngeld eingeführt, den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Auf dem Parteitag stimmen die Delegierten für ein „Lohnuntergrenze“ genanntes Mindestlohn-Modell und die Reform des dreigliedrigen Schulsystems.
Keine Leidenschaft
Vom neoliberalen Reformeifer des Jahres 2003 ist nicht viel geblieben. Während Merkel damals in ihrem Werben für die Kopfpauschale, die Bierdeckel-Steuerreform und einen flexiblen Arbeitsmarkt polarisierte, bemüht sie sich heute, niemandem weh zu tun. Am Ende ihrer Rede erhält sie pflichtschuldig minutenlangen Applaus von den Delegierten – Leidenschaft kommt in der Leipziger Messehalle jedoch nicht auf, weder bei Merkel, noch bei ihren Zuhörern. Eine sachliche Arbeitsrede habe die Kanzlerin gehalten, sagen nachher diejenigen, die es gut mit ihrer Parteichefin meinen.
Die Botschaft der Kanzlerin ist klar: Die Volkspartei CDU ist für alle wählbar. Was auf den ersten Blick beliebig wirkt, folgt einem klaren Muster. Denn politische Konfrontationen rufen nur allzu leicht Emotionen hervor. Das mobilisiert die eigenen Anhänger – allerdings auch die des politischen Gegners. Und daran hat die Kanzlerin kein Interesse. Denn zwischen den beiden Leipziger Parteitagen liegen nicht nur acht Jahre, sondern auch zwei Bundestagswahlen, aus denen Merkel ihre Lehren gezogen hat.
2005 war die Union haushohe Favoritin, die SPD schien weit abgeschlagen. Merkel setzte auf klare Kante und wirtschaftsliberale Themen – das Ergebnis: Die Gewerkschaften liefen Sturm gegen die Reformthesen der CDU-Vorsitzenden, und viele Arbeitnehmer waren verängstigt – die vermeintlich darniederliegenden Sozialdemokraten bekamen Auftrieb. Der Union blieb mit einem Prozent Vorsprung auf die SPD letztlich nur der Weg in die Große Koalition.
Diffuse Wohlfühlpolitik
„Emotionen sind für die Union im Wahlkampf eine große Gefahr“, urteilt der Chef des Umfrageinstituts TNS Emnid, Klaus-Peter Schöppner. Deshalb tue Merkel gut daran, Themen mit Emotionalisierungspotenzial möglichst klein zu halten, so der Demoskop.
Vor der Bundestagswahl 2009 ist ihr das gelungen. Merkel führte einen Kuschelwahlkampf: nicht zuspitzen, nicht festlegen, keine Angriffsflächen bieten. Stattdessen bot sie eine diffuse Wohlfühlpolitik für alle an. Das Ergebnis: Trotz Verlusten von 1,4 Prozent konnte sie ihre damalige Wunschregierung aus CDU/CSU und FDP bilden. Anders als noch 2005 fanden die Sozialdemokraten kein Thema, mit dem sie ihre Wähler mobilisieren konnten.
In dieser Strategie – von Politikwissenschaftlern asymmetrische Demobilisierung genannt – scheint die Kanzlerin ihre Taktik für den kommenden Bundestagswahlkampf gefunden zu haben. Dass sie plötzlich ihre Leidenschaft für den Mindestlohn entdeckt hat, glaubt Merkel-Biograph Gerd Langguth nicht. Mit dem Vorstoß habe die Kanzlerin vielmehr ein unangenehmes Thema bereinigt, bei dem die SPD die Union hätte vor sich her treiben können, so der Bonner Politikwissenschaftler: „Die CDU hat die SPD und die Grünen mit ihren Entscheidungen zum Mindestlohn und der Energiewende ein Stück weit entwaffnet.“
Aus wahltaktischer Sicht sei diese Entscheidung richtig gewesen, sagt Langguth. Denn eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition liegt in weiter Ferne – Union und FDP kommen in Umfragen derzeit auf nicht einmal 40 Prozent der Stimmen. Aber: Rot-Grün hätte den Demoskopen zufolge ebenfalls keine Mehrheit. Sollte die FDP bis zur kommenden Wahl die Kurve kriegen und die Piraten ihren Höhenflug fortsetzen, wären sechs Parteien im Bundestag vertreten. Die Koalitionsoptionen wären merklich eingeschränkt – insbesondere, da die Piratenpartei und die Linke derzeit nicht koalitionsfähig seien, wie Klaus-Peter Schöppner bemerkt. Das kommt Merkel entgegen. Ihr Kalkül ist einfach: Sollte die Union stärkste Kraft werden, kann nicht gegen sie regiert werden. So könnte sich Merkel womöglich als Kanzlerin einer Großen Koalition – oder einer schwarz-grünen Koalition – in eine dritte Amtszeit retten.
Gefährliche Gratwanderung
Doch die vermeintlich sichere Wahlstrategie entpuppt sich mehr und mehr als gefährliche Gratwanderung, die sich 2013 bitter rächen könnte. Indem Merkel sämtliche konservativen Stolpersteine aus dem Weg räumt, demobilisiert sie zunehmend die eigenen Anhänger. „Früher konnte ich aus dem Stegreif fünf Gründe aufzählen, die CDU zu wählen – das geht heute nicht mehr“, sagt eine Delegierte aus Baden-Württemberg am Rande des Parteitags. Ein Delegierter aus Nordrhein-Westfalen, der seit vielen Jahren auf kommunaler Ebene für die Partei aktiv ist, ergänzt: „Manchmal weiß selbst ich nicht genau, warum ich die Union wählen soll.“ Der Unmut über die Aufgabe des konservativen Markenkerns sei an der Basis permanent zu spüren, versichern viele Teilnehmer des Parteitags.
Das bleibt auch den Mandatsträgern nicht verborgen. Jens Spahn, gesundheitspolitischer Sprecher der Unions-Fraktion, spürt eine große Verunsicherung an der Basis. Er findet die Positionsveränderungen der vergangenen Monate allerdings richtig – und er glaubt, auch die Anhänger der Partei von diesem Kurs überzeugen zu können. „Die Menschen an der Basis sind keine Kernkraft-Fanatiker“, sagt Spahn, „aber sie erwarten zu Recht, dass wir ihnen erklären, warum wir unsere Meinung ändern.“ Der Abgeordnete wünscht sich mehr und offenere Diskussionen innerhalb der Partei: „Das wäre gut für die CDU, für unsere Anhänger und für die Ergebnisse.“
Doch das ist in der Merkel-CDU eher Ausnahme als Regel – auch auf dem Parteitag bleiben kontroverse Diskussionen aus. Anstatt die Partei behutsam auf Veränderungen vorzubereiten, verteidigt die CDU-Führung ihre Positionen bis zuletzt eisern, um deren Aufgabe schlussendlich als alternativlos und selbstverständlich zu postulieren. Christean Wagner, Fraktionsvorsitzender der CDU im hessischen Landtag, verweist in diesem Zusammenhang auf Mindestlohn, Energiewende und Hauptschule. „Dort haben wir innerhalb kürzester Zeit jahrzehntelange Positionen aufgeben – ohne intern ausreichend darüber zu diskutieren. Das hält keine Partei aus.“
Die Auswirkungen dieser Politik spürt Wagner direkt vor Ort. In seinem Kreisverband sind bereits Mitglieder ausgetreten. Von ihnen höre er immer öfter, die CDU sei nicht mehr ihre Partei. „Eine andere Partei wollen die gar nicht wählen“, sagt Wagner, „aber die CDU eben auch nicht mehr.“ Asymmetrische Wählerdemobilisierung nennt er einen „Angriff auf den gesunden Menschenverstand“. Er fordert: „Wir sollten uns weniger um SPD- und Grünenwähler und mehr um unsere eigenen Anhänger kümmern.“ Die seien der Partei in Scharen davongelaufen.
„Die CDU hat erstmals ein Nichtwählerproblem“, sagt auch Emnid-Chef Schöppner. Das liege daran, dass die Partei ihren Markenkern vernachlässige: „Gerade in Zeiten von Entpolitisierung und oberflächlicher Betrachtung bietet er den Wählern eine wichtige Richtschnur“, so Schöppner. Außerdem, so der Demoskop, schütze ein intakter Markenkern die Partei davor, dass die Konkurrenz mit kurzfristig aufkommenden Themen punkten kann: „Je stärker der Markenkern, desto weniger anfällig ist eine Partei für Agenda-Setting.“ Wo vor einigen Jahren der konservative Kern der Union lag, ist heute jedoch ein großes Loch.
Wunsch nach heiler Welt
Anstatt eigene Akzente zu setzen, reagiert die CDU hauptsächlich auf äußere Einflüsse. Anfang November beschwerte sich ein Nutzer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter beim Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Peter Altmaier, über den Schlingerkurs der Union. Das Mitglied der Schwesterpartei CSU schrieb, dass er an den Infoständen heute zum Teil das Gegenteil dessen vertreten müsse, wofür er vor vier Jahren geworben habe. „Wehrpflicht war KT, Kernkraft war Fukushima, Lohnuntergrenze ist Basis. Euro ist Griechenland“, fasste Altmaier die Volten der Partei lapidar zusammen und hängte zum Zeichen des Bedauerns einen traurigen Smiley an.
Dabei wäre eine klare Linie dringender geboten denn je. Je komplexer und komplizierter die Fragen, desto einfachere Antworten wünschen sich die Mitglieder an der Basis. Denen nimmt der Bundestagsabgeordnete Michael Fuchs den Wind aus den Segeln: „Die Menschen wollen eine heile Welt, aber die kann ihnen die Politik nicht liefern.“ Auch den Vergleich mit dem Leipziger Parteitag aus dem Jahr 2003 lässt er nicht gelten: „Von 2003 bis heute hat sich die Welt ein paar Mal um sich selbst gedreht und die politischen Veränderungen sind den neuen Realitäten geschuldet.“ Den vielbeschworenen Markenkern sieht Fuchs nicht beschädigt.
In diese Kerbe schlägt auch Thomas Strobl, Bundestagsabgeordneter und CDU-Chef in Baden-Württemberg: In der CDU gebe es keine heiligen Kühe oder Heilsideologien. Das unterscheide die Partei wohltuend von linken Dogmatikern. „Wenn die Welt sich verändert, verändert sich auch die Union – das war schon immer eine Stärke der CDU“, so Strobl. Eine Verletzung des Markenkerns kann auch er nicht erkennen. Seine Argumentation: Beim Modell der Lohnuntergrenze würden die Tarifpartner gestärkt, und in der Bildungspolitik setze sich die Union deutlich von der Einheitsschule ab. Also alles im Lot? Nicht ganz. „Viele Mitglieder sind verwirrt über den Kurs der Partei“, räumt Strobl ein. Umso wichtiger sei es zu kommunizieren, zu diskutieren und zu erklären, so der baden-württembergische Parteichef.
Keine konservativen Ausputzer
Dass das Reservoir an CDU-Stammwählern immer mehr austrocknet, liegt nicht allein an Angela Merkel, sondern auch daran, dass es der Union an Integrationsfiguren mangelt. „Der Union fehlen konservative Ausputzer, die die Seele der Parteibasis streicheln“, urteilt Gerd Langguth. „Die Konservativen vermissen bei Merkel die Orientierung.“ Früher hätten Typen wie Alfred Dregger oder Friedrich Merz diese Funktion ausgefüllt – heute ist diese Flanke verwaist. „Angela Merkel ist eine pragmatische, unideologische Problemlöserin“, so der Politikwissenschaftler. Die Kunst eines CDU-Politikers sei es, Wechselwähler zu gewinnen – und die Stammwähler trotzdem zu halten. Die Kanzlerin sei im Gewinnen jedoch deutlich besser als im Halten.
Wenn mehr alte Anhänger gehen als neue dazu kommen, steht die Union vor einem Problem. Kann die CDU ihre einstigen Stammwähler nicht mehr mobilisieren, droht der Partei ein Überbietungswettbewerb mit der politischen Konkurrenz um die Gunst der Wechselwähler. Den kann sie nur um den Preis der Selbstaufgabe gewinnen. Die Delegierten auf dem Leipziger Parteitag sind sich dieser Gefahr bewusst: „Der CDU hat es noch nie gut getan, die SPD links zu überholen“, sagt eine Teilnehmerin. Ein anderer ist sich sicher: „Einen Linksschwenk nehmen die Bürger der Union sowieso nicht ab.“
Ihre größte Sorge ist, dass sich die Partei nicht mehr ausreichend von der politischen Konkurrenz abhebt. Sie teilen den Wunsch Christean Wagners, die Union möge sich mehr auf die eigenen Stärken konzentrieren und diese offensiv vertreten. Bislang nimmt die Kanzlerin darauf wenig Rücksicht. Merkels Taktik – aus der Schwäche der Anderen Kapital zu schlagen – steht allerdings auf tönernen Füßen. Selbst wenn sie es schaffen sollte, die Union 2013 wieder in die Bundesregierung zu führen, gefährdet sie mit ihrem Kurs auf Dauer die Schlagkraft der CDU. Sie wäre nicht die erste Bundeskanzlerin, die ihre Partei durch den Verlust großer Teile der Stammklientel in eine lange, tiefe Krise stürzt.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Kretschmann – Politiker des Jahres. Das Heft können Sie hier bestellen.