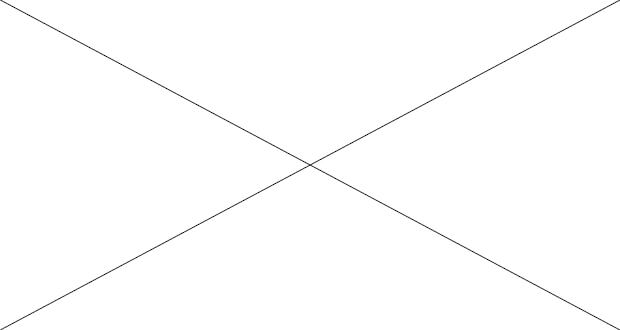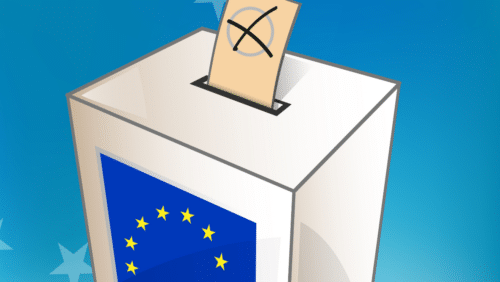p&k: Herr Botschafter, wir wollen mit Ihnen über den „American Dream“ reden. Hat sich Ihr persönlicher Traum erfüllt, als Sie oberster Vertreter der USA in Deutschland geworden sind?
Philip Murphy: Aus beruflicher Sicht: eindeutig. Keine Aufgabe, die ich nach meiner Zeit als US-Botschafter in Deutschland wahrnehmen werde, kann an mein jetziges Amt heranreichen. Es ist eine besondere Ehre. Aus persönlicher Sicht ist meine größte Herausforderung allerdings, ein guter Vater zu sein. Meine Frau und ich haben vier Kinder, die noch sehr jung sind. Das ist eine Aufgabe, über die ich mir ständig Gedanken mache, und die mich noch viele Jahre beschäftigen wird.
Sie sind seit 2009 US-Botschafter, kennen die Deutschen mittlerweile gut. Der Begriff „German Angst“ steht im Ausland für eine angeblich typisch deutsche Eigenschaft: die Verzagtheit. Haben die Deutschen genügend Träume?
Wenn mich Leute fragen, was mir an Deutschland am besten gefällt, sage ich ihnen, dass mich das Land an die USA erinnert. Bei den Vorlieben und Charakterzügen haben beide Länder viele Gemeinsamkeiten. Historisch verbindet uns Vieles. Denken Sie nur daran, dass Amerikaner mit deutschen Wurzeln die größte Bevölkerungsgruppe in den USA darstellen. Klar gibt es Unterschiede: Das politische System ist ein ganz anderes, Geld spielt im Wahlkampf eine viel größere Rolle als in Deutschland. Doch sowohl Präsident Obama als auch Bundeskanzlerin Merkel verdeutlichen, dass es in beiden Ländern möglich ist, von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Natürlich haben beide Länder ihre eigene Geschichte, ihre eigene Kultur, ihren eigenen Stil. Aber die Biografien von Barack Obama und Angela Merkel zeigen: Beide hatten Träume – und beide haben sie verwirklicht.
Bleiben wir bei Barack Obama: Während seiner sechstägigen Europa-Reise Mitte Mai besuchte er Irland, Großbritannien, Frankreich und Polen: Warum ließ er Deutschland aus?
Auf diese Frage habe ich mich gefreut. Lassen Sie mich noch einmal kurz aufzählen, wie oft Präsident Obama in Deutschland war: 2008 besuchte er Berlin als Kandidat – ein Auftritt, der vielen Deutschen in Erinnerung geblieben ist. Im ersten Jahr seiner Amtszeit hat er Deutschland zwei Mal besucht, bei keinem anderen US-Präsidenten war das der Fall. Dazu kommt, dass er Bundeskanzlerin Merkel Anfang Juni zu einem Staatsbankett ins Weiße Haus eingeladen hat, um ihr die Freiheitsmedaille zu überreichen. Aus politischer Sicht war das eine ganz besondere Ehre.
Das heißt, es gibt keine Krise in der deutsch-amerikanischen Beziehung?
Der Präsident hätte kein Staatsbankett veranstaltet, wenn er für Deutschland oder Angela Merkel nicht den größtmöglichen Respekt empfinden und sie als wichtige Partnerin in Europa einschätzen würde.
Mit Obamas Amtsvorgänger George W. Bush verstand sich Angela Merkel aber anscheinend besser.
Das kann ich nicht beurteilen. Was ich weiß, ist: Präsident Obama und Kanzlerin Merkel verstehen sich großartig. Journalisten berichten gern über angebliche Krisen.
Oft heißt es, in Deutschland gebe es nicht mehr genug Transatlantiker. Treffen Sie noch häufig Politiker, die sich um diese Beziehung kümmern?
Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, an der Geburtstagsfeier von Ruprecht Polenz teilzunehmen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Er ist jemand, der sich ganz besonders um die transatlantischen Beziehungen kümmert. An der Feier nahmen rund 40 Politiker teil, nicht nur aus der CDU, sondern aus allen Parteien. Dazu kam, dass dort alle Generationen vertreten waren. Kerstin Müller von den Grünen beispielsweise sowie Peter Beyer und Philipp Mißfelder von der CDU. Das sind drei Politiker, die – auf ihre Karrieren bezogen – noch mehr Zeit vor als hinter sich haben. Ich konnte auf dieser Feier nichts von einer transatlantischen Müdigkeit erkennen. Dazu kommt, dass die USA und Deutschland mehrere Austauschprogramme haben, an denen auch ältere Politiker teilnehmen. Und auch die hochrangige Delegation, die Angela Merkel mit nach Washington genommen hat, verdeutlichte, wie stark die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind.
Die transatlantische Verbindung ist heute nicht mehr so zwingend wie noch im Kalten Krieg. Was tun Sie, um die Partnerschaft zu stärken?
Zum Glück ist es so, dass viele aktuelle Entscheidungsträger in Deutschland – in der Politik, der Wirtschaft und der Kultur – in ihrem bisherigen Leben viele positive Erfahrungen mit den USA gemacht haben. Wir wollen sichergehen, dass das auch auf die nächste Generation zutrifft. Wir diskutieren daher über Mittel, wie wir diese Partnerschaft weiter stärken können. Da haben wir nicht nur das Hier und Jetzt im Blick, sondern auch die Entscheidungen, die die nächste Generation betreffen.
Welche Mittel sind das?
Wir versuchen, Schüler und Jugendliche zu erreichen, die noch nicht auf der Welt waren, als die Mauer fiel. Sie müssen lernen, warum die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland so besonders sind. Das ist manchmal nicht einfach. Als es die Mauer noch gab, verdeutlichte die schiere Präsenz der amerikanischen Streitkräfte, was Westdeutschland und die USA miteinander verband. Ein 17-Jähriger musste mit seiner Hand nur die Mauer anfassen, um das zu verstehen. Heute beschäftigen wir uns mit globalen und abstrakten Problemen, die weit außerhalb Deutschlands liegen. Doch wir haben einen Vorteil.
Und der wäre?
Unser Präsident. Die Jugendlichen lieben Barack Obama, sie sind fasziniert von ihm. Wenn ich einen Klassenraum betrete, und der Lehrer stellt mich als US-Botschafter vor, also als Präsident Obamas Gesandter in Berlin, habe ich 80 Prozent von dem, was ich erreichen will, schon geschafft.
Die Wikileaks-Veröffentlichungen Ende des vergangenen Jahres waren eine Belastungsprobe für die deutsch-amerikanische Partnerschaft. Führte das zu einem Vertrauensverlust?
Nein, das tat es nicht. War der Vorfall peinlich und dumm? Ja. Waren unschuldige Leute betroffen? Auch das. Aber mittlerweile hat sich der Rauch verzogen, und die Leute erkennen wieder, dass wir hier sind, um unsere Arbeit zu erledigen. Unser Haus funktioniert wie jede andere Botschaft auch. Letztlich haben die Dokumente vor allem verdeutlicht, wie wir arbeiten, und dass unsere Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Wir versuchen täglich, ein großes Puzzle aus vielen kleinen Einzelstücken zusammenzusetzen.
An der Art, wie Sie arbeiten, hat sich seitdem nichts verändert?
Nein, für mich persönlich hat sich nichts verändert, und auch für unsere Arbeit ganz allgemein nicht. Sicherlich hat es einige Zeit gedauert, bis wir die Gespräche wieder so vertrauensvoll wie vor den Veröffentlichungen führen konnten. Der Stand heute ist: Wir gehen wieder ganz normal unserer Arbeit nach.
Vor Ihrer Zeit als US-Botschafter waren Sie 23 Jahre lang als Investmentbanker für Goldman Sachs tätig. War es schwierig, die Sprache der Diplomatie zu erlernen?
Nicht wirklich. Das liegt daran, dass ich während meiner Zeit bei Goldman Sachs viel mit Kunden zu tun hatte. Den persönlichen Kontakt zu Menschen liebe ich. Ob als Investmentbanker oder als Botschafter: Der Umgang muss immer ehrlich und respektvoll sein. Es ist also nicht so, dass ich mich für meine Aufgabe als US-Botschafter groß hätte verändern müssen. Neu ist jedoch, dass ich es nun mit einer Vielzahl von Themen zu tun habe.
Wie sehr helfen Ihnen die sozialen Medien, mit den Deutschen in Kontakt zu kommen? Die US-Botschaft ist auf Facebook, Twitter und Youtube zu finden …
… und auch ich habe eine persönliche Facebook-Seite. Es hilft uns vor allem, mit Jugendlichen zu kommunizieren. Natürlich erreichen wir mit einer Twitter-Nachricht auch viele Erwachsene, aber in erster Linie wollen wir uns damit mit der nächsten Generation austauschen. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Es ist wie im Sport: Wir müssen mit den Jugendlichen auf ihren Spielfeldern in Kontakt treten.
Bleiben wir beim Sport, Herr Botschafter. Sie sind ein leidenschaftlicher Fußball-Anhänger. Wo werden Sie am 26. Juni sein?
Hoffentlich werde ich abends im Olympiastadion sein, um mir das Eröffnungsspiel der Frauen-WM, Deutschland gegen Kanada, anzuschauen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Querdenker – Zwischen Fraktionszwang und Gewissen. Das Heft können Sie hier bestellen.