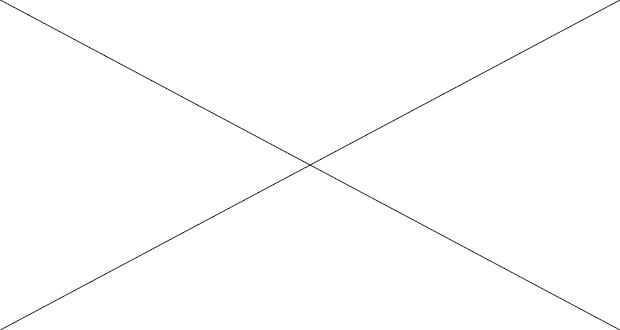p&k: Herr Daschle, Sie waren über 20 Jahre lang Senator, zehn Jahre standen Sie der demokratischen Fraktion vor – als Mehrheits- und als Minderheitenführer: Was waren die größten politischen Herausforderungen?
Tom Daschle: Es war oft schwierig, den US-Kongress und das Land in Krisenzeiten zusammen zu halten. Nach den Anschlägen vom 11. September ist uns das gut gelungen. Für mich persönlich war der Anthrax-Anschlag auf mein Büro im Jahr 2001 eine große Herausforderung.
Als Fraktionsvorsitzender mussten Sie die demokratische Partei auf eine politische Linie bringen – und mit den Republikanern kooperieren. Was ist Ihnen schwerer gefallen?
Es kam auf die Sache an. Ich hatte große Schwierigkeiten, meine Fraktion bei dem Irak-Einsatz auf eine einheitliche Position einzuschwören. Die Partei war damals in zwei gleich große Lager gespalten: Die eine Hälfte befürwortete den Einsatz, die andere lehnte ihn ab. Mit den Republikanern dagegen war es schwer, in Budgetfragen zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel bei den Steuerplänen des ehemaligen Präsidenten George W. Bush. Diese sahen massive Einschnitte bei den Steuereinnahmen vor. In dieser Frage war es einfach, die Demokraten auf eine Linie zu bringen. Die von der Bush-Regierung letztlich durchgesetzten Steuersenkungen hielt ich damals für einen Fehler – und tue das noch immer.
Barack Obama wollte Sie 2008 als Gesundheitsminister in sein Kabinett holen. Aufgrund von Steuerproblemen konnten Sie den Posten nicht antreten. Haben Sie den Präsidenten während der Gesundheitsreform trotzdem beraten?
Ja, wir waren deswegen oft in Kontakt. Wirklich gebraucht hat er meine Hilfe jedoch nicht, schließlich hat er mit Gesundheitsministerin Kathleen Sebelius eine sehr gute Ratgeberin an seiner Seite.
Sie sind ein ausgewiesener Gesundheitsexperte. Es muss für Sie schmerzhaft gewesen sein, nicht selbst an der Verabschiedung der Gesundheitsreform beteiligt gewesen zu sein.
Jeder erlebt Rückschläge im Leben. Es kommt jedoch nicht darauf an, wie oft man hinfällt, sondern wie oft man wieder aufsteht. Ich habe großes Glück, dass ich weiterhin am politischen Prozess teilnehmen und diesen mitgestalten kann.
Der Oberste Gerichtshof der USA befasst sich zurzeit mit der Verfassungsmäßigkeit der Gesundheitsreform. Befürchten Sie, dass die Reform scheitert?
Ich bin vorsichtig optimistisch, dass der Oberste Gerichtshof in unserem Sinne entscheiden wird. Der maßgebliche Faktor in diesem Fall ist die Frage der Trennbarkeit: Ist die Reform auch dann verfassungsgemäß, wenn die Richter einen bestimmten Teil als verfassungswidrig bezeichnen? Ich persönlich gehe davon aus.
Im Sommer konnten sich Demokraten und Republikaner lange nicht auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze einigen; der Regierung drohte die Zahlungsunfähigkeit. Können die Amerikaner ihren Politikern noch vertrauen?
Es gab vor kurzem eine interessante Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup. Das Institut hatte Bürger gefragt, was ihnen wichtiger ist: dass sich ihr Kongressabgeordneter auf einen Kompromiss einlässt, oder dass er auf seiner Position beharrt. Das Ergebnis war ein Patt. Politiker sollten also an ihren Prinzipien festhalten, aber auch in der Lage sein, Kompromisse einzugehen. Das ist die einzige Form, in der verantwortungsvolles Regieren funktionieren kann.
Im Wahlkampf 2008 hatte Barack Obama stets betont, überparteilich regieren zu wollen. Konnte er dieses Ziel erreichen?
Nein, leider nicht.
Sind die heutigen US-Politiker überhaupt noch in der Lage, überparteilich zusammenzuarbeiten?
Das wird sich zeigen. Die amerikanische Bevölkerung ist der Polarisierung überdrüssig. Sie will mehr politische Zusammenarbeit und fordert, die Grabenkämpfe zu beenden. Ich denke, dass die Wähler ihre Repräsentanten in Zukunft abstrafen werden, wenn sie weiterhin so polarisierend agieren.
Nach aktuellen Umfragen sind weniger als die Hälfte der Amerikaner mit Obamas Amtsführung zufrieden. Was machte er falsch?
Das Entscheidende ist, dass die USA in der schwersten Wirtschaftskrise seit 80 Jahren stecken. Als Obama im Januar 2009 Präsident wurde, befand sich das Land in einer furchtbaren wirtschaftlichen Situation. Mit seinem Kabinett musste er zunächst viel Energie aufwenden, um die Probleme abzuarbeiten, die sich in drei, vier Jahren angehäuft hatten. Viele Amerikaner haben auf schnelle Erfolge gehofft – die bei den gravierenden Problemen jedoch schwer zu erzielen waren. Dazu kommt: Die Republikaner lassen jegliche Unterstützung für Obama vermissen, sie zeigen keinen Willen, mitzuregieren. Die USA haben ein Präsidialsystem, das überparteiliche Zusammenarbeit voraussetzt. Davon konnte ich in den vergangenen Jahren jedoch nichts sehen.
Sie sind ein langjähriger Unterstützer und Förderer Obamas. Wie wurden Sie auf ihn aufmerksam?
Auf Barack Obama wurde ich 2003 aufmerksam, als ich Fraktionsvorsitzender der Demokraten im Senat war. Wir haben damals gute Kandidaten für die Senatswahl im folgenden Jahr gesucht. Jemand schlug vor, ich solle Barack fragen, ob er an einer Kandidatur interessiert sei. Wir trafen uns das erste Mal in seiner Heimatstadt Chicago. Als er seine Wahlkampagne startete, halfen wir uns gegenseitig. Obama gelang der Einzug in den Senat, ich jedoch verlor meinen Sitz. Er übernahm viele meiner Angestellten, und ich hielt den Kontakt zu ihm aufrecht. In seinen ersten Jahren als Senator war ich so etwas wie ein inoffizieller Berater.
Würden Sie sich als Freunde bezeichnen?
Oh ja, selbstverständlich.
Das heißt, Freundschaften in der Politik sind möglich.
Das finde ich schon. Ich hatte viele Freunde in der Politik. Interessanterweise sind zwei meiner besten Freunde Republikaner: Bob Dole und Trent Lott.
Viele US-Medien sprechen Obama eine der Qualitäten, durch die sich ein US-Präsident auszeichnen muss, zurzeit ab: die Fähigkeit zu führen.
Da kann ich nicht zustimmen. Obama hat als Präsident eindeutig bewiesen, dass er führen kann. Ein gutes Beispiel dafür war die Reaktion der USA auf den Aufstand in Libyen. Dort haben wir erfolgreich agiert.Sprechen wir über die Führungsrolle von Präsidenten, gilt ganz allgemein: Der Präsident kann durch seinen engen Zeitplan nur begrenzt auf den Kongress einwirken. George W. Bush definierte seine Führungsrolle oft diktatorisch: Beispiele dafür sind sein Vorgehen, den Senat vom Irak-Einsatz zu überzeugen, und seine Eingriffe in die Privatsphäre der Bürger nach den Anschlägen des 11. September. Obama dagegen geht partnerschaftlich mit dem Kongress um. Viele kritisieren das, und auch ich denke manchmal, dass der Präsident konfrontativer auftreten sollte. Aber das ist eben nicht sein Führungsstil.
Eine persönliche Frage zum Schluss: Ihre Vorfahren sind zwei Mal ausgewandert. Zunächst aus Deutschland ans Schwarze Meer, in die heutige Ukraine, im Anschluss in die USA. Haben Sie sich ausführlicher mit Ihren europäischen Wurzeln beschäftigt?
Ich hatte bereits die Gelegenheit, mit meiner Frau und mit meinen Kindern Deutschland zu besuchen. In die Ukraine haben wir es noch nicht geschafft. Jedoch recherchiert mein Sohn viel über unsere Vorfahren und plant zurzeit, in die Ukraine zu fahren.
Sprechen Sie denn Deutsch?
Ich verstehe die Sprache, selbst sprechen fällt mir hingegen schwer. Meine Großeltern sprachen kein Englisch. Waren sie zu Besuch, haben meine Eltern mit ihnen Deutsch gesprochen. Ich selbst bereue es, die Sprache nie gelernt zu haben. Als Jugendlicher wäre es mir bestimmt leichter gefallen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Überleben – Krisenkommunikation für Politiker. Das Heft können Sie hier bestellen.