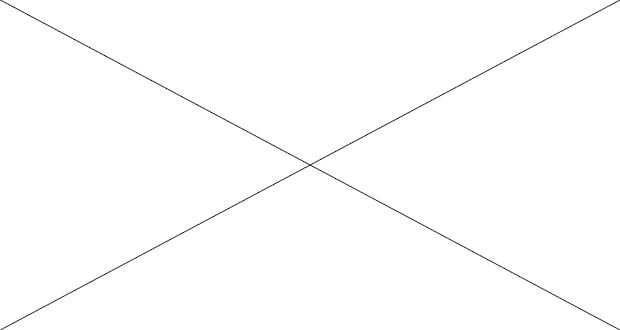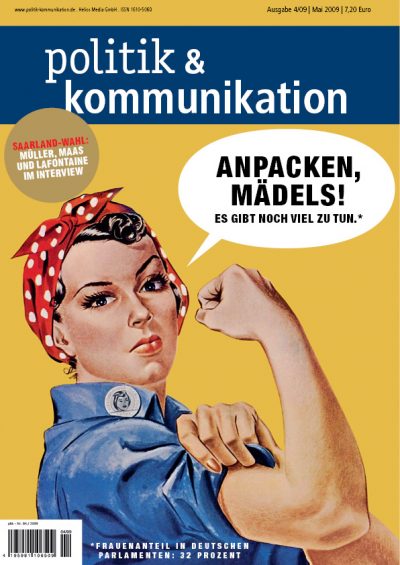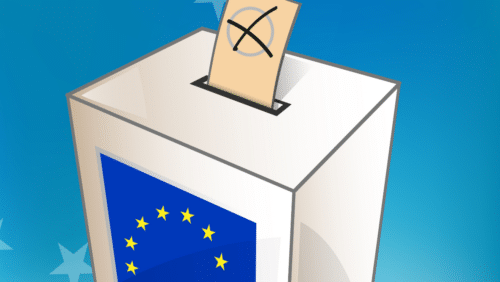Es ist ein gutes Jahr, um Geschichte zu schreiben in Deutschland. Am 23. Mai bestimmt die Bundesversammlung in Berlin, wer in den nächsten fünf Jahren als Staatsoberhaupt im Schloss Bellevue wohnen darf: Horst Köhler oder Gesine Schwan. Vier Monate vor der Bundestagswahl kommt es zwischen Union und SPD zu einem vorgezogenen Duell. Die Republik erwartet eine der spannendsten Präsidentschaftswahlen aller Zeiten. Und trotz der Dramatik entscheidet sich an diesem Tag doch viel mehr. 90 Jahre, nachdem in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt wurde und vier Jahre, nachdem Angela Merkel ins Bundeskanzleramt einzog, stimmt die Versammlung auch darüber ab, ob zum ersten Mal zwei Politikerinnen an der Spitze der Republik stehen sollen.
Wie weit Deutschland beim Thema Frauen in der Politik bereits gekommen ist, zeigt ein Rückblick: Während des Bundestagswahlkampfs 1998 bezeichnete der damalige SPD-Spitzenkandidat Gerhard Schröder die spätere Ministerin Christine Bergmann als „zuständig für Frauen und das ganze andere Gedöns“. Der Ausrutscher des späteren Bundeskanzlers verfestigte seinen Ruf als Macho, der sich um die Themen Frauen und Gleichberechtigung wenig kümmert. Nach dem Wahlsieg versuchte er gegen diesen Vorwurf anzukämpfen und berief fünf SPD-Ministerinnen in sein Kabinett, drei Jahre später kam die heutige Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Renate Künast, dazu. Obwohl Schröder den Anteil der Ministerinnen gegenüber seinem Vorgänger Helmut Kohl von zwei auf sechs spürbar erhöhte, reagierten viele Beobachter enttäuscht und sprachen von einem symbolischen Akt. Der Grund: noch immer waren „harte“ Schlüsselressorts wie Auswärtiges, Finanzen und Arbeit in Männerhand.
Harte Männer, weiche Frauen?
Die Diskussion, welches Ressort „hart“ und welches „weich“ ist, und ob eine Politikerin dafür geeignet ist, gibt es seit 1961. Damals ernannte Konrad Adenauer die Juristin Elisabeth Schwarzhaupt zur Gesundheitsministerin. Die Juristin war die erste Frau im Amt eines Bundesministers. Auch nach Schwarzhaupt blieb die Gesundheit ein Ressort, das die Regierungschefs gerne mit Frauen besetzten. Familie und Jugend sowie Bildung und Wissenschaft kamen später dazu.
Rita Süßmuth, die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestags, stand von 1985 bis 1988 einem dieser Ressorts vor. Zunächst war Süßmuth Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, 1986 kam auch das Thema Frauen dazu. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, dass auch im Auswärtigen Amt oder Verteidigungsministerium eine Frau an der Spitze stehen könne, sagt die CDU-Politikerin: „Das dürfte keine Frage sein. Jedoch werden die Barrieren in diesem Bereich noch keineswegs verschwunden sein.“ Süßmuth, Ehrenvorsitzende der Frauen-Union, musste sich während ihrer Amtszeit oft gegenüber skeptischen Männern durchsetzen. „Insbesondere dann, wenn es um sehr prekäre Dinge wie beispielsweise Aids ging.“ Als sich Anfang der achtziger Jahre auch Deutsche mit der Krankheit infizierten, hätten ihr viele eine zu weiche Politik vorgeworfen. Süßmuth: „Ich habe oft den Eindruck bekommen, dass die Öffentlichkeit den Männern dort eine härte Gangart zutraute als mir.“
Im Gespräch mit Süßmuth zeigt sich, wie groß die Widerstände für Politikerinnen in den achtziger Jahren waren. In einem Jahrzehnt, das vom Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan, dem Nato-Doppelbeschluss und der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl geprägt wurde, trauten Wähler und Parteigremien eher Männern zu, das Land zu führen. Die Grünen, 1980 gegründet, traten dagegen mit einer Frauenquote an. Laut Satzung wollte die Partei „Parteigremien, Vorstand, Kommissionen und besonders die Wahllisten“ möglichst paritätisch mit Frauen und Männern besetzen. Die Quote sorgt bis heute dafür, dass viele Frauen bei den Grünen leichter Karriere machen können. Das zeigt sich bei der Grünen-Fraktion im Bundestag: Über 50 Prozent der Abgeordneten sind weiblich – keine andere Fraktion erreicht diesen Wert. Trotzdem stößt die Regel bei vielen Frauen auf Ablehnung. Im 21. Jahrhundert, so wird argumentiert, dürfe der Vorwurf der „unqualifizierten Quotenfrau“ nicht länger existieren. Mittlerweile müssten sich Frauen genau wie Männer über Leistung definieren.
Irmingard Schewe-Gerigk, frauenpolitische Sprecherin und parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, verteidigt die Quote. „Wir brauchen sie auch weiterhin. Die Quote ist keine Frauenförderung, sondern ein Instrument, um die Geschlechterdemokratie zu erreichen.“ Schewe-Gerigk setzt sich mit ihrer Partei dafür ein, dass es auch in der Wirtschaft, beispielsweise in den Aufsichtsratsgremien börsennotierter Unternehmen in Deutschland, eine solche Regel gibt. „Die Wirtschaftskrise ist auch eine Krise der Männer“, sagt die Grünen-Politikerin und fügt an, dass Deutschland die Krise als Chance nutzen solle, überkommene Strukturen zu überwinden. Mehr Frauen in den Aufsichtsräten seien ein Gebot guter Unternehmensführung. Schewe-Gerigk sagt, dass mehr Frauen in Führungspositionen bereits die Politik positiv verändert hätten. „Sie haben einen anderen Blick und hinterfragen Regelungen stärker.“
Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Elke Ferner, befürwortet die 40-Prozent-Geschlechterquote ihrer Partei. Heute. Als Ferner 1983 der SPD beitrat, war das noch nicht der Fall. „Ich habe sehr schnell gesehen, dass vielen gut qualifizierten Frauen ein männlicher Kollege vorgezogen wurde“, sagt sie. Die Quote habe das verändert und dafür gesorgt, dass mehr Politikerinnen Einfluss bekämen und die Macht, etwas durchzusetzen. Ferner: „Ich merke, dass sich in Gremien, in die mehrere Frauen eingezogen sind, die Stimmung spürbar verändert.“ So würden auch Unterschiede zu Politikern deutlich: „Männer melden sich oft zu Wort, weil sie denken, dass sie es müssen. Bei Frauen ist das nicht so, sie arbeiten ergebnis- und sachorientierter“, sagt die ASF-Vorsitzende.
Das ist für Ferner nicht der einzige Unterschied. „Frauen vernetzen sich zu wenig.“ Wenn Politikerinnen Netzwerke aufbauten, unterscheide sich das von der Art, wie Männer Kontakte knüpfen, pflegen und nutzen. „Bei Männern erinnert das eher an Seilschaften, bei Frauen stehen gemeinsame Ziele im Vordergrund“, sagt die SPD-Frau. Max Höfer, Autor des Buchs „Meinungsführer, Denker, Visionäre“, stimmt Ferner zu: „Die Fähigkeit, Seilschaften zu bilden, ist eine typisch männliche Eigenschaft. Es ist ein natürliches Verhalten.“ Höfer hat im vergangenen Jahr für das Politikmagazin „Cicero“ eine Liste der 100 einflussreichsten Frauen in Deutschland erstellt. 2006 und 2007 untersuchte er, wer die wichtigsten Denker in Deutschland waren. Er sagt, dass Frauen keine Strippenzieherinnen seien. „Sie müssen mutiger sein und Autoritäten in Frage stellen“, sagt Höfer. Angela Merkel ist für ihn ein Beispiel, wie das geht. Zum Beispiel 1999: Ein Jahr, nachdem der damalige CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble sie zur Generalsekretärin gemacht hatte, empfahl Merkel ihrer Partei in einem Artikel für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ die Abnabelung von Helmut Kohl. Damit brach sie zwar mit ihrem ehemaligen Förderer, an der Basis aber punktete sie. „Sie beweist: Frauen können Kanzler“, sagt Höfer.
Die CDU-Vorsitzende zeigte mit ihrem Aufstieg aber auch, dass Politikerinnen durchaus fähig sind, Netzwerke zu knüpfen. Denn im Bundeskanzleramt hatte Merkel zu Beginn ihrer Amtszeit gleich vier Frauen aus der eigenen Partei um sich geschart: ihre Büroleiterin Beate Baumann, ihre Medienberaterin Eva Christiansen sowie die Staatsministerinnen Maria Böhmer und Hildegard Müller. Die Frauen gehören seit Jahren zu Merkels engsten Vertrauten, schnell sprachen die Medien von einem „Girlsclub“. Dass Müller im Oktober vergangenen Jahres aus dem Club ausschied und als Hauptgeschäftsführerin zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft wechselte, überraschte zunächst. Klar ist: Müller hat Ruhe in die oft lärmende Energiebranche gebracht und ihrer ehemaligen Chefin damit ein politisches Problem abgenommen.
Patricia Riekel ist seit 1997 Chefredakteurin des People-Blatts „Bunte“ und hat in dieser Zeit viele deutsche Politikerinnen näher kennengelernt. Für Riekel zeigt Merkels Aufstieg vor allem eins: „Frauen gehen bei ihrer Karriere sehr zielstrebig und geräuschlos vor. Ein ganz großer Unterschied zu den Testosteron-Politikern, die wir sonst haben.“ Riekel sagt, dass sich vor allem durch die erste deutsche Bundeskanzlerin das Bild der Politikerin stark verändert habe. „Merkel konnte die ‚gläserne Decke’ durchbrechen, die für viele Frauen in Deutschland noch immer das Ende ihrer Karrieren bedeutet“, sagt die Journalistin. Geschafft habe das die CDU-Politikerin nicht nur durch Machtwillen und Netzwerke, sondern auch typisch weibliche Eigenschaften wie Kommunikations- und Verhandlungsgeschick oder Einfühlungsvermögen. Riekel: „Merkel hat eine weibliche Intuition für eine Gesprächssituation. Sie kümmert sich um Dinge, über die Männer sonst lachen würden.“ So habe ihr die Bundeskanzlerin einmal gesagt, dass sie bei Gesprächen auch darauf achte, dass genügend Tassen und Kekse bereitstünden. „Sie weiß, wie wichtig eine gute Atmosphäre für den Ausgang eines politischen Gesprächs sein kann.“
Riekel sagt, dass Politikerinnen heute aber nicht nur auf diese weiblichen Eigenschaften setzen sollten. Wenn Frauen in der Politik vorwärts kommen wollten, müssten sie sich auch den Medien gegenüber öffnen. „Der normale Bürger versteht die Abgeordneten oft nicht mehr. Er will nicht mehr zuhören, das langweilt ihn.“ Scheitern Politiker inhaltlich, können sie immer noch aufs Optische setzen. Bilder zählen. Im April 2008 bewies Angela Merkel, wie schnell eine Politikerin in Deutschland mit ihrem Image punkten kann. Bei einer Opernpremiere in Oslo betrat sie den roten Teppich mit einem tief ausgeschnitten Abendkleid und sorgte dafür, dass Deutschland tagelang über ihr Dekolleté und die überraschend offen zur Schau gestellte Weiblichkeit diskutierte. Riekel: „Wir leben in einer ‚Telekratie’. Die Erscheinung muss vermittelbar sein, die Person sympathisch.“ Ein kurzer Blick ins Private sei immer hilfreich.
Für Helga Lukoschat von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) ist Merkels Aufstieg ein erfolgreicher Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Die EAF-Geschäftsführerin sagt, dass sich seit den neunziger Jahren „viel in Deutschland getan hat, wenn es um Frauen in Parlamenten und Führungspositionen geht.“ Jedoch sei Deutschland bei der Gleichstellungspolitik noch immer „konservativ und auf Beharrung aus“. Lukoschat führt als Beleg die Quote von weiblichen Abgeordneten im deutschen Bundestag und in den Länderparlamenten an. Im Bundestag beträgt die Frauenquote 32 Prozent, in den 16 Bundesländern sitzen durchschnittlich 31,6 Prozent Frauen im Parlament. Lukoschat: „Frauen sind noch lange nicht gleichberechtigt in der Politik vertreten, davon sind wir streckenweise weit entfernt.“ Besonders besorgniserregend sei die Situation auf kommunaler Ebene: Von den hauptamtlichen Bürgermeistern seien nur um die fünf Prozent weiblich, bei den Oberbürgermeistern 15 Prozent. „Dort herrscht großer Nachholbedarf“, sagt sie.
Reflexhaftes Zusammenzucken
Die EAF hat sich deshalb mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zusammengetan und im September 2008 die Kampagne „Frauen-Macht-Kommune“ gestartet. Noch bis Mai schickt das Ministerium dabei einen roten Teppich als „Symbol für den Weg von Frauen in die Politik“ quer durch die Republik. Für Rita Süßmuth setzt die Kampagne an der richtigen Stelle an. „Frauen, die in ihren Kommunen Erfahrungen mit der Politik machen und möglicherweise abgeschmettert werden, sind nicht mehr motiviert, sich zu engagieren.“ Ein gefährlicher Trend für Süßmuth. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir bei der Gleichberechtigung von Frauen in der Politik in den nächsten Jahren eher mit Rückschlägen zu rechnen haben. Da müssen wir widerstehen und entgegenarbeiten.“
Das Familienministerium versucht mit seiner Kampagne dagegen anzukämpfen. Es ist dabei nicht nur wegen der politischen Zuständigkeit der ideale Partner für die Frauenkampagne. An der Spitze des Ministeriums steht eine Frau, die seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2005 das Politikerinnenbild in Deutschland stark verändert hat: Ursula von der Leyen. Die CDU-Politikerin konnte sich, seit sie 2003 Mitglied der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag wurde, in einem erstaunlichen Schnelldurchlauf bis an die Spitze des Familienministeriums in Berlin arbeiten. Von der Leyen sah sich dabei heftiger Kritik aus dem konservativen Lager ihrer Partei ausgesetzt. Die siebenfache Mutter begann nach ihrem Amtsantritt schnell damit, das verstaubte Familienbild der Union aufzufrischen: Elterngeld, Ausbau der Krippenbetreuungsplätze und gleiche Chancen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
Von der Leyen steht mit ihrem privilegierten Familienhintergrund nicht für die Karriere von „Lieschen Müller“, der Durchschnittsfrau in Deutschland. Trotzdem zeigt die Familienministerin, wie sich Politikerinnen verhalten müssen, um in der deutschen Mediendemokratie punkten zu können: glaubwürdig.
Loni Lüke ist Medien- und Karriere-Coach in Berlin und berät Politikerinnen, wenn sie ihr Auftreten in der Öffentlichkeit verbessern wollen. Lüke sagt, dass das ein Trend sei, „der sich erst in den letzten Jahren entwickelt hat“. „Für Frauen ist vor allem wichtig, dass sie sich klar und eindeutig ausdrücken.“ Während des Trainings versucht sie ihren Kundinnen zu verdeutlichen, welche Verhaltensmuster sie beispielsweise unter Druck zeigen und wie sie diese verändern können. Lüke sagt, dass viele Frauen zwar gelernt hätten, „sicherer, klarer und entschiedener“ aufzutreten, im Unterbewussstsein sei der Machtanspruch aber noch nicht verankert. „Ein Satz wie Gerhard Schröders ‚Ich will da rein!‘ würde einer Frau nicht über die Lippen kommen.“ Für Politikerinnen geht es darum, das richtige Verhältnis zwischen weiblichem Verhandlungsgeschick und männlichen Verhaltensmustern zu finden. Eine schwierige Aufgabe. „Männer geben Frauen oft unfair verpackte Komplimente“, sagt Lüke. Viele würden dann reflexartig zusammenzucken und mädchenhaft wirken.
Rita Süßmuth kann sich an so ein unfair verpacktes Kompliment gut erinnern. „Es war an einem meiner Geburtstage“, sagt sie, „als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl feststellte: ‚Was sie nicht mit Argumenten durchbekommt, macht sie einfach mit weiblichem Charme.“ Als Lob habe Süßmuth das keinesfalls empfunden. Doch die Politikerin konterte damals: „Ich wäre sehr froh darüber, wenn die Männer wenigstens Charme hätten, wenn ihnen die Argumente ausgehen.“
Die Anekdote macht klar: Politikerinnen wie Süßmuth mussten sich den Respekt gegenüber ihren männlichen Kollegen erstreiten. Im Gespräch mit der FDP-Bundestagsabgeordneten Miriam Gruß zeigt sich, dass den heutigen Politikerinnen solche Kämpfe erspart geblieben sind. Auf die Frage, ob sie im Lauf ihrer Karriere einmal das Gefühl hatte, sich als Politikerin stärker als ihre männlichen Kollegen beweisen zu müssen, sagt sie: „Den Unterschied habe ich nicht gespürt. Es kommt auf die Qualität der Leistung an.“ Gruß, die einen vierjährigen Sohn hat, sitzt seit 2005 für die FDP im Bundestag und ist seit Mitte Februar dieses Jahres auch Generalsekretärin der bayerischen Liberalen. Die Zeit für die Familie ist dadurch knapp geworden. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss noch verbessert werden“, sagt Gruß. Die FDP-Abgeordnete kann sich nur deshalb voll auf ihre politischen Aufgaben konzentrieren, weil sie sich mit ihrem Mann und ihrer Familie abspricht. In Berlin helfen Kollegen aus ihrem Büro und der Fraktion. Wenn sie einmal an einer Sitzung nicht teilnehmen könne, bekäme sie von Kollegen erzählt, was passiert sei. „Als Mutter werde ich im Bundestag nicht stigmatisiert.“
Auch Marianne Tritz weiß, vor welchen Herausforderungen Mütter im deutschen Parlament stehen. Tritz saß von 2002 bis 2005 für die Grünen im Bundestag, im März 2008 wechselte sie als Geschäftsführerin zum neu gegründeten Deutschen Zigarettenverband. „Die Politik ist nicht unbedingt kinderfreundlich“, sagt sie. Für eine Mutter sei die Pendelei zwischen Berlin und dem Wahlkreis stressig und für die Familie nur sehr schwer zu akzeptieren. „Ich weiß, dass ich bei meinen Kindern einiges verpasst habe.“ Als Lobbyistin habe sich die Situation „verändert“, verbessert will Tritz nicht sagen. „Ich habe zwar mehr Freiräume, dafür aber auch mehr Termine.“ Es bleibe für sie weiterhin schwierig, berufliche Termine, die Ansprüche ihrer Tochter und so simple Dinge wie „Was kochen wir zum Abendessen?“ zur Zufriedenheit aller zu organisieren. Für Tritz aber nicht nur ein Nachteil: „So etwas erdet auch.“
Druck auf die Parteien wächst
Für Politikerinnen sind Karriere und Familie eine schwierig zu vereinbarende Kombination. Aber wie ist die Situation in der Politik? Gibt es heute noch Kräfte, die die Gleichberechtigung von Frauen verhindern wollen? „Ich denke schon“, sagt Helga Lukoschat von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. „Es gibt alteingesessene Kreise in den Parteien, die an den bisherigen Strukturen nichts ändern wollen. Der eigene Machterhalt steht im Vordergrund.“ Wie können Frauen dann die „gläserne Decke“, die sie am Aufstieg in politische Spitzenämter hindert, durchbrechen? Lukoschat: „Dabei spielen die Parteien eine wichtige Rolle. Sie müssen sich öffnen, Plattformen für engagierte Bürger werden.“ Es gehe um ein neues Politikverständnis und andere Wege der Rekrutierung. Die Parteien müssten damit aufhören, ihren – meist männlichen – Nachwuchs nur über die eigenen Netzwerke zu rekrutieren. „Da reproduziert sich das alte System nur selbst.“ Ein gutes Beispiel dafür ist der Andenpakt der CDU. 1979 hatten einige aufstrebende Mitglieder der Jungen Union den Pakt gegründet – und sich politische Loyalität geschworen. Die Mitglieder des Bunds, unter ihnen Christian Wulff, Peter Müller und Franz Josef Jung, sind in hohe Ämter gelangt. Für Lukoschat ist klar: Erst wenn es solche Karrieremöglichkeiten in den Parteien nicht mehr gibt, können mehr Frauen den Sprung an die Spitze schaffen.
Bei Patricia Riekel, der „Bunte“-Chefredakteurin, hört sich die Antwort auf die Frage, was für eine Politikerin auf dem Weg nach oben wichtig ist, anders an. „Es muss ihr egal sein, ob sie geliebt wird. Erst dann hat sie es geschafft.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Anpacken, Mädels! Es gibt noch viel zu tun.. Das Heft können Sie hier bestellen.