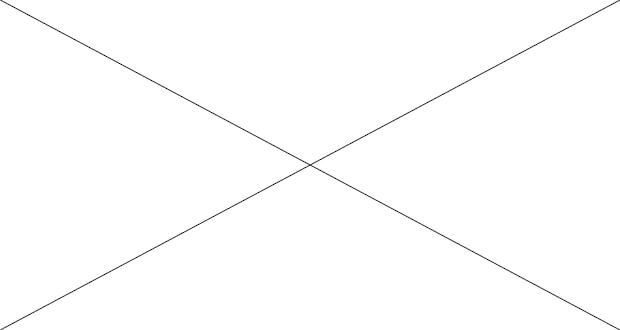Ein gelungenes, sprachlich einfaches, verständliches und schönes Gesetz ist ein handwerklich ausgezeichnetes Kunstwerk“, hat der Verfassungsrechtler Ulrich Karpen einmal festgestellt. Dies ist auch insofern ein passender Vergleich, als sich über Kunst nicht weniger trefflich streiten lässt, als dies über Umfang und Güte der Gesetzgebung regelmäßig der Fall ist. Übereinstimmung wird man gewiss darin finden, dass ein gutes Gesetz sich dadurch auszeichnet, nicht nur für den professionellen Rechtsanwender, sondern auch für den Laien verständlich zu sein. Bei anderen Bewertungskriterien hingegen fangen in der Praxis die Probleme an. Denn ob Gesetze zielsicher, vollständig, systemgerecht und vor allem notwendig sind, ist zuerst eine politische Frage.
Von mir ist natürlich kein Zertifikat „guter Gesetzgebung“ zu erwarten. Ich möchte jedoch einige Hinweise zu verbreiteten Klischees über Quantität und Qualität der deutschen Gesetzgebung geben. Bei der Klage über den deutschen Paragraphendschungel wird gerne übersehen, dass die Überregulierung nicht allein dem Gestaltungsehrgeiz des Gesetzgebers geschuldet ist. Es kommt hier eine paradoxe Haltung der deutschen Öffentlichkeit zum Ausdruck. Denn die Forderung der Bürger und der Medien nach gesetzlicher Regelung bis ins kleinste Detail ist, wenn es um die eigenen Interessen geht, mindestens ebenso ausgeprägt wie die allgemeine Kritik an der Regulierungswut. Immerhin: In der 16. Legislaturperiode wurden beim Bundestag beziehungsweise Bundesrat insgesamt 970 Gesetzesvorhaben eingebracht, von denen das Parlament am Ende 616 Gesetze verabschiedet hat. Im gleichen Zeitraum wurde die Gesamtzahl der Gesetze und Verordnungen aber um 16 Prozent verringert. Damit gibt es nun etwas weniger Regulierung als vorher.
Und die Qualität? Sie lässt sich weniger eindeutig messen, doch bestätigen konkrete Zahlen das übliche Lamento nicht. So hat etwa das Bundesverfassungsgericht seit 1951 durchschnittlich weniger als acht Bundesnormen pro Jahr beanstandet, auch wenn dieser Befund das Parlament selbstverständlich nicht von seiner Pflicht entbindet, sich in jedem Fall mit größter Sorgfalt um verfassungsgerechte Gesetze zu bemühen. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Pflicht zur Beobachtung der Gesetzesfolgen. Mit dem Nationalen Normenkontrollrat wurde deshalb 2006 eine Einrichtung geschaffen, welche die Bundesregierung dabei unterstützt, durch Gesetze verursachte Bürokratiekosten zu reduzieren. Wichtige Beiträge zum vorausschauenden Abwägen von Chancen und Risiken bei forschungs- und technologiebezogenen Entscheidungen leistet bereits seit 1990 das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, betrieben von einem Institut der Helmholtz-Gemeinschaft.
Eine solche Beteiligung von Sachverstand aus der Wissenschaft, aber auch aus der Wirtschaft und Gesellschaft, zur Vorbereitung staatlicher Entscheidungen in der Exekutive wie der Legislative ist eine Errungenschaft postfeudaler Zeiten. Sie ist nicht zu beanstanden und ganz sicher kein Skandal; die Auslagerung an externe Einrichtungen dagegen schon. Mit Gesetzen sei es wie mit Würstchen, soll Otto von Bismarck einmal gesagt haben: „Es ist besser, wenn man nicht sieht, wie sie gemacht werden.“ Mit den Transparenzvorstellungen moderner parlamentarischer Demokratien ist dies aber nicht vereinbar. Der Eindruck, die Gesetzgebung als zentrale staatliche Aufgabe werde immer häufiger und möglichst unauffällig an Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen und Gutachter abgetreten oder ausgelagert, stärkt die Autorität der Verfassungsorgane nicht, weder nach innen noch nach außen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Sensibilität insbesondere auf Seiten des Parlaments gestiegen ist. Das hat etwa bei der raschen Ausarbeitung des Begleitgesetzes zum Lissabon-Vertrag gezeigt, was es, auch ohne Federführung eines Ministeriums, leisten kann.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Schlechte Gesetze – dank Lobby, Hektik und Symbolpolitik. Das Heft können Sie hier bestellen.