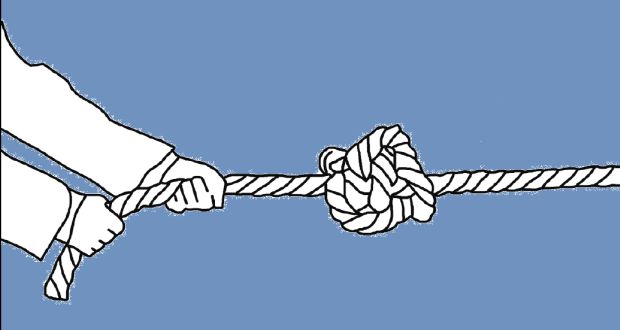Die Stimmen sind ausgezählt und die Wunden geleckt; die politische Landschaft stellt sich neu auf. Mit dem Ende des Wahlkampfjahres wird ein neues Kapitel in der Bundespolitik aufgeschlagen. Doch bevor die gesamte politische Landschaft in die Routinen der Regierungsarbeit oder der Oppositionspolitik eintauchen kann, müssen die Grundlagen für das Regierungshandeln und den parlamentarischen Betrieb, letztlich für das gesamte politische Geschäft in den kommenden vier Jahren, in einem Koalitionsvertrag festgelegt werden. Ein Koalitionsvertrag fixiert, was sich aus den Machtverhältnissen und dem Verhandlungsgeschick ergibt. Er ist keine Summe unter einer komplizierten Rechnung. Er ist das Ergebnis einer Reihe subjektiver und objektiver Faktoren sowie Interessenlagen von Parteien und Spitzenpolitikern.
Der Text eines Koalitionsvertrags wird von vielem beeinflusst; auch die aktuelle Stimmungs- und Medienlage spielt natürlich während des Verhandlungsprozesses eine erhebliche Rolle. Aber die Vorbereitungen für den neuen Koalitionsvertrag beginnen schon zwei Jahre früher. Eine wesentliche Quelle für dessen Inhalte ist das Regierungshandeln beziehungsweise das „Nicht-Handeln“ der Vorgängerregierung. Im Laufe einer Legislaturperiode ist eine Regierung mit einem endlosen Strom von Initiativen, Problemen, Krisen und guten Ideen konfrontiert. Aus den unterschiedlichsten Gründen kann nicht alles behandelt werden, und manches verfällt dann der Diskontinuität. Es gibt also am Ende jeder Legislaturperiode eine lange Liste von Projekten, die sowohl vom handelnden Spitzenpersonal als auch von der Exekutive, der Ministerialbürokratie, auf in die nächste Wahlperiode verschoben wird. Spätestens anderthalb Jahre vor einer Bundestagswahl setzt sich mehr und mehr die Haltung durch „Das schaffen wir nicht mehr, das müssen wir in der nächsten Legislaturperiode anpacken“.
Neben dieser To-do-Liste, die aus dem überbordenden Arbeitsvolumen einer Regierung entsteht, gibt es einen weiteren Zustrom für den neuen Koalitionsvertrag. Dieser speist sich aus den grundlegenden politischen Konfliktlinien zwischen den politischen Parteien oder auch aus den komplizierten Verhältnissen zwischen Bund und Ländern. Man kommt zu dem Schluss, dass das Erreichen eines wichtigen politischen Ziels unter den gegebenen Machtverhältnissen nicht realistisch ist und verschiebt das Projekt auf die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl. Man unterstellt dabei eine Erhöhung der eigenen Durchsetzungskraft in der Zukunft. Oder man macht diesen Punkt zu einer Grundbedingung für eine Koalitionsverhandlung. Die CSU hat daraus eine eigene Kunstform entwickelt (Maut, Obergrenze et cetera).
Natürlich spielt der Programmprozess in allen Parteien eine große Rolle. Wobei in den vergangenen Jahren immer weniger die Frage im Zentrum stand: Was wollen wir beim Regieren tun? Es dominiert mehr und mehr die Fragestellung, wie ein Programm zu einer attraktiven Sammlung von Soundbites wird, die auf Wähler mobilisierend wirken. Hinzu kommt die integrative Funktion von Wahlprogrammen innerhalb der Parteien. Ein Beispiel: Die Labour-Führung um Tony Blair war überzeugt, dass die Partei eine Modernisierung durchlaufen müsse, um bei den Wahlen im Jahre 1997 eine Chance auf Erfolg zu haben. Der Weg dorthin war die „Road to Manifesto“. Die Parteispitze hat damals ein programmatisch modernes Angebot gemacht und es innerparteilich – nicht ohne erhebliche Konflikte – durchgesetzt. Sie verschaffte sich damit auch ein inhaltliches Mandat für den politischen Kurswechsel nach der gewonnenen Wahl.
Neben den übrig gebliebenen Aufgaben aus der vorangegangenen Legislaturperiode, grundlegenden Profilierungspunkten der Parteien sowie den Aufgaben, die aus dem Wahlprogramm entstehen, kommen weitere programmatische Impulse für den Koalitionsvertrag aus der Arbeit der Fraktionen und durch Interventionen (Wahlprüfsteine) verschiedener Interessengruppen. Und das Ganze wird noch ergänzt durch unzählige Dossiers, die in Vorbereitung auf die Koalitionsverhandlungen von unterschiedlichsten exekutiven Ebenen erstellt werden. Mit anderen Worten: Es mangelt wahrlich nicht an Papier.
Aus eigener Erfahrung, aber auch nach der Analyse aktueller Koalitionsverträge sehe ich einen grundlegenden Unterschied zwischen Verträgen, die dominant von der Union, und solchen, die dominant von der SPD verhandelt worden sind. Die SPD ist eine Programmpartei und drängt bei Koalitionsverhandlungen fast immer auf eine Vielzahl konkreter programmatischer Festlegungen. Dies hat nicht nur etwas mit einem natürlichen Misstrauen gegenüber dem potenziellen Koalitionspartner zu tun, sondern es geht dabei auch darum, einer skeptischen Parteibasis schwarz auf weiß Verhandlungserfolge nachweisen zu können.
In der Regel ist der Vertrauensvorschuss der SPD-Basis gegenüber der Parteiführung nicht so weitgehend, wie dies in der Union der Fall ist. Die Union hat ihre Programmatik und Überzeugungen; sie ist aber keine Programmpartei. Ich habe selbst mit einer gewissen Überraschung bei den Koalitionsverhandlungen 2005 feststellen können, wie flexibel die Union sich verhielt. Es gab dort zwar Klarheit, was auf keinen Fall in einem Koalitionsvertrag stehen dürfe, aber es gab zugleich kein verbissenes Kämpfen um eigene Inhalte. Dieser Macht-Pragmatismus hat sich unter der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel seither noch enorm gesteigert.
Die Abwesenheit politisch-inhaltlicher Leidenschaften hat natürlich taktisch einige Vorteile: Man ist gesellschaftspolitisch anschlussfähig in alle Richtungen. Es ist wesentlich, zu verstehen, dass die Union seit 2005 diese Flexibilität in der öffentlich-medialen Wahrnehmung in Gelassenheit und Souveränität umgedeutet hat. Jene, die etwas wollen, wirken unsouverän. Diese psychologische Aufstellung, sollte sie sich bei den Koalitionsverhandlungen 2017 nicht verändern, perpetuiert Dominanz.
Die Kondition
Wenn wir über die persönliche Ebene von Koalitionsverhandlungen nachdenken, ist zunächst wichtig zu beachten, dass hier Menschen in einen wochenlangen, komplizierten Verhandlungsprozess einsteigen, die durch die zurückliegenden Monate schon an ihre physischen Leistungsgrenzen gekommen sind. Wahlkämpfe sind physisch und psychisch sehr anstrengend. Permanenter Stress, Termindruck, Schlafmangel, zu wenig Bewegung, schlechte Ernährung, verschleppte Erkältungen – all das führt nicht unbedingt dazu, dass sich bei Koalitionsverhandlungen eine entspannte Gruppe von Menschen gegenübersitzt. Die persönliche Fitness der Verhandler ist wesentlicher Faktor für den Verlauf der ganzen Operation.
Verhandlungsgeschick
In einer Verhandlung kann es um unterschiedliche Dinge gehen: Es kann darum gehen, jemanden inhaltlich zu überzeugen. Oder man baut eine Position auf, die man bei einer guten Gelegenheit räumt, um dafür etwas Wichtigeres zu bekommen. Härte, Arroganz, Verblüffung, Enttäuschung, Empörung, Werben, Verständnis, Nachgeben – all diese Verhaltensweisen und Emotionen spielen in Koalitionsverhandlungen mal mehr, mal weniger eine Rolle.
Hinzu kommt, dass es sich selten um 1:1-Situationen handelt, sondern Gruppen aufeinandertreffen. Diese haben zuweilen beträchtliche interne Konflikte. Eine Verhandlungsdelegation, die alle Rollen und Haltungen glaubwürdig und zielgenau einsetzen kann, hat erhebliche taktische Vorteile. Bei Koalitionsverhandlungen bestehen Delegationen aus jeweils 30 bis 40 Personen, die miteinander in Verhandlungen sind. Es geht dabei wesentlich um die Verhandlungs-Stringenz der jeweiligen Kerngruppen. Diese bestehen meistens aus den Partei- und Fraktionschefs, wichtigen Stellvertretern oder Ministerpräsidenten und den Generalsekretären. Und nicht zuletzt gibt es meistens innerhalb dieser Gruppe eine Person, die in diesen Fragen erhebliches strategisches und taktisches Geschick hat.
Komplexität
Die Buchhandlungen sind voller Bücher, die erklären, wie man effektiv verhandelt, wie man dafür sorgt, die Karten nicht sofort auf den Tisch zu legen, wie wichtig es ist, die eigenen Ziele nicht gleich am Anfang zu erkennen zu geben. Nur: Diese Ratgeber beschäftigen sich in der Regel mit Verhandlungen, an denen eine überschaubare Zahl von Personen beteiligt ist. Die Medien spielen keine oder nur eine untergeordnete Rolle und es gibt in diesen Büchern auch kein Kapitel darüber, wie man einer wütenden Basis ein mageres Verhandlungsergebnis erklärt. Mit anderen Worten: Die Komplexität von Koalitionsverhandlungen stellt die Verhandlungsführungen vor eine erhebliche Aufgabe. Die Parteien, die in der Lage sind, Komplexität klug zu managen, haben Vorteile und eher die Chance, ihre Verhandlungsziele zu erreichen, als diejenigen, bei denen die Verhandlungsführung eher „Management by Chaos“ ist. Disziplin, Fokus, Nervenstärke und Professionalität sind die entscheidenden Kategorien.
Zeitdruck
Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass alle Verhandler den Zeitdruck gleich empfinden. Die Wahl ist erfolgt, die Öffentlichkeit wartet. Frühzeitig wird ein Zeitplan miteinander verabredet, der genau festhält, an welchen Verhandlungstagen welche Themenbereiche aufgerufen werden, wann über Personal und Finanzen gesprochen wird. Die Parteien legen auch einen unterschiedlich differenzierten Konsultationsprozess mit ihren Mitgliedern fest – die SPD hat beispielsweise 2013 ein Mitgliedervotum durchgeführt. Es liegt in der Natur solcher Verhandlungen, dass nach einer kurzen Phase des Vorgeplänkels zunächst eine ganze Reihe von Konsensthemen abgearbeitet wird. Konfliktpunkte werden beiseite gestellt, vor allen Dingen dann, wenn dort grundlegende Zuständigkeits- und Machtfragen aufgerufen werden. Die langen Verhandlungsnächte kommen zum Schluss. Wenn ein Amtsinhaber eine neue Koalition nicht zustande bringt, diese auf der Zielgeraden scheitert oder unter Umständen am Ende im Parlament entscheidende Stimmen fehlen, ist dies ein erhebliches Risiko für den persönlichen Machterhalt. Dafür gibt es einige Beispiele. Deswegen wendet sich der Zeitdruck in der Schlussphase eher gegen Amtsinhaber. Sie haben das größte Interesse daran, zu einem sauberen Abschluss zu kommen und sind deswegen in dieser Phase druckanfällig.
Hypotheken
Willy Brandts „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ und Helmut Kohls „geistig-moralische Wende“ waren politische Richtungsentscheidungen neuer Koalitionen. Man hat sich dafür entweder begeistert oder daran gerieben. Sie haben aber der politischen Kultur auf jeden Fall gutgetan. Demokratien bleiben lebendig, wenn die politischen Unterschiede nicht taktisch gewählt sind, sondern aus Überzeugungen resultieren.
Alle Parteien sollten sich so früh wie möglich Gedanken darüber machen, wie sie den Verhandlungsprozess und die notwendigen Kompromisse so erklären, dass die Grundüberzeugung dahinter erkennbar wird – und nicht der Eindruck entsteht, es handele sich um beliebige Tauschgeschäfte.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 120 – Thema: Die ersten 100 Tage nach der Bundestagswahl. Das Heft können Sie hier bestellen.