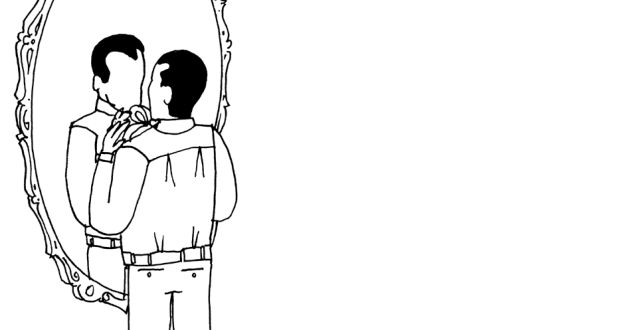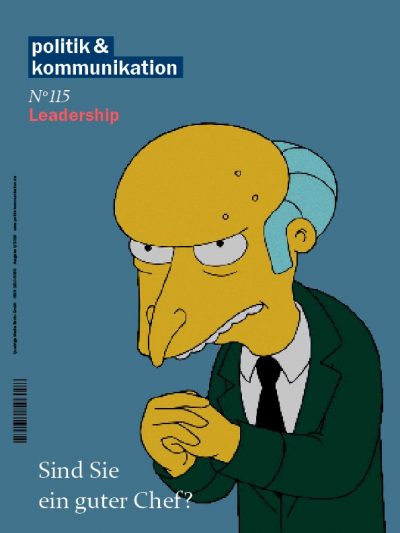„Das hat doch so ’nen langen Bart“, lästert der Kollege, ein Wirtschaftsjournalist, über eine Headline in unserem aktuellen Heft. „Die Zeit der einsamen Helden ist vorbei“, hat Ursula von der Leyen im Interview gesagt und damit den Wandel der Führungskultur beschrieben, über den in der Wirtschaft seit Jahren diskutiert wird. Der bossy Boss und Hierarchien sind out, der sensible Chef und Flexibilität sind in – so kann man das flapsig zusammenfassen. Und nun ätzt der Kollege, diese Erkenntnis sei von gestern? Recht hat er – und Unrecht zugleich. Denn was in der Wirtschaft „so ’nen langen Bart hat“, gilt im politischen Bereich mitunter noch als frisch rasiert. Das hat praktische Gründe.
Man stelle sich vor: Eine Katastrophe bricht aus, und im Krisenstab der Bundesregierung herrscht Basisdemokratie; ein Journalist fragt zum Titelthema über Partei X niemanden aus der Führungsebene an, sondern das erstbeste Parteimitglied, das ihm über den Weg läuft. Hierarchie und Führung sind kein Selbstzweck, sondern dienen in komplexen Gefügen und kritischen Situationen der Handlungsfähigkeit.
Dass Phänomene des Wandels wie der Verzicht auf Hierarchien oder Führen in Teilzeit in der Politik allenfalls Zukunftsmusik sind, hat aber auch etwas mit Beharrungskräften zu tun. Und mit Eitelkeiten. Die sind heute nicht weniger verbreitet als vor Jahren. Wer einen Hang zur Selbstinszenierung hat, kann diesen sogar besser ausleben als früher. Die sozialen Medien sind voller Nutzer, die sich dort regelrecht als Marke inszenieren. Sie signalisieren: „Seht her, ich bin wer!“ Das widerspricht der These, vielen Führungskräften von heute sei es egal, welcher Titel auf ihrer Visitenkarte stehe – Hauptsache, ihr Chef ist cool und ihr Job sinnstiftend.
Abgehobene Chefetagen kommen hierzulande nicht gut an
Dabei hätten wir das Potenzial zu etwas mehr Understatement – glaubt man dem Sozialpsychologen Geert Hofstede. In den Siebzigern befragte er weltweit 116.000 IBM-Mitarbeiter, vom Arbeiter bis zum Topmanager. Er entwickelte ein Modell zur Beschreibung von Kulturen mit vier Dimensionen. Eine davon – die Machtdistanz – gibt an, wie Gesellschaften und Organisationen mit Ungleichheit umgehen. Ein niedriger Wert besagt, dass weniger Mächtige Gleichberechtigung erwarten, ein hoher Wert steht für die Akzeptanz von Ungleichheit. In Deutschland ist die Machtdistanz laut Hofstede niedrig. Dass er seine IBM-Studie auf ganze Kulturen übertrug, ist umstritten. Eine Erkenntnis sollte aber nicht untergehen: Hierzulande kommen abgehobene Chefetagen nicht gut an. Mehr Gelassenheit im Umgang mit der (eigenen) Macht täte der Politik also gut.
Dass der Kollege auf besagte Headline irritiert reagiert, ist symptomatisch für die Unterschiede zwischen Wirtschaft und Politik – und mittelbar auch für die Distanz zwischen Gesellschaft und Eliten. Man muss nicht gleich in Regierung, Parlament und Parteien alle Hierarchien abschaffen und sich statt in inhaltlicher Debatte in gegenseitiger Achtsamkeit üben. Mehr Zurückgenommenheit und die Erinnerung daran, dass Ämter auf Zeit und für einen übergeordneten Zweck verliehen werden, wären ein Anfang.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation II/2016 Leadership. Das Heft können Sie hier bestellen.