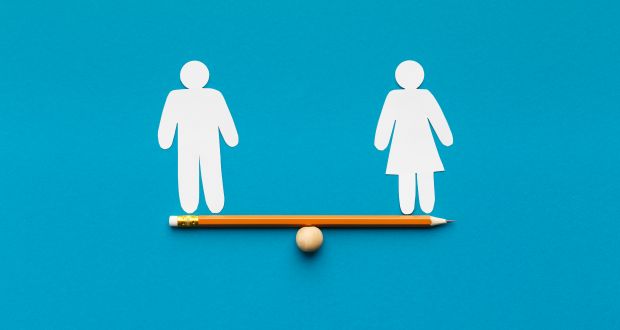In dieser Legislaturperiode des Bundestags ist der Frauenanteil auf 31 Prozent gefallen. So niedrig war er zuletzt nach der Bundestagswahl 1998. Vor diesem Hintergrund findet die Forderung nach einem Paritätsgesetz für Parlamente, wie es jüngst im Brandenburger Landtag beschlossen wurde, zunehmend Anhänger – längst nicht mehr nur in linksliberaler Öffentlichkeit, sondern auch weit in das christdemokratische Milieu hinein. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung auf Basis einer repräsentativen Befragung von circa 20.000 aktiven Mitgliedern aller Bundestagsparteien durch das Institut für Parlamentarismusforschung.
Die Wege zu einer gerechten Geschlechterpräsenz in der Legislative sind jedoch ebenso vielfältig wie umstritten. Kritisch diskutiert werden unter anderem wahl- und parteienrechtliche Ansätze, darunter feste Quoten, sowie finanzielle Anreize im Rahmen der staatlichen Parteienfinanzierung. Dabei ist das Thema Parteireform aus dem Blick geraten, obwohl dort der Schlüssel zu finden ist, mit dem die Minderpräsenz von Frauen an ihren Wurzeln gefasst werden kann.
Paritätsgesetze versprechen, oberflächlich betrachtet, schnelle Abhilfe: Per Gesetz soll bestimmt werden, dass die Hälfte der Parlamentssitze an Frauen geht. Aber der Teufel steckt im Detail. Ernstzunehmende Schwierigkeiten bestehen in rechtlicher, wahlsystemischer und politischer Hinsicht. So wäre nicht nur mit parteipolitischen Widerständen und wahlrechtlichen Unwägbarkeiten, sondern auch mit höchstrichterlichen Urteilen ungewissen Ausgangs zu rechnen.
Gesetzliche Quoten beschneiden Entscheidungsfreiheit der Parteien
Aus rechtlicher Perspektive würden gesetzliche Quoten die Entscheidungsfreiheit der an den Kandidatenaufstellungen beteiligten Engagierten in den Parteien erheblich beschneiden. Bei der personellen Wahlvorbereitung der Parteien könnte dann eben nicht mehr jedermann für jede Position kandidieren. Dies bedeutet zugleich, dass auch die Wahlfreiheit der Parteimitglieder für oder gegen einen Aspiranten eingeschränkt würde.
Wahlsystemisch birgt das personalisierte Verhältniswahlrecht einige Fallstricke bei der Zielverfolgung einer paritätischen Geschlechterrepräsentation. Kompliziert ist die Umwandlung des Wahlergebnisses in Parlamentssitze der Parteien. Insofern wurde auch im Brandenburger Paritätsgesetz die Wahlkreisebene ausgeklammert. Listen kann man relativ leicht Quotieren, Wahlkreise dagegen kaum. Nun kennt Deutschland lediglich Einpersonenwahlkreise, das heißt, jede Partei kann nur einen Kandidaten aufstellen und am Ende kann nur einer gewählt werden. Aber auch Ansätze des Geschlechterausgleichs zwischen den Wahlkreisen sind wenig erfolgversprechend, ist doch vor einer Wahl reichlich ungewiss, welche Kandidaten gewinnen werden.
Politisch hätte ein Paritätsgesetz einen massiven Eingriff in die Organisationsfreiheit der Parteien zu Folge. Wie die Böll-Studie ebenfalls aufzeigt, ist es üblicherweise mitnichten so, dass Frauen bei den Kandidatenaufstellungen systematisch benachteiligt würden. Ganz im Gegenteil: Frauen erfahren dabei gemessen an ihrem Anteil in der Mitgliedschaft eher positive Diskriminierungen, insbesondere durch Quoten bei Grünen, Linken, SPD und CDU, zudem durch aktives Eintreten von Selektionsverantwortlichen. Die Studie zeigt aber zugleich, dass es auch den Vorreiterparteien bei der Geschlechtergleichstellung in den Wahlkreisen nicht zufriedenstellend gelingt, Frauen so häufig zu nominieren wie Männer.
Kaum Unterschiede bei innerparteilicher Partizipation
Bei der innerparteilichen Partizipation wiederum sind kaum geschlechtsspezifische Unterschiede zu identifizieren. Weibliche Mitglieder engagieren sich nicht entscheidend seltener oder weniger intensiv als männliche. So wird individuelles politisches Kapital aufgebaut, das die wichtigste Voraussetzung für eine Nominierung als Parlamentsbewerber ist. Somit haben sich Frauen diesbezüglich keine vorteilhaftere Position verschafft, liegen gegenüber den Männern aber auch nicht zurück.
Das Problem beginnt früher: Frauen finden zu selten zu einer Partei. Mit einer gesetzlichen Quote von außen würde dieser Aspekt vernachlässigt – mit fataler Folge für die Arbeit in Parteien und deren Vitalität. Sicherlich würde die Frauenrepräsentation im Bundestag ungeachtet der skizzierten Schwierigkeiten durch ein Paritätsgesetz erhöht, aber in den Orts- und Kreisverbänden bliebe alles beim Alten. Mehr noch: Der relative Anteil der Frauen in den Parteien hat zwar insgesamt gesehen in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen, langsam und nur geringfügig, aber in einigen Parteien sinkt er seit einiger Zeit wieder.
Bei den mitgliederstärkeren Parteien liegen die Frauenanteile aktuell zwischen 26 beziehungsweise 21 Prozent bei CDU und CSU sowie 33 Prozent bei SPD. Relative Rückgänge zu verbuchen haben die kleineren Parteien FDP und Linkspartei. Bei den Liberalen waren vor 20 Jahren ein Viertel der Mitglieder Frauen. Nun sind es nur noch 22 Prozent. Noch dramatischer ist der Sinkflug bei der Linken. Konnte sie sich als PDS vor zwei Jahrzehnten mit 46 Prozent des größten Frauenanteils unter den Mitgliedern rühmen, befindet sie sich seither im freien Fall. Derzeit liegt er bei rund 37 Prozent, Tendenz weiter fallend.
Geschlechterparität kann durch positive Anreize erreicht werden
Angesichts dieser Zahlen muss es also darum gehen, die Parteiarbeit attraktiver für Frauen auszugestalten. Gelänge es, mehr Frauen für ein Parteibuch zu begeistern, werden Parteiorganisationen an Anziehungskraft gewinnen. Vielleicht könnte damit sogar ihrem scheinbar unvermeidlichen Schicksal als schrumpfende Organisationen einen Riegel vorgeschoben werden?
Konkret sollten Parteien mehr innerparteiliche Demokratie wagen. Es spricht Bände, wenn die Rede von einer „Kampfkandidatur“ statt von Wettbewerb ist. Aufstellungen von Frauen in den Wahlkreisen könnten durch das Parteiengesetz „belohnt“ werden. Parteiintern könnte selbiges durch eine finanzielle oder personelle Unterstützung im Wahlkampf seitens der Bundesparteien positiv gewürdigt werden.
Diese und andere Reformmaßnahmen liegen auf dem Tisch. Es ist höchste Zeit, sie innerparteilich stärker wahrzunehmen, intensiv zu diskutieren, erfolgversprechende Ideen zunächst lokal und temporär begrenzt auszuprobieren und bewährte Ansätze dann organisationsweit zu implementieren. Die föderale Organisation der Parteien bietet dafür eine optimale Voraussetzung.
Die steigenden Professionalitäts- und Aggregationsanforderungen heutiger wie zukünftiger Politik sprechen eindeutig für die Schaffung von Geschlechterparität mittels positiver Anreize. Mit restriktiven Maßnahmen wie einem Gesetz werden Parteien kaum frischen Wind in die Segel bekommen. Fakt ist, dass die Rekrutierungsfunktion der Parteien eine höchst wirksame Säule der repräsentativen Demokratie bildet. Sie gilt es bei einer Reform aufrechtzuerhalten und zu stärken, nicht zuletzt im Hinblick auf einen nach Geschlechtern ausgeglichenen Bundestag.