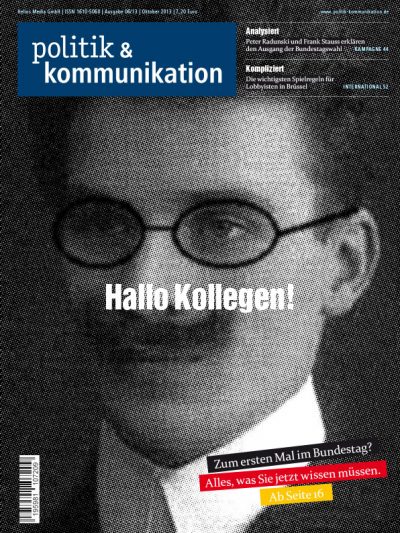p&k: Herr Radunski, wo haben Sie sich die Wahl angeschaut?
Peter Radunksi: Zuhause. Im Konrad-Adenauer-Haus redet man immer mit so vielen Leuten, da hätte ich zum Schluss gar nicht gewusst, wie das Ergebnis ist. Deswegen bin ich an Wahlabenden nicht so gerne dort.
Und wo waren Sie am 22. September, Herr Stauss?
Frank Stauss: Im Willy-Brandt-Haus, oben im 6. Stock. Als es am späten Nachmittag zum ersten Mal Gerüchte gab, die Union könnte die absolute Mehrheit haben, herrschte da natürlich Fassungslosigkeit.
Hat Sie der Wahlausgang überrascht?
Radunski: Ja. Dass die FDP nicht gut abschneiden würde, war klar. Aber dass sie aus dem Bundestag fliegt, damit habe ich nicht gerechnet – noch dazu bei einer Bundestagswahl, bei der es der CDU so gut geht. Das ist schon eine Sensation. Genauso überrascht war ich vom guten Abschneiden der CDU.
Stauss: Ging mir genauso. Bei den letzten beiden Bundestagswahlen haben wir erlebt, dass die Union am Wahlabend schlechter abgeschnitten hat als bei den letzten Umfragen vor der Wahl. Und dass es die FDP nicht schafft, hat wirklich niemand erwartet. Das zeigt, dass man eben nicht alles steuern kann.
Wie meinen Sie das?
Stauss: Die CDU hatte Angst, dass etwas Ähnliches passiert wie bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Januar, wo die Liberalen mit ihrer Zweitstimmenkampagne völlig überraschend ein für sie traumhaftes Wahlergebnis eingefahren haben. Deswegen hat die Union nach der Bayern-Wahl massiv dafür geworben, mit der Zweitstimme nicht die FDP zu wählen. Ob sie heute damit noch so glücklich ist und nicht lieber ein Prozent weniger gehabt hätte und die Liberalen dafür ein Prozent mehr – wer weiß.
Radunski: Ja, das Wahlergebnis in Nieder-sachsen und das neue Wahlrecht haben den Leuten bei der Bundestagswahl das Stimmensplitting alles andere als schmackhaft gemacht. Weil viele geglaubt haben, dass es ohnehin Ausgleichsmandate geben wird. Insofern haben auch institutionelle Faktoren aus der Vorzeit des Wahlkampfes den Wahlkampf entschieden.
Stauss: Stimmt. Doch das wahre Totenglöckchen für die FDP war die AfD. Das hat man ganz klar an den Wählerwanderungen gesehen. Man darf nicht vergessen: Vor zwei Jahren gab es innerhalb der FDP noch die Eurorebellen, da gab es ganz heftige Debatten, auch Verwundungen. Einige Liberale sind dann zur AfD. Kein Mensch weiß heute, ob die FDP der Union jemals wieder als Koalitionspartner zur Verfügung stehen wird.
Radunski: Na, da wage ich den Tipp, dass die FDP in ein paar Jahren wieder da sein wird – und zwar in ihrer schönen Form als Koalitionsbeschafferin. Ich will nicht wissen, wie viele sich heute schon ärgern, dass sie nicht gesplittet haben. Denn die Situation, in der wir uns jetzt befinden, dass eigentlich keine Partei eine Regierung mit einer der anderen Parteien bilden will, findet ja keiner schön. Das stärkt die FDP rückwirkend etwas.
Stauss: Was hart wird für die Liberalen, ist die Strecke, die sie vor sich haben. Wir haben im Mai 2014 zunächst einmal Europawahlen, mit einer niedrigeren Prozenthürde, aber mit einem klassischen AfD-Thema. Und dann kommen drei Landtagswahlen im Osten – auch nicht gerade das Territorium der FDP. Diese Durstrecke wird sich voraussichtlich durch das komplette nächste Jahr ziehen.
Radunski: Die AfD ist ja die andere Sensation dieser Wahl. Der Zufall wollte es, dass sie nicht reingekommen ist. Aber ihr gutes Abschneiden ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man wichtige Themen nicht unterdrücken kann. Das freut mich, auch wenn ich als Wahlstratege keiner Partei empfohlen hätte, über Europa zu diskutieren, weil es nichts bringt. Doch da sollten wir Wahlkämpfer wohl stärker an die Wähler denken.
Keine Frage, der Wahlabend war sehr spannend. Wie haben Sie den Wahlkampf erlebt?
Stauss: Eine ganz entscheidende Beobachtung war, dass wir im Wahlkampf kein richtiges Thema hatten. Das hat ihn so einzigartig gemacht und zeigt das Dilemma gerade für meine Partei, in diesem Wahlkampf zu reüssieren. Im Juni 2012 betrug der Abstand zwischen CDU und SPD zwei Prozent, am Wahltag, etwas mehr als ein Jahr später, 14 Prozent.
Radunski: Sie können sogar 16 Prozent sagen, wenn Sie hart zu sich sein wollen (lacht).
Stauss: (lacht ebenfalls) Wenn ich rechnen könnte, meinen Sie? Die Frage ist: Wie konnte das passieren? Wir hatten 2012/13 kein Thema, das die SPD nachhaltig beschädigt hätte, wir hatten auch keine massiven Angriffe der Union auf die SPD. Nichts, was es gerechtfertigt hätte, dass die Partei innerhalb eines Jahres von 32 auf 25 Prozent absackt.
Radunski: Stimmt, es gab kein großes Thema im Wahlkampf. Das wird jetzt in den Koalitionsverhandlungen kräftig nachzuholen sein. Ich glaube, viele werden überrascht sein, wie viele wichtige Themen es in diesem Land gibt. Aber ich glaube, entscheidend war etwas anderes. Zu jeder guten Strategie gehört, dass man einschätzt: Wie fühlen sich die Leute? In welcher Stimmung sind sie? Da gab es in diesem Wahlkampf zwei Deutschlandbilder. Das von Merkel, die gesagt hat: Uns geht es prima, so soll es bleiben. Und das von Steinbrück, der wörtlich gesagt hat: Das Land ist nicht im Lot. Das tat mir richtig weh, einen Kanzlerkandidaten so etwas sagen zu hören.
Warum?
Radunski: Weil es einfach nicht die Stimmung ausgedrückt hat, in der sich die Deutschen in dem Moment befanden. Hinzu kam eine Kanzlerin, die dieses „Feel good“ sehr gut repräsentieren konnte, die keinerlei selbstkritischen Zweifel an ihrem Kurs hat aufkommen lassen. Genauso wie sie über sich selbst nicht lange gesprochen hat. Ein sensationeller Moment im Wahlkampf war für mich, als sie im TV-Duell sagte: „Sie kennen mich.“ Eine derart selbstbewusste Aussage eines Spitzenkandidaten hat es in der Geschichte der Bundesrepublik selten gegeben. Da hatte es die SPD schwer, gegenzuhalten.
Stauss: Die SPD hat sich in eine Ecke der Hoffnungslosigkeit manövriert dadurch, dass sie nur noch der Anwalt der Armen und Entrechteten war. Da fehlte der klassische sozialdemokratische Aufstiegsgedanke, den diese Partei immer hatte: Dass sie auch denen ein Angebot macht, die nach oben wollen.
Wie kann eine Partei in ihrer Einschätzung der Wählerstimmung so falsch liegen?
Radunski: Eine solche Fehleinschätzung ist ganz typisch für Parteien. Sie können in sich selbst einen gewissen Konsens bilden, so ist es bei der SPD gewesen. Ich habe mit Spannung, ja sogar mit Aufregung die Parteitage der SPD verfolgt. Da hat Steinbrück versucht, mit seiner Basis wieder eine Einheit zu schaffen, indem er das Thema soziale Gerechtigkeit ganz stark betont hat. Das ging an der Stimmungslage eines großen Teils der Bevölkerung völlig vorbei.
Stauss: Die SPD hat die Umfragen zu banal gesehen. Man kann nicht einfach sagen: 75 Prozent der Leute sind für einen Mindestlohn, dann mache ich eben ein Plakat zum Mindestlohn und 75 Prozent der Leute wählen mich.
Radunski: (lacht) Wenn es so einfach wäre, würde man Herrn Stauss und mich nicht brauchen. Der große Nachteil an den heutigen Umfragen ist, dass sie gar nicht mehr operationabel sind.
Inwiefern?
Radunski: Sie müssten viel differenzierter sein. Wenn es in einer Umfrage heißt: 75 Prozent der Leute sind für einen Mindestlohn, dann muss man sich anschauen: Wie alt sind diese Leute, aus welchem Milieu kommen sie etc. Man bräuchte eine richtige Grundlagenstudie. Solche Studien hatten wir früher. Dadurch konnten wir ein Thema differenziert betrachten und an den Wähler bringen. Heute haben die Parteien dafür kein Geld mehr.
Stauss: Oder sie sind nicht willens, das Geld richtig auszugeben. Der Schlüssel, eine aussichtslos scheinende Wahl doch noch zu drehen, lag für uns immer in qualitativen Untersuchungen, in gründlichen Interviews, und nicht in einem platten Ablesen von Mehrheitsmeinungen. Wenn es immer nach den Mehrheitsmeinungen gegangen wäre, hätte es die entscheidenden Weichenstellungen in dieser Republik nie gegeben. Denn die Menschen sind grundsätzlich erst mal gegen Veränderungen, aber sie sind ja nicht unbelehrbar.
Radunski: Im Grunde wird im Wahlkampf verkehrt herum gerechnet. Da wird der Budgetplan gemacht und dann heißt es: Wir brauchen so und so viele Plakate und die City Lights brauchen wir auch noch. Und dann ist das Geld weg. Und dann sollen wir uns auch noch einen Berater wie den Stauss leisten, nein, das geht nun wirklich nicht. Dabei ist die Beratung, das Nachdenken davor, das Entscheidende.
Stauss: Dummerweise denken gar nicht so wenige in der Politik, dass die Agenturen die sind, die die Plakate machen, und dass man die nur in den letzten sechs Wochen braucht. Das ist Quatsch. Die ganze Arbeit läuft ja lange, lange vorher. Was hätte die SPD gut daran getan, wenn sie schon früher Berater gehabt hätte, die ihre Agenda 2010 anders verkaufen hätten als ein kaltes Reformpaket.
Radunski: Der Landesvorstand der Liberalen in Baden-Württemberg hatte vor längerer Zeit mal beschlossen, dass 30 Prozent des Budgets für Nachdenken ausgegeben wird. Das hätten die FDP-Leute dieses Jahr auch besser getan. Auch wenn die eigentlichen Wahlkämpfe immer kürzer werden, kann das Nachdenken über eine Strategie gar nicht früh genug beginnen.
Zurück zum Wahlkampf der SPD: Was hätten Sie gemacht, wenn Sie ihr Kampagnenmacher gewesen wären?
Radunski: Zunächst hätte man die gute Stimmung benennen müssen, hätte aber sagen können: Kinder, das geht nicht so weiter. Ein Gedanke steht ja im Raum: Was passiert eigentlich in Europa, wenn diejenigen, die von uns Geld bekommen haben, um ihre Schulden zu tilgen, dennoch nicht auf die Beine kommen? Darüber hätte man doch diskutieren können.
Stauss: Die SPD war schon auf einer längeren Strecke zu hasenfüßig. Bei der ganzen Europa-Debatte hatte sie von Anfang an viel zu viel Angst vor der „Bild“-Zeitung, vor einer Schlagzeile wie: Die SPD will noch mehr Geld nach Griechenland bringen. Dabei hätte sie doch selbstbewusst sagen können: Schaut, mit einem massiven Konjunkturprogramm haben wir 2008 die Wirtschaftskrise in den Griff bekommen, deshalb müssen wir das jetzt in der Eurokrise wieder tun. Die Frage ist: Macht es Sinn, in einer Situation, in der eigentlich alle zufrieden sind, einen mutlosen Wahlkampf zu machen? Und die Antwort ist: nein.
Radunski: Wir bekommen ja bei politischen Themen dauernd die Ansage: So und so viel Prozent sind dafür bzw. dagegen. Damit ist das Thema aber noch nicht durch. Ich muss politisch auch mal etwas so richtig finden, dass ich mich traue, das durchzuhalten.
Hätte die SPD mit einem mutigen Wahlkampf die Sache noch drehen können?
Stauss: Hätte, hätte, Fahrradkette (lacht).
Radunski: (lacht ebenfalls) „Sie kennen mich“ und „Hätte, hätte, Fahrradkette“ – diese beiden Sätze des Wahlkampfs muss man sich merken.
Stauss: Ja, das wird bleiben.
Radunski: Realistisch gesehen hätte die SPD es nicht so drehen können, dass sie eine rotgrüne Mehrheit bekommen oder gar vor der Union gelegen hätte. Ich glaube allerdings, dass sie mit einer perfekten Kampagne die Chance gehabt hätte, auf um die 30 Prozent zu kommen. Sie hat ja in den letzten drei Wochen einen wirklich tollen Wahlkampf gemacht und echten Kampfgeist gezeigt.
Stauss: Ja, die Leute waren bereit zu fighten. Die waren draußen auf der Straße, überall. Diesmal hat die Basis der Spitze gezeigt, wie es geht, und nicht umgekehrt. Kompliment übrigens an die Union: Ihr Durchmarsch war ja alles andere als selbstverständlich. Wenn man zurückschaut: Die Wahl in Nordrhein-Westfalen 2012: eine Katastrophe für die CDU. Dann die vielen Kabinettsrücktritte. Und die Wahlniederlage in Niedersachsen noch im Januar. Und dann dieses Ergebnis bei der Bundestagswahl. Das war schon eine Leistung. Heute sagen alle: Das war selbstverständlich…
Radunski: Nein, davon kann gar keine Rede sein. Das ist erarbeitet worden. Die CDU hat es mit etwas anderen Mitteln gemacht als die SPD, aber sie hat auch gut durchmobilisiert. Der beste Beweis dafür ist, dass Nichtwähler zurückgekommen sind. Die Volksparteien waren ja ein Steinbruch für Nichtwähler. Und das haben sie in diesem Wahlkampf durch Gespräche und Haustürwahlkampf verhindert.
Die CDU ist ja oft für ihre asymmetrische Demobilisierungsstrategie kritisiert worden.
Radunski: Das Wort gefällt mir gar nicht, so etwas hat es auch nie gegeben. Bevor die CDU überhaupt angefangen hat, hat die Kanzlerin ja einen eigenen Wahlkampf gemacht, wie ich ihn in der Qualität eigentlich nur bei Willy Brandt gesehen habe. Mit all den Komponenten der Sympathie – ob sie nun ins Kino gegangen ist oder spazieren war, ob sie Schulklassen besucht oder mit Leuten diskutiert hat.
Der Homestory-Faktor?
Radunski: Ja, aber sie hat das alles in einer Form gemacht, wo es nicht so knackte vor PR-Handwerk, sondern wo es fast eine normale menschliche Mitteilung war. Ich will das mal generalisieren: Dies war ein Wahlkampf, in dem eine einzelne Person eine riesige Rolle gespielt hat. Ich denke, diese Wahl hat gezeigt, dass die Persönlichkeit des Spitzenkandidaten immer wichtiger wird. Und dass die Leute künftig weniger auf die Themen der Parteien schauen werden, sondern ob sie jemanden wie Merkel zu bieten haben.
Diese Wahl ist vorbei, doch die nächste kommt bestimmt. Wann beginnt der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017?
Stauss: Wir sind schon mitten drin. Was in den anstehenden Koalitionsverhandlungen passiert, bestimmt die Ausgangslage für die nächste Bundestagswahl. Ganz entscheidend dabei ist natürlich die Frage der Ressortverteilung.
Radunski: Richtig. Auch die Positionen, die jetzt in den Parteien neu besetzt werden, können nachhaltig sein – sowohl was die Themen als auch was das Personal angeht. Im Moment werden echte Weichenstellungen vollzogen – vor den Augen einer Öffentlichkeit, die noch sehr aufmerksam ist, die wissen will, was aus ihrer Stimme wird. Damit hat der Wahlkampf natürlich schon wieder begonnen. Nur leider machen sich das die Parteien oft nicht klar.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Hallo Kollegen. Das Heft können Sie hier bestellen.