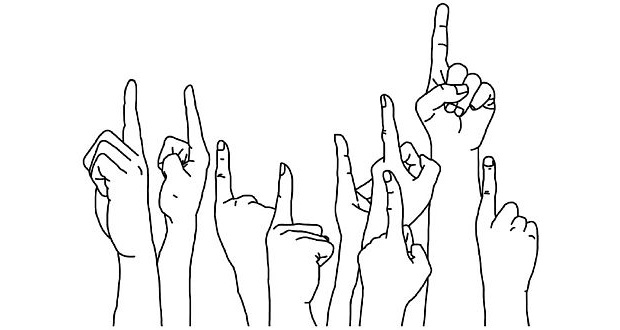Was unternehmen Parteien gegen Mitgliederschwund und Überalterung ihrer Anhänger? CDU und SPD suchen nach Wegen, um ihre Attraktivität für potenzielle neue Mitglieder zu erhöhen.
Eine Option, die auf dem Tisch liegt, ist die, zur Mitmach-Partei zu werden. Die Mitglieder sollen direkt entscheiden können, welchen Personen innerparteiliche Macht zukommt und mit welchen Inhalten die Partei vor den Wähler tritt. Das Beispiel der britischen Labour Party zeigt, wie mobilisierend das sein kann: Die Ausweitung direktdemokratischer Verfahren nach 2015 hat dazu beigetragen, dass sie zur mitgliederstärksten Partei Europas wurde.
Es entspricht dem Wandel des Zeitgeists insofern, als Selbstwirksamkeit tatsächlich einen zentralen Anreiz darstellt, in einer Partei mitzuwirken. Das unterstreichen vielfältige internationale Mitgliederstudien. Wenn eine Person einer Partei beitritt, will sie aktiv mitbestimmen und nicht nur Mitgliedsbeiträge vom Konto abbuchen lassen. Es ist daher der richtige Gedanke, die Mitglieder entscheiden zu lassen, wer den Parteivorsitz übernehmen soll.
Ist das am Ende nicht doch zu viel Aufwand?
Die CDU hat es (mit Einschränkungen) vorgemacht, die SPD macht es ihr nun nicht nur nach, sondern baut das innerparteiliche Verfahren in extenso aus. Während bei der CDU am Ende nur die Parteitagsdelegierten zwischen drei Kandidaten entscheiden durften, dürften bei der SPD alle Mitglieder ihre Stimme für eines der vielen Duos und Einzelkandidaten abgeben – und in 23 statt acht Regionalkonferenzen mit den zur Auswahl Stehenden diskutieren. Viele Wochen lang.
Diese (Tor-)T(o)ur mag einige aus der Parteispitze verschreckt haben. Denn da keine absolute Mehrheit zustande gekommt ist, soll es auch noch eine Stichwahl der beiden Bestplatzierten geben. Da moniert nicht nur der niedersächsische Ministerpräsident, dass der Prozess nicht optimal verlaufe. Ist das am Ende nicht doch zu viel Aufwand? Werden die Mitglieder und Sympathisanten der Partei nicht überfordert? In der Mediendemokratie, erst recht der online geprägten, zählen Dynamik, Prominenz und Visualisierung. Dem hat die SPD bislang zu wenig entsprochen, indem sie auf ein langwieriges Verfahren setzte, dem diese Eigenschaften zu Teilen fehlten.
Die innerparteiliche Demokratie ist es wert
Dennoch: Grundsätzlich ist der eingeschlagene Weg richtig, nur an der Umsetzung hapert es noch. Zudem sollten die Parteien trotz aller Kostennachteile direktdemokratische Verfahren nicht nur sporadisch einsetzen, sondern die Mitglieder häufiger nach ihrer Meinung fragen. So viel sollte ihnen die innerparteiliche Demokratie wert sein. Selbstverständlich gilt es dabei, Effizienz und Partizipation in Einklang zu bringen.
Mehr direkte innerparteiliche Demokratie wagen, ohne dabei die Öffentlichkeit und die eigenen Mitglieder zu überfordern, scheint ein geeignetes Mittel für die Zukunft zu sein. Da wäre allein online noch einiges drin. Jedoch sollten hier die teils spürbar negativen Erfahrungen von Online-Beteiligungsverfahren, wie wir sie bei einigen jüngeren Internet-Parteien sehen, beachtet werden. Manchmal kann etwas weniger Wandel auch ein Mehr an Beteiligung bewirken.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 128 – Thema: Wandel. Das Heft können Sie hier bestellen.