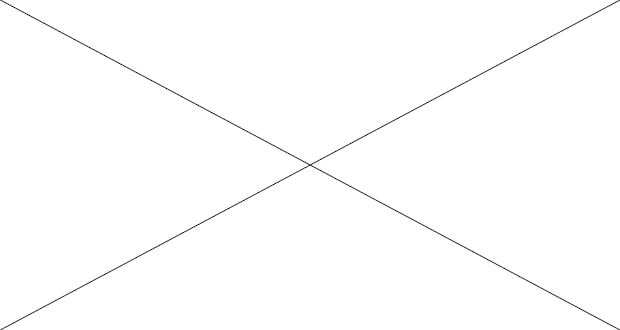Es ist eine Doppelrolle, die Peer Steinbrück übernimmt, seit er nicht mehr Bundesfinanzminister ist. Mal gibt er den Elder Statesman, mal ist er der Hoffnungsträger der SPD. Dabei fühlt er sich für den ersten Part mit 65 Jahren noch zu jung, für den zweiten ist er eigentlich zu alt.
Im Moment weiß niemand, ob Steinbrücks politische Karriere ausläuft – oder ob er sich erst warmläuft, um den letzten, großen Schritt zu machen. Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier, seine beiden Konkurrenten aus der sozialdemokratischen Troika, werden wohl nach der Bundestagswahl 2013 weiter mitmischen im politischen Berlin. Bei Steinbrück ist das ungewiss. Er könnte Bundeskanzler werden oder noch einmal zu Ministerehren kommen. Doch er könnte ebenso die Politik verlassen und in die freie Wirtschaft wechseln.
Auf seine Unabhängigkeit legt Peer Steinbrück großen Wert. Er fühlt sich zwischen allen Stühlen wohl. Nach dem Ende der großen Koalition legte er den stellvertretenden SPD-Vorsitz nieder. Er hat kein Parteiamt inne, ist einfacher Bundestagsabgeordneter. Das macht es ihm leicht, zwischen seinen disparaten Rollen zu changieren. Als freies Radikal der SPD entscheidet er selbst, wann er wo zu welchen Themen Stellung bezieht, und ist damit weitgehend souveräner Herr seiner medialen Inszenierung – anders als der Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende der SPD.
Peer Steinbrück fasziniert. Er arbeitet effizienter, ist intelligenter, witziger und ehrlicher als die meisten anderen deutschen Politiker. Er besitzt Charisma und Strahlkraft, wird bewundert und verehrt. Er wirkt wie ein großer knorriger Baum, der sich nicht verbiegt. Er ist kein Opportunist, jeglicher Bierzelt-Populismus ist ihm fremd. Ihm ist es meistens zu simpel und zu billig, dem Volk nach dem Mund zu reden. Peer Steinbrück ist das, was man als „Type“ bezeichnet, er ist kenntlich. Man kann sich an ihm reiben.
Peer Steinbrücks Stärken sind zugleich seine Schwächen. Er redet schnell, strahlt Überlegenheit aus und kann zu jedem Zeitpunkt immer und alles beurteilen. Er zügelt sein Selbstbewusstsein selten und tritt eigentlich nie bescheiden auf. Steinbrück kennt zwar die Ökonomie von Konflikten, aber er missachtet sie.
Klare Kante statt Klein-Klein
Obwohl er in seinem Berufsleben nichts anderes als den politischen Betrieb kennengelernt hat, arbeitet Steinbrück spätestens seit dem Jahr 2009 eifrig an seinem Image als Anti-Politiker. Erfunden hat er dieses Konzept nicht, es zeigt in allen westlichen Demokratien Erfolg, wo Parteien Einfluss verlieren. Es gibt radikale Anti-Politiker, etwa die Aushängeschilder der rechtspopulistischen Parteien. Das ist nicht Steinbrücks Metier, dafür ist er zu wenig populistisch und zu sehr ironisch veranlagt. Steinbrück zählt zum gemäßigten Typus des Anti-Politikers, wie zuvor schon etwa Horst Köhler und Karl-Theodor zu Guttenberg. Anti-Politiker leben davon, vermeintlich tabuisierte Wahrheiten beim Namen zu nennen; mancher kultiviert daneben eine Distanz zur eigenen Partei. Auch Peer Steinbrück findet sich in dieser Rolle glänzend zurecht.
Statt für Kompromisse und tagespolitisches Klein-Klein stehe er, so suggeriert Steinbrück, für eindeutige, notfalls auch schmerzhafte Entscheidungen. „Klare Kante“, heißt das in der Sprache markiger Polit-Machos, zu denen Steinbrück zweifelsohne zählt. Steinbrück wirbt nicht etwa um Verständnis für den mühsamen Alltag in der Demokratie. Etappensiege reichen ihm nicht aus. Er gibt vor, Projekte sofort und „eins zu eins“ umsetzen zu wollen. Damit bedient er die im Volk vorhandene Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Steinbrück weckt Erwartungen, die er in der politischen Praxis niemals erfüllen könnte.
Steinbrück inszeniert sich als Ohne-wenn-und-aber-Mann. Er agiert wie ein Wissenschaftler, der Recht haben will, nicht aber wie ein Politiker, der Recht bekommen will. Dabei geht es in der Politik niemals geradlinig zu. Politik funktioniert selten logisch, sondern vielmehr chaotisch und unberechenbar. Politische Ziele kristallisieren sich oft erst mitten im Prozess heraus. Für Steinbrück jedoch ist immer alles logisch und klar.
Wenn Steinbrück von einer Sache überzeugt ist, setzt er sich mit großer Entschiedenheit, mit Humor und zuweilen mit Sarkasmus dafür ein. Er fragt sich nicht, was er all jenen, die er gewinnen muss, zumuten und anbieten kann. Er geht nicht auf sie ein, er kommt ihnen nicht entgegen. Er bemüht sich weder, Verbündete zu gewinnen, noch Skeptiker zu überzeugen. Steinbrück will ein Maximum dessen durchsetzen, was er für politisch richtig hält – und erreicht auf diese Weise weniger, als eigentlich möglich wäre.
Helmut Kohl und Gerhard Schröder gründeten ihren Erfolg auch auf der Begabung, Vertraute zu gewinnen und hinter sich zu scharen. Willy Brandt hatte sogenannte Enkel, Gerhard Schröder politische Kumpels. Peer Steinbrück hat zeit seines Lebens keine Gefolgsleute aufgebaut. Er war immer ein Einzelspieler. Steinbrück spielt Tennis und Schach, Fußball zu spielen käme ihm nicht in den Sinn. Er will alleine agieren, selbstständig und souverän, und nicht auf andere angewiesen sein.
In der großen Koalition und während der Finanzkrise war Steinbrücks Stil erfolgreich. Mit Partnern wie Merkel, Thomas de Maizière und Frank-Walter Steinmeier konnte er gut umgehen. Er schätzte ihre rationale Art und nahm sie ernst. Eine breite parlamentarische Mehrheit, wie sie die große Koalition bot, bewahrte Steinbrück davor, die eigene Politik erklären und rechtfertigen zu müssen. Er hatte nie in den eigenen Reihen um Vertrauen zu werben. Steinbrück konnte als Bundesfinanzminister weitaus bequemer regieren als zuvor Kanzler Gerhard Schröder und jeder Minister der rot-grünen Regierung. Zuweilen mutete Steinbrück den eigenen Leuten Dinge zu, die sie ihm mit einer knappen Mehrheit wohl niemals hätten durchgehen lassen. So kämpfte er etwa gegen das Volk und die eigene Partei für eine Privatisierung der Deutschen Bahn und verweigerte sich dabei jedem Kompromiss.
Rational allerdings oder auch nur pragmatisch agiert Steinbrück entgegen seiner eigenen Darstellung längst nicht immer. Mit seiner zuweilen störrischen Art treibt er Konflikte auf die Spitze. Steinbrück rüstet bei solchen Auseinandersetzungen nicht ab. Im Gegenteil, er eskaliert und strapaziert so politische Verbündete. Der selbsternannte Pragmatiker entpuppt sich in solchen Momenten als Gesinnungsethiker, als politischer Missionar. Er agiert damit konträr zur Kanzlerin. Angela Merkel sediert ihre Gegner. Peer Steinbrück schafft sich immer neue Gegner.
Ein Basta ohne Empathie
Dieses Handeln hat mit Steinbrücks Charakter, aber auch mit seiner Karriere zu tun. Die Arbeit in Regierungszentralen hat ihn geprägt. Er denkt hierarchisch und durchaus autoritär. Er schafft keine Pläne, er konzipiert nichts Neues, Programme sind ihm zuwider. Er setzte die Konzepte anderer um, möglichst schnell und effizient. „Ich bin kein Mann der Legislative“ – diesen Satz sagte Steinbrück, als er bereits Abgeordneter geworden war. Der Parlamentarier Steinbrück distanzierte sich damit von den Parlamenten, seinen Kollegen und deren Arbeit.
Steinbrück ist ein untypischer Sozialdemokrat. Soziale Probleme hat er selbst nie erlebt, geschweige denn verinnerlicht. Er konnte sich immer alleine durchsetzen, er lernte die im sozialdemokratischen Milieu übliche Empathie nicht kennen. Peer Steinbrück kann nicht mit anderen leiden.
Gerhard Schröder vermittelte stets seine eigene Biografie, seinen Aufstieg aus einfachsten sozialen Verhältnissen. Wenn Schröder auf SPD-Kundgebungen ausrief, niemals dürfe Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängen, so war das authentisch. Mit seinem eigenen Leben gelang es Schröder, dem Parteivolk Brücken zu bauen. „Basta“, rief Schröder nur einmal, um deutlich zu machen, dass er die von Steinmeier und ihm entwickelten Reformen nicht aufzuweichen gedenke. Peer Steinbrück würde seinen Parteifreunden im Wochenrhythmus „Basta“ zurufen. Es wäre ein „Basta“ um des „Basta“ willen.
Steinbrücks Programm heißt vor allem Steinbrück. Er ist ein Angebotspolitiker, der die Nachfrage dort bedient, wo er die politische „Mitte“ vermutet. Steinbrück ist zwar kommunikativ, aber er ist kein diskursiver Mensch. Seitdem er nicht mehr Minister ist, fehlen ihm Menschen, die ihm Input liefern, die mit ihm auf Augenhöhe diskutieren. Und die ihm widersprechen. Dieses Defizit verstärkt seine autoritäre Attitüde und seine Rücksichtslosigkeit, mit denen er sich oft am meisten selbst schadet. Wer Peer Steinbrück kennenlernt, kann sich seiner Faszination kaum entziehen. Allzu oft aber lässt er nichts zurück als Fassungslosigkeit.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Follow me – Das Lobbying der Sozialen Netzwerke. Das Heft können Sie hier bestellen.