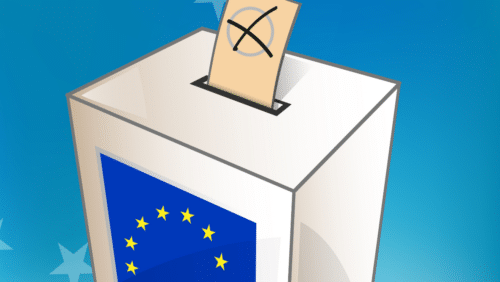Gespräch mit Gregor Poynton am Rande des Campaigning Summit in Zürich Ende Mai. Der Schotte hat als Political Director von Blue State Digital unter anderem die Präsidentschaftskampagnen von Barack Obama 2008 und 2012, François Hollande 2012 und Dilma Rousseff 2010 im digitalen Bereich unterstützt.
p&k: Mister Poynton, was finden Sie so faszinierend am Online-Campaigning?
Gregor Poynton: Dass es so etwas Frisches hat. Es gibt immer neue Herangehensweisen, neue Techniken, neue Tools. Das hält die Leute auf Trab, weil sie nicht Jahr ein, Jahr aus das Gleiche machen, weil sie sich fortentwickeln müssen. Beim Online-Campaigning dreht sich alles um Veränderung. Ich liebe Taktik und Technik. Doch die größte Befriedigung ist es natürlich, am Ende zu gewinnen.
Ihr persönliches Highlight in Ihrer Campaigning-Karriere?
Gute Frage. François Hollandes Präsidentschaftskampagne 2012 war definitiv ein Highlight. Das war ein großes, ein globales Ereignis. Daran beteiligt zu sein und dabei zu sein, als das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde – das war schon toll.
Blue State Digital hat auch die Online-Kampagnen von Barack Obama und die von Dilma Rousseff unterstützt – beides wie Hollande Politiker aus dem linken politischen Spektrum.
Stimmt. Wir arbeiten nur mit Parteien zusammen, die wir zum progressiven Flügel zählen – wie Labour in Großbritannien, die Sozialisten in Frankreich oder die Demokraten in den USA.
Hat die SPD auch schon angeklopft?
Nein, nicht dass ich wüsste. Während des Präsidentschaftswahlkampfs in Frankreich habe ich aber mit einigen deutschen Sozialdemokraten gesprochen. Die Hollande-Kampagne hatte nämlich 15 Kampagnenmacher aus ganz Europa für ein langes Wochenende nach Paris eingeladen, damit sie sich vor Ort ein Bild vom Online-Wahlkampf Hollandes machen können, darunter auch deutsche.
Wie schwierig fanden Sie es, die digitalen Tools der Obama-Kampagne 2008 auf die Kampagne von Hollande zu übertragen?
Nun, jeder Kontext ist anders, jede Kampagne ist anders. Es gibt nicht das perfekte US-Kampagnenmodell, das wir Frankreich oder Brasilien einfach nur überzustülpen brauchten. In diesen Ländern herrscht eine ganz andere Kultur als in den USA, ihre sozialen Netzwerke funktionieren anders.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Zunächst haben wir dem französischen Online-Team von Hollande gesagt: „Schaut, wir haben so einige Herausforderungen im Wahlkampf von Obama gemeistert, indem wir dies und jenes getan haben.“ Denn natürlich gibt es Herausforderungen zum Beispiel organisatorischer oder strategischer Art, die gewissermaßen universal sind und bei deren Bewältigung wir helfen können. Doch dann geht es darum, dieses Modell den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort so anzupassen, dass die Leute in ihrem lokalen Kontext motiviert und inspiriert werden.
Ein konkretes Beispiel, bitte.
Gern. Die USA sind Europa ja etwas voraus, was die Nutzung digitaler Instrumente angeht – besonders mit Blick auf das Spendensammeln. Das ist in den USA – verglichen mit Europa – ein Riesending. Wir haben es dann in Frankreich einfach probiert. Anfangs waren wir sehr unsicher: Wie bitten wir um Spenden? Wie schaffen wir es, dass sich die Leute hier engagieren?
Und? Wie war die Resonanz?
Sehr gut. Ich glaube, wir haben online eine Million Euro an Spenden gesammelt, was großartig war. Das zeigt, dass Online-Fundraising auch in Europa funktionieren kann. Die Leute wollen sich ja beteiligen, sie wollen etwas beitragen. Es geht ihnen dabei nicht ums Geld, sondern um ihre emotionale Beteiligung an der Kampagne. Und auch wenn sie vielleicht nur einen Euro oder ein Pfund spenden – ich glaube, allein dass es die Möglichkeit gibt, jemanden auf diese Weise zu unterstützen, ist wichtig.
Aus Kampagnenmacher-Sicht: Was war das Erfolgsgeheimnis für Hollandes Wahlsieg?
Aus digitaler Perspektive würde ich sagen: das Investment. Die Entscheidung: Wir wollen, dass Online wichtig wird, und investieren deshalb in den digitalen Wahlkampf. Hollandes Head of Digital saß in allen wichtigen Besprechungen und hatte Zugriff auf jeden und alles, um Dinge umzusetzen. Diese Einstellung, dass Online wichtig ist, hat sich dann nach und nach auf die ganze Organisation übertragen.
Wie wichtig ist es, dass der Kandidat hinter der Online-Kampagne steht?
Das ist ungemein wichtig. Barack Obama hat Zeit in die Online-Kampagne investiert, und Hollande hat das auch getan. Natürlich versuchen wir online, eine umfassende Geschichte zu erzählen – über die Organisation, die Wähler und Unterstützer. Es geht dabei nicht nur um den Kandidaten. Aber wenn der Kandidat nicht hinter dem Online-Wahlkampf steht, dann scheint das durch.
Obama, Rousseff, Hollande: Drei sehr unterschiedliche Kandidaten, drei Erfolgsgeschichten. Macht eine gute Online-Kampagne den Kandidaten selbst weniger wichtig?
Nein. Obama hat gewonnen, weil er Obama ist, nicht wegen seiner digitalen Kampagnen. Das Gleiche gilt für Hollande. Es ist natürlich schwer zu sagen, was jeweils der entscheidende Faktor für einen Wahlsieg ist. Ich glaube aber, dass Kandidaten, die an einem echten Austausch mit ihren Wählern und Unterstützern interessiert sind, grundsätzlich größere Chancen haben zu gewinnen. Denn die Leute wollen politische Führer, zu denen sie eine Beziehung aufbauen können, die ihnen das Gefühl geben, dass sie ihr Leben verstehen. Wir können den Kandidaten lediglich helfen, ihre Geschichte zu erzählen.
Das ist aber ja nichts Online-Spezifisches.
Stimmt. Es ist nichts Brandneues, es ist nur ein anderer Kanal. Beim Campaigning geht es ja immer darum, zu den Menschen eine Beziehung aufzubauen und mit ihnen zu interagieren. Das ist beim Online-Campaigning nicht anders. Nur die Instrumente sind andere. Gute Kampagnenmacher finden sich daher sehr schnell ins Online-Campaigning ein, weil sie sich von dessen technischer Seite nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil: Sie finden es fantastisch, dass sie endlich Dinge tun können, die sie als Kampagnenmanager schon immer machen wollten, für die ihnen aber bisher die technischen Möglichkeiten fehlten.
Muss eine Kampagne online wie offline die gleiche Geschichte erzählen?
Ja. Wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen Online- und Offline-Präsenz, dann merken die Leute das. Jede Kampagne hat eine Erzählung. Wenn man sie einmal im Kopf hat, dann kommt es darauf an, sie über die verschiedenen Kanäle in der jeweils richtigen Weise zu verbreiten.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Klar. Denken Sie an Obamas Tumblr-Plattform. Die Kampagne hat Obamas Message dort ganz authentisch erzählt, nur hat sie das eben auf eine Art getan, die der Community auf Tumblr sympathisch war. Und ich glaube, die Leute wussten das zu schätzen.
Nach dem, was Sie gerade gesagt haben: Ist es überhaupt sinnvoll, Kampagnen in Online und Offline zu splitten?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man die beiden zusammenbindet. Wir als Digital-Agentur arbeiten natürlich mit anderen Spezialisten zusammen. Nichts- destoweniger ist schon etwas dran an dem, was Sie sagen.
Wie würde die perfekte Kampagne aussehen?
Die perfekte Kampagne ist eine Kampagne, in der es eine integrierte, eine ganzheitliche Herangehensweise gibt – eine Kampagne, in der sich Online-, Offline- und Fundraising-Kommunikation nicht in ihrem jeweiligen Bunker verschanzen. Ich glaube, wem es als Erstes gelingt, diese Bunker einzureißen, der wird in einer ganz starken Position sein.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Bonn – wo liegt das?. Das Heft können Sie hier bestellen.