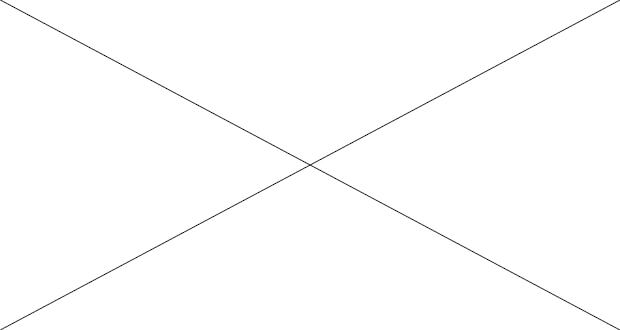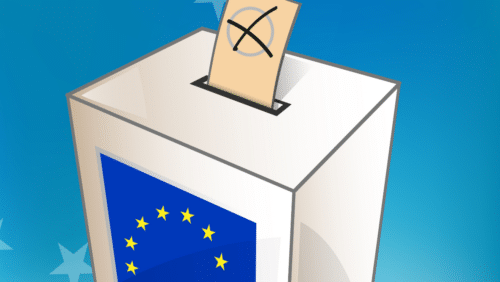Der Kanzlerkandidat kommt. Die Menschenmenge gerät in Bewegung, die Aufmerksamkeit richtet sich schlagartig auf die schwarze Limousine. Kamerateams und Fotografen gehen in Lauerstellung. Frank-Walter Steinmeier steigt aus dem Wagen, Kameras klicken, Björn Böhning holt ihn vom Auto ab; so ist es vereinbart zwischen den Genossen. Die Politiker schütteln sich die Hand, sie geben sich, als sei das hier bloß ein Treffen unter Freunden an einem sonnigen Samstagvormittag. Steinmeier hat sich bereit erklärt, in Berlin-Prenzlauer-Berg die „Respect Gaymes“ zu eröffnen, ein Fußballturnier für Toleranz gegenüber Schwulen und Lesben. Im Jahn-Sportpark tritt auch ein türkisches Team aus Kreuzberg an, Böhnings Wahlkreis. Der 31-jährige Bundestagskandidat wird in einer SPD-Mannschaft selbst gegen „Türkiyemspor“ spielen.
Die beiden Genossen setzen sich mit den Veranstaltern vom Lesben- und Schwulenverband auf eine Bierbank, Fotografen und Schaulustige umringen sie. Böhning trinkt Wasser, Steinmeier Kaffee aus einem Plastikbecher. Auf einer Bühne spielt die bei solchen Festen obligatorische Samba-Band. Die Sängerin skandiert „Aktion! Politik!“, und auf der Bierbank verstehen sie kaum ihr eigenes Wort. Steinmeier und Böhning versuchen sich in Smalltalk mit den Tischnachbarn, auch No-Angels-Sängerin Sandy Mölling gesellt sich dazu. Böhning wirkt leicht angespannt, schließlich ist das hier eine schöne – und gezielt arrangierte – Gelegenheit, sich mit dem prominenten Genossen den Fotografen zu präsentieren. Der Vizekanzler wird bald auf die Bühne gebeten, und auch da gibt Steinmeier seinem Parteifreund Schützenhilfe: „Lasst mir den Björn Böhning in Ruhe – keine Verletzungen! Den brauchen wir noch für den Bundestagswahlkampf“. Ach ja, der Wahlkampf: Am nächsten Tag ist Europawahl, doch Steinmeier versichert, er sei nicht etwa „hier, um Wahlkampf zu machen“. Er appelliere jedoch an alle, überhaupt ihre Stimme abzugeben.
Der Sprecher der SPD-Linken und ehemalige Jusochef Björn Böhning ist einer von weit über 1000 Deutschen, die antreten, um bei der Bundestagswahl im September ein Direktmandat zu erobern. Einer der Wahlkämpfer, die eine Menge Freizeit opfern, in Fußgängerzonen Zettel verteilen, Internetseiten basteln und auf Podien diskutieren.
Hohes Pensum
Zwar absolvieren Listenkandidaten in der Regel kein geringeres Pensum, doch gibt es auch solche, die sich auf ihrem Listenplatz ausruhen. Bei den Parteifreunden sind sie nicht gut gelitten, und jemand aus einer der Parteizentralen sagt, die dortige Führung würde intern gar drei Gattungen von Kandidaten unterscheiden: Da seien zum einen die „Arschlöcher“. Gemeint sind jene Kandidaten auf den sicheren Listenplätzen, die schon mit der Listenaufstellung faktisch im Parlament sitzen. Dann gebe es die chancenlosen „Loser“, die lediglich auf einem aussichtslosen Listenplatz kandidieren. Schließlich diejenigen, die unabgesichert um ein ungewisses Direktmandat kämpfen: Das seien die „Helden“.
Würde man dieser drastischen Definition folgen, wäre Björn Böhning ein solcher „Held“. Er fordert im Wahlkreis Berlin Friedrichshain-Kreuzberg die grüne Kultfigur Hans-Christian Ströbele heraus. Ströbele hat den Wahlkreis 2002 und 2005 direkt geholt, als erster Grüner, der jemals per Direktmandat ins Parlament gekommen ist. Der bekennende Pazifist war bei der Wahl 2002 nicht wie 1998 wieder auf einen sicheren Listenplatz gekommen. Als Direktkandidat betrieb er einen intensiven Straßenwahlkampf, der bei den Wählern verfing – seitdem tritt er nur direkt an.
Der Grüne erfreut sich großer Beliebtheit im Wahlkreis, der auch Teile von Prenzlauer Berg umfasst und ziemlich links ist: 2005 kamen Grüne, SPD und Linke hier zusammen auf fast 80 Prozent der Zweitstimmen. Ströbele holte über 43 Prozent und verwies den SPD-Kandidaten, der knapp 21 Prozent erhielt, deutlich auf den zweiten Platz.
Für die CDU tritt in Friedrichshain-Kreuzberg jetzt die ehemalige Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld als Direktkandidatin an, die über die Berliner Landesliste voraussichtlich nur bei Zugewinnen der CDU in den Deutschen Bundestag kommen dürfte.
Bei der Listenaufstellung geht es innerhalb der Parteien heiß zur Sache: Böhning unterlag in einer Kampfabstimmung um Platz 5 der Berliner SPD-Liste Parteiveteran Klaus-Uwe Benneter. Er hielt eine rhetorisch beachtliche Rede, geholfen hat es nichts. Beobachter werteten die Niederlage als Watsche stellvertretend für Berlins Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit, für den Böhning das Grundsatzreferat leitet.
Bei den „Respect Gaymes“ hat Frank-Walter Steinmeier inzwischen mit einem Pistolenschuss die Spiele eröffnet. Böhning tritt im ersten Spiel mit einem SPD-Team gegen Türkiyemspor an. Steinmeier hatte zuvor gesagt, er werde „so lange bleiben, bis Björn das erste Tor schießt“. Und der hängt sich rein, läuft viel und schießt denn tatsächlich sein Tor, auch wenn das Spiel gegen den Regionalligisten 1:2 verloren geht. Der Außenminister macht jedoch auch nach dem Treffer keine Anstalten zu gehen, er zeigt sich gut gelaunt und nimmt sich ungewöhnlich viel Zeit. Ein Fernsehinterview hier, ein Foto da. Er bleibt anderthalb Stunden.
Noch während das Turnier läuft, muss Böhning los: In Friedrichshain warten Genossen an einem Infostand. Es ist eben der letzte Tag des Europawahlkampfs. Vor der Verteilaktion ist Gelegenheit, sich in einem Straßencafé zu unterhalten. Warum tut er sich das eigentlich an, den ganzen Tag unterwegs, und noch bis in die Nacht in Kneipen Zettel verteilen – obwohl er doch eigentlich eine dicke Erkältung hat? Zum einen sei es Pflichtbewusstsein, sagt er. Wenn es eine Verteilaktion gebe, wisse er, dass da Leute mitmachen, die das alles auch für ihn tun. Aber es sei mehr als das: „Die Politik ist eine Form von Leidenschaft. Politiker sind doch alle irgendwie Junkies, und ich glaube, da bin ich selbst nicht vor gefeit.“ Zudem sei er längst so in die Politik involviert, dass da Freundschaften entstanden seien. Während des Gesprächs vibriert Böhnings Handy: Eine SMS des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, der mitteilt, dass im neuen ,Spiegel’ ein Interview von ihm sei. Thema: „Grillen in der SPD“. Böhning schaut auf und blickt sein Gegenüber fragend an. Politik kann seltsame Blüten treiben.
Er könne sich nicht vorstellen, auch mit 50 Jahren noch Politik zu machen, sagt Böhning: „Ich will nicht so werden wie mein Gegenkandidat“. Doch ist der Sozialdemokrat längst zum Berufspolitiker geworden, was er auch in Ordnung findet, das sei schließlich „ein Ausbildungsberuf“. Er hat Politik sowie Volkswirtschaft studiert und arbeitete zunächst beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Nachdem sie sich auf einer Flugreise länger unterhalten hatten, vereinbarte Klaus Wowereit 2006 einen Termin. „Ich dachte eigentlich, der will nur so mit mir reden“, erinnert sich Böhning. Doch Wowereit fragte, ob er für ihn arbeiten wolle. Er wollte – und wurde mit erst 29 Jahren zum Chefstrategen des Regierenden.
Frei und unabhängig
Doch nun soll ein Bundestagsmandat her – warum eigentlich? „Als Regierungsbeamter hat man vielleicht sogar mehr Einfluss“, sagt er, „doch als Abgeordneter bin ich viel freier und unabhängiger in meinem Handeln“.
Der Bonner Politikwissenschaftler Gerd Langguth, der in mehreren Biographien deutscher Spitzenpolitiker der Frage nachgegangen ist, was das Geheimnis einer politischen Karriere ist, sieht es ähnlich wie Böhning: „Wer noch nie ein politisches Mandat errungen hat, versteht weniger die Mechanismen der Politik und wie Wähler ticken. Nur wer ein Mandat hat, ist ein wirklicher Player.“ Der Sitz im Parlament verleihe die nötige Unabhängigkeit von der Partei, sagt Langguth, der selbst einmal als CDU-Abgeordneter im Bundestag saß. Diese Unabhängigkeit dürfte der Grund dafür sein, dass auch Politikmanager wie Kanzleramtschef Thomas de Maizière oder SPD-Bundesgeschäftsführer und Müntefering-Intimus Kajo Wasserhövel in diesem Jahr für den Bundestag kandidieren. „Wasserhövel wird die Gefahr erkannt haben, bei einem Regimewechsel innerhalb der SPD schnell hinweggefegt zu werden.“ Eine Überlegung, die für Björn Böhning auch eine Rolle spielen dürfte.
Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann sagt, dass es zudem ein Vorteil der Abgeordneten sei, über die Fraktion viel besser an Informationen zu kommen als Politiker ohne Mandat. Wer in der Fraktion sein Netzwerk ausbaue und Unterstützer gewinne, sichere seine Position maßgeblich. „Schließlich ist der Bundestag einer der wichtigsten Träger politischer Macht in Deutschland“, sagt von Alemann. Gleichwohl gelte die Regel „Ohne Mandat keine Karriere“ nicht uneingeschränkt. Das beste Gegenbeispiel sei Bundespräsident Horst Köhler, meint Alemann. „Frank-Walter Steinmeier oder Peer Steinbrück haben auch ohne Sitz im Parlament Karriere gemacht.“
Karriere machen muss Hans-Christian Ströbele jedenfalls nicht mehr, doch von der Politik kann er nicht lassen. Vor kurzem ist er 70 Jahre alt geworden, gefeiert hat er mit über 200 Gästen auf einem Schiff, das von Berlin-Tiergarten bis Friedrichshain die Spree hochfuhr. Von dem Stadtteil, in dem er wohnt, bis hin zu seinem Wahlkreis.
Wer Ströbele erlebt, glaubt ihm, dass es noch Dinge gibt, die ihn treiben. „Der Krieg in Afghanistan und die Finanzmarktkrise sind die Gründe, warum ich einfach nicht zuhause bleiben kann“, sagt der gelernte Rechtsanwalt, der in den 70er Jahren prominente RAF-Mitglieder wie Andreas Baader vertreten hat. Wenn er in seinem Abgeordnetenbüro darüber spricht, dass der Bundestag sich in der Finanzkrise „selbst entmachtet“, wird Ströbele immer lebhafter, fast hibbelig. „Es werden hunderte Milliarden von Euro verteilt, ohne dass die Abgeordneten informiert werden oder gar mitentscheiden dürfen“, sagt er. „Der kleine Abgeordnete Ströbele macht ständig Anfragen dazu, mit welchen Bedingungen das Geld ausgegeben wird“. Doch erhalte er selten eine befriedigende Antwort.
Der kleine Abgeordnete Ströbele: Er ist stolz darauf, der erste und bislang einzige Grüne mit Direktmandat zu sein. „Meine Position im Parlament hat sich seit 2002 ziemlich verändert. Mit mir reden plötzlich Kollegen auf Augenhöhe, die das vorher nicht getan haben. Da fragt sich keiner mehr: ,Wie hat der sich wieder über die Landesliste reingeschummelt‘?“ In Erinnerung geblieben ist Ströbele auch eine Fraktionssitzung mit Joschka Fischer, als dieser noch Außenminister war. Es ging um einen Bundeswehreinsatz, Fischer warb um die Zustimmung der Fraktion und sagte: „Der Ströbele darf dagegen stimmen, der ist dafür gewählt worden.“
Ströbele präsentiert sich gern als Typ mit Prinzipien, als einer mit Ecken und Kanten. Seit Jahren schon pflegt er seine eigene Marke: Der rote Schal, das Fahrrad, die Wahlplakate im 70er-Jahre-Stil. In Kreuzberg und Friedrichshain hat das bislang gut funktioniert, und auch diesmal will er wieder durch die Kneipen ziehen, Zettel verteilen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Aber zieht der Name Ströbele auch 2009 noch? Seit der vorigen Wahl hat sich immerhin ein Drittel der Bevölkerung im Wahlkreis ausgetauscht – und darauf setzt Konkurrent Böhning: „Die Leute haben genug von seiner 70er-Jahre-Romantik“, sagt der Sozialdemokrat. Ströbele sei ein „Repräsentant der alten Bundesrepublik“. So wird der Wahlkampf zwischen dem jungen Herausforderer und dem alten Fahrensmann auch zum Generationenkonflikt.
Ein junger Herausforderer, ein etablierter „Titelverteidiger“: Das ist die Situation auch im Wahlkreis Berlin-Pankow. Hier kandidiert für die SPD der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, heute Vizepräsident des Parlaments. Seit 1990 ist er schon Abgeordneter, auf der Berliner Landesliste kandidiert er auf Platz Eins. Honoriger als Thierse geht es kaum.
In der Medienfalle
Gegen ihn tritt für die CDU der 26-Jährige Gottfried Ludewig als Direktkandidat an, Bundesvorsitzender des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). Der Sohn des ehemaligen Bahnchefs Johannes Ludewig hat im Mai 2008 von sich reden gemacht, als er in einem Thesenpapier ein „doppeltes Wahlrecht für Leistungsträger“ vorschlug. Nachdem die „Bild-Zeitung“ sich auf der Titelseite des Jungpolitikers annahm und seine Forderungen zur Klarstellung so formulierte, dass demnach „Rentner und Arbeitslose weniger Stimmrecht“ erhalten sollten, schwappte über Ludewig eine Welle der Empörung zusammen. Er erhielt eine Einladung von Anne Will: Noch heute ist auf der Videoplattform „Youtube“ zu sehen, wie der Promotionsstudent von Will „gegrillt“ wird und bei den anderen Gästen – Heiner Geißler, Guido Westerwelle und Hubertus Heil – für Heiterkeit beziehungsweise demonstrativ besorgtes Stirnrunzeln sorgt. Ludewig hat aus dem Fehler gelernt: „Das war ein absolut falscher Einstieg in ein weiterhin wichtiges Thema“, sagt er heute. Die Anne-Will-Sendung sei jedenfalls eine Erfahrung, die er so schnell nicht vergessen werde.
Ludewig trifft man dieser Tage oft in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands Berlin-Pankow, wo er seine Wahlkampfzentrale eingerichtet hat. Dort gehen junge Leute ein und aus, Typ Jura- oder BWL-Student: Ludewigs Unterstützer. Sie betreiben Mobilisierung nach amerikanischem Vorbild und telefonieren alle 800 registrierten CDU-Mitglieder im Bezirk ab, um sie zu überreden, Zeit oder Geld zu spenden. „Die Erfolgsquote liegt bei 80 Prozent“, sagt er. Die meisten Parteimitglieder seien bereit, sich in irgendeiner Form einzubringen, was die CDU hier auch dringend nötig hat: Bei der Wahl 2005 bekam ihr Direktkandidat Günther Nooke bloß 15 Prozent der Stimmen, Thierse hingegen 41 Prozent. Hat der Kandidat angesichts solcher Zahlen auch nur den Hauch einer Chance auf den Sieg? „Na, entschuldigen Sie mal“, sagt er, „wir werden hier bis zur Wahl noch einen heißen Tanz aufführen!“ Auch Ludewig ist schon ein wenig zum Polit-Junkie geworden. Tagsüber arbeitet er für den RCDS und an sieben Tagen in der Woche betreibt er Wahlkampf, trifft sich mit seinen Unterstützern auch noch abends um zehn Uhr, um seine Kampagne durchzuplanen. „Das schlaucht mehr, als ich erwartet hätte“, sagt er.
Unterstützung erhält der Diplom-Volkswirt, der über Krankenkassensysteme promoviert, von einem smarten US-Amerikaner namens Ryan Anderson. Anderson hat in Deutschland studiert und arbeitete anschließend im Bundestagsbüro des ehemaligen Postministers Christian Schwarz-Schilling; später war er Leiter der Hauptstadtrepräsentanz des Telefonanbieters o2. Anderson, heute als Politikberater tätig, vermittelt dem Kandidaten Methoden des amerikanischen Wahlkampfs: dazu gehört die Telefonaktion in der Geschäftsstelle, aber auch Partys mit dem Kandidaten. Hierbei lädt ein politischer Unterstützer Freunde und Bekannte zum Grillen oder Kaffeetrinken ein, der Kandidat kommt vorbei, plaudert mit den Gästen und steht Rede und Antwort. In den USA ist so etwas seit langem üblich, schließlich steht die Person des Wahlkämpfers dort traditionell im Vordergrund.
In den nächsten Monaten will Ludewig angreifen, vor allem will er Wolfgang Thierse öffentlichkeitswirksam zur Diskussion herausfordern. Einladungen zu Podiumsrunden mit den anderen Kandidaten hat dieser nämlich bislang abgelehnt. Leichter als etwa Björn Böhning kann Christdemokrat Ludewig darauf setzen, zu polarisieren. Böhning liegt die soziale Gerechtigkeit am Herzen, er fordert beispielsweise Mindestlöhne – dafür sind seine Konkurrenten von den Grünen und der Linken allerdings auch. Ludewig hingegen spricht gerne von den „Leistungsträgern“, die ihm besonders am Herzen liegen, daher ja auch der Vorschlag mit dem Wahlrecht. Und er hofft darauf, dass ihm der auch in seinem Wahlkreis enorme Bevölkerungsaustausch in die Hände spielt.
Wandlung zum Politiker
Wer mit Gottfried Ludewig spricht, der bemerkt die kleinen Anzeichen der Verwandlung des Normalbürgers zum Politiker. Wer unterstreicht schon seine Worte mit der Wendung „Das ist meine feste Überzeugung“? Befragt, ob er auf dem Weg sei, Berufspolitiker zu werden, lacht er und sagt, das sei vielleicht die größte Gefahr, bei dem, was er mache.
Politiker stehen in der Ansehensskala der Bevölkerung nach wie vor nicht gerade weit oben, eher verlieren sie noch an Ansehen. Die Kritik an den Parteien und am Wahlsystem wird lauter. Zu denen, die seit jeher als Parteienkritiker bekannt sind wie der Jurist Hans Herbert von Arnim gesellen sich inzwischen auch der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog und prominente Journalisten wie „Spiegel“-Autor Gabor Steingart. Steingart spricht von „ermatteten“ Parteien, die zu erstarrt seien, um noch gutes Personal zu locken. Vergessen sie dabei die „Helden“ des Wahlkampfs? Tatsächlich bewirkt das Wahlsystem, dass nicht alle Kandidaten in gleichem Maße kämpfen müssen. Mancher kämpft auch gar nicht mehr, wenn die Absicherung über die Liste fehlt. So informiert denn ein Abgeordneter derzeit die Fachmedien darüber, dass er bald aus dem Deutschen Bundestag ausscheiden werde. Auf die Rückfrage, ob er demnach nicht mehr kandidieren würde, lautet die Antwort: „Doch, aber nur noch direkt.“ Der Mann hat sich schon in sein Schicksal gefügt. Er ist halt bei der FDP.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Beruhigungsmittel- Regierungskommunikation in der finanzkrise. Das Heft können Sie hier bestellen.