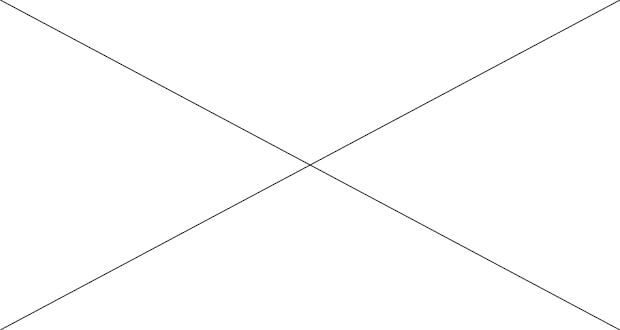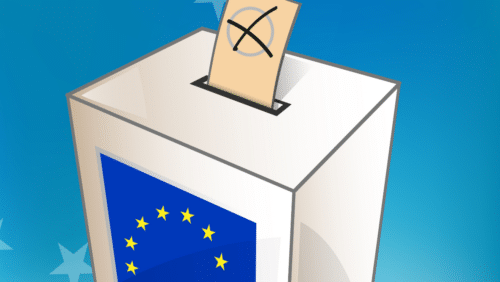Jakob studiert in Wien, wo die Studentenproteste vom vergangenen Herbst ausbrachen. Diese fanden nicht nur Beachtung als größte Studentenbewegung der vergangenen Jahrzehnte. Gerade Parteien, NGOs und Verbänden gelten sie als Prototyp einer internetgestützten Graswurzelkampagne. Sie suchen nach Möglichkeiten, diesen Mechanismus für eigene Zwecke zu kopieren. Soziale Netzwerke wie Facebook, seit Obamas Wahlkampagne schon in aller Munde, gelten als die neuen Arenen, die es für die politischen Akteure zu besetzen und zu nutzen gilt. Zu Recht?
Wie alle Koordinatoren der Wiener Studentenproteste nennt Jakob bloß seinen Vornamen. Drei Tage nach Beginn der Protesthandlungen sei er auf die Bewegung aufmerksam geworden. Er und seine Freunde redeten über die Proteste, zwischen Plänen fürs Wochenende und Tipps für die nächsten Klausuren. „Unsereuni“, „Unibrennt“, das waren die Schlagworte. So nannten sich die Protest-„Gruppen“ bei StudiVZ. So hießen die Fan-Seiten auf Facebook. Diese Worte kursierten bei Twitter als „Hashtags“, als Schlagworte, mit denen die Nutzer eine Nachricht einer bestimmten Diskussion zuordnen können.
Tag der offenen Tür gestürmt
Kurze Zeit später koordinierte Jakob die Bewegung mit. Die protestierenden Studenten nutzten die Sozialen Netzwerke auf vielfältige Weise. „Über Facebook, Twitter und StudiVZ konnten wir unheimlich schnell Unterstützung organisieren“, sagt er. Während der Besetzung des Audimax, des großen Hörsaals, hätten in einem Raum permanent Leute über diese Kanäle berichtet, was gerade geschieht und mitgeteilt, was als nächstes passieren müsse. Einmal brauchten die Besetzer dringend Sofas im Hörsaal. Sofort meldeten sich auf den Internet-Aufruf Studenten und Wohngemeinschaften, die helfen konnten. Innerhalb von Stunden wehte durch das Audimax ein Hauch von Wohnzimmer. Ein anderes Mal organisierten die Studenten einen so genannten Flashmob: Sie sprachen sich über das Internet ab, zu einer ganz bestimmten Zeit kurz, aber zahlreich an einem ganz bestimmten Ort zu erscheinen. Am Tag der offenen Tür des Wissenschaftsministeriums stürmten so 100 Studenten mit quietschenden Plastikhühnern das Gebäude und forderten mit Gegacker und Kikeriki-Rufen den Rücktritt von Minister Hahn. Die Medienaufmerksamkeit war der Aktion gewiss.
Das Internet spielte auch eine Rolle beim Informieren und Aktivieren breiterer Kreise. Laufend erfuhren weitere Studenten und zunehmend auch die Öffentlichkeit von den Protesten und verfolgten sie mit. So schwappte die Bewegung auch auf andere Unis über. Die zahlreichen deutschen Studenten in Wien – ironischerweise wurden gerade sie für einen Teil der Probleme verantwortlich gemacht – verbreiteten die Kunde und die Anliegen der Proteste in ihren deutschen Bekanntenkreisen, die es wiederum an ihre Unis trugen.
Diese Erfolge verführen tatsächlich zum Nachahmen. Entscheidend für den Erfolg dieser Graswurzelbewegung und ihrer Werkzeuge waren aber Voraussetzungen, die Organisationen oft vergessen oder unterschätzen. Der amerikanische Internetpolitik-Berater Colin Delany polemisiert und bringt es auf die Formel: „Twitter is not a strategy.“
Erstens fühlen sich viele Organisationen gedrängt, auf Sozialen Netzwerken präsent zu sein, „weil man das heute so macht“. Zum Beispiel auf Twitter. Studenten nutzen Twitter. Und weil sie sehr oft an ihren Laptops sitzen oder entsprechende Software auf ihrem iPhone installiert haben, nutzen sie das Programm permanent. Für einige von ihnen ist es wichtiger als E-Mail. Die allermeisten etablierten politischen Akteure haben aber ein Zielpublikum, für das die E-Mail noch immer die mit Abstand wichtigste Anwendung des Internets ist.
Zweitens können die Sozialen Netzwerke fehlende Beziehungsnetze nicht ersetzen. Es war nicht die Internettechnik, die die Studenten zusammengebracht hat. Sie haben sich gekannt aus den Vorlesungen, sich dort und danach auch in den Sozialen Netzwerken ausgetauscht. Als direkt Betroffene haben sie sich irgendwann völlig natürlich im Internet organisiert, weil sie das schon im Nichtpolitischen gemacht haben. Eine Partei, die an den Stammtischen und Dorfplätzen nicht mehr ankommt und versucht, mit einer Facebook-Präsenz Unterstützer zu gewinnen, wählt den falschen Ansatz. Zudem sagt auch Jakob, dass gerade die Mobilisierung für Massenaktionen zu wesentlichen Teilen auch vor Hörsälen und in Lichthöfen stattfand. Das Internet ergänzt herkömmliche Mobilisierungsstrukturen. Es macht sie keinesfalls überflüssig.
Erst Adressen sammeln
Drittens spielten in Wien Facebook und Twitter vor allem eine Rolle bei der Selbstorganisation der besonders Bewegten. Erste Anlaufstelle für mehr Informationen von Studenten, die an der Uni oder im Internet von den Protesten gehört haben, blieb die Webseite. Hier waren verbindliche Veranstaltungsdaten, Forderungskataloge, Berichte, Bilder und Videos zusammengefasst. Natürlich kann Facebook auch für niederschwelliges Engagement eine Rolle spielen. Entscheidend ist aber: Die Studenten bauten auf solides, aufwändiges Webmaster-Handwerk. Organisationen können mit Sozialen Netzwerken keine grundsätzlichen Defizite in der Online-Kommunikation kompensieren. Auch wer noch keine kampagnenfähige E-Mail-Adressdatenbank seiner Mitglieder und Unterstützer aufgebaut hat, muss dort ansetzen, bevor er Ressourcen für Twitter einsetzt.
Viertens setzten die Studenten selbstverständlich um, wovor viele Organisationen wegen interner Befindlichkeiten und komplizierter Strukturen heimlich längst kapituliert haben: Crossmediales Kommunizieren. Eine Information fand sich auf allen relevanten und dafür geeigneten Kanälen. Termine erschienen auf der Webseite, Internet-Adressen auf Facebook, Erfolgsmeldungen auf allen Kanälen mit jeweils medien- und zielgruppengerechten Texten – und nicht als Pressemitteilung.
Natürlich zeigten sich in Wien auch die Grenzen der Graswurzel-Selbstorganisation. Die Studenten schafften es nicht, ein klar kommunizierbares Forderungspaket zu formulieren. Die Abschaffung der Studiengebühren war der kleinste gemeinsame Nenner. Schon danach war unklar, ob die Bologna-Reformen verbessert oder rückgängig gemacht werden müssten. Hinzu kamen unzählige Forderungen unterschiedlicher Gruppierungen von „Antidiskiminierung“ bis „Zulassungsbeschränkungsstopp“. Journalisten, die es genauer wissen wollten, fanden keine Vertreter, die für alle sprechen konnten. Es gab keine Sprachregelungen zum Vorwurf des Vandalismus im Zusammenhang mit den Besetzungen. Niemand pflegte systematisch Beziehungen zu bestehenden und möglichen Unterstützern im Hinblick auf eine längerfristige Kampagne. Die unbequeme Frage, wie viel Hierarchie und Führung eine Kampagne im Verhältnis zu Basisdemokratie und Mitmachkultur braucht, haben auch die protestierenden Studenten nicht beantwortet.
Dennoch haben sie mit dem Internet Einiges erreicht: Weil sie das Internet wirklich handlungsorientiert eingesetzt haben. Erfolg haben Organisationen, die mit den Menschen im Internet etwas erreichen wollen. Nicht diejenigen, die dank des Internets jemanden zu gewinnen hoffen, nicht die Politikerin, die von ihrer Referentin einen Facebook-Auftritt unterhalten lässt in der Hoffnung auf Medienberichte über eine offene und aufgeschlossene Wahlkämpferin. Nicht die NGO, die twittert, weil sie einen Absatzkanal für ihren Fairtrade-Vertrieb erschließen will. Die Studenten haben – vielleicht unbewusst – vom Ziel her gedacht, nicht von den Maßnahmen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Nerven Sie nicht! – Der Knigge für den politischen Alltag. Das Heft können Sie hier bestellen.