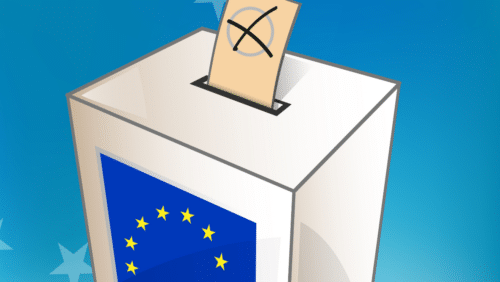Herr Hock, vergangene Woche ist Ihr Buch „Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?“ erschienen. Was hat Sie dazu motiviert, so bissig über den „Niedergang unserer Sprache“ zu schreiben?
Andreas Hock: Als Journalist bin ich ja schon von Berufs wegen mit der deutschen Sprache sehr vertraut. Außerdem habe ich schon als Kind immer gerne gelesen. Unsere Sprache bietet eigentlich wunderbare Möglichkeiten, sich verständlich und präzise auszudrücken – dazu braucht es keine Anglizismen oder Fremdworte. Wenn man allerdings durch die Stadt läuft und sich insbesondere die Werbung anschaut, fällt einem auf, dass da eine gewisse Neigung zur kollektiven linguistischen Verblödung besteht …
Die Werber sind also Schuld, dass sich Deutsch zum linguistischen Auslaufmodell entwickelt?
Das Grundproblem bei Werbetreibenden ist, dass sie uns eine Bedeutung vorgaukeln wollen, die im Kern gar nicht vorhanden ist. Das ist deren Job und auch eigentlich nicht schlimm. Dadurch wirkt das Angepriesene oft jedoch unfreiwillig komisch. Mein Lieblingsbeispiel: Wir haben hier in Nürnberg eine Bäckereikette, die sich „Back-Shop“ nennt. Gehen Sie mal mit einem Engländer dorthin, der wird lachen. Für ihn heißt das nämlich „Arschladen“. Wir machen uns darüber aber überhaupt keine Gedanken mehr. Ganz schlimm ist auch der Werbespruch vom Reinigungsmittel Cilit Bang: „The Power to Wow“. Das finde ich derart gruselig, weil es überhaupt nichts aussagt. Wir lassen uns von diesen blödsinnigen Botschaften einfach berieseln. Ärgerlich wird es dann, wenn sich Dinge dadurch in den allgemeinen Sprachgebrauch einschleichen.
Auch die PR wird für ihre Sprache oft gescholten …
Ich war selbst Pressesprecher und weiß, dass man sich in der PR immer auf einem Minenfeld bewegt. Die verschiedenen Interessen zu bedienen, ist sprachlich nicht immer einfach. In erster Linie ist man gezwungen, der Institution, die man vertritt, gerecht zu werden, ohne die Journalisten zu verprellen. Manchmal entsteht auf diesem schmalen Grat eine Sprache, die nicht ganz glücklich ist. Für die Sprache generell sehe ich in der PR aber keine Bedrohung. Im Werbefernsehen werden wir mit deutlich Schlimmerem konfrontiert.
Das Business-Englisch setzt sich hierzulande immer stärker durch. In unseren Personalmeldungen haben wir es fast nur noch mit „Head ofs“ oder „Account Managern“ zu tun. Für Sie ein Tabu?
Auch hier wird oft Bedeutung nur vorgetäuscht. Das klassische Beispiel ist doch immer der Facility Manager, der in Wahrheit einfach der Hausmeister ist. Wenn ein Unternehmen in verschiedenen Märkten zu Hause ist und sich international aufstellen muss, ist das etwas anderes. Dass aber jeder kleine Betrieb mit acht Angestellten zweisprachige Visitenkarten druckt, um Relevanz vorzutäuschen, ist albern. Viele Kunstbegriffe dienen ja nur dazu, sich wichtig zu machen.
Von 2002 bis 2007 waren Sie Pressesprecher in der CSU-Landesleitung in München. Welchen kommunikativen Widrigkeiten waren Sie während dieser Zeit ausgesetzt?
Bei der politischen Kommunikation ist es ein bisschen wie beim Fußball: Man redet stets um den heißen Brei herum. Auch wenn Sie eine Wahlniederlage einstecken, müssen Sie Zuversicht verbreiten. Damals hatten wir ganz gute Erfolge, das war zur Hochphase von Edmund Stoiber. Als er dann jedoch seinem politischen Sonnenuntergang entgegensegelte, wurde es schwieriger, die politischen Interessen zu wahren, ohne den Mann zu beschädigen und andererseits den Wandel in Bayern zu begrüßen. Die Journalisten haben natürlich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt.
Anschließend waren Sie Chefredakteur von „Die Abendzeitung – 8-Uhr Blatt“ in Nürnberg. Verträgt sich die Liebe zur Sprache mit der Arbeit bei einer Boulevardzeitung?
Gerade die Arbeit bei einer Boulevardzeitung ist mit die beste sprachliche Schule, durch die man gehen kann. Die „Bild“ ist dafür ein Paradebeispiel. Hier ist man immer genötigt, Sachverhalte so herunterzubrechen, dass sie allgemein verstanden werden. Natürlich sehnt man sich manchmal danach, einen langen ausführlichen Essay zu schreiben. Aber letztlich halte ich es für anspruchsvoller, Dinge so zu erklären, dass sie vom einfachen Arbeiter bis zum Universitätsprofessor jeder versteht. Die knappen Schlagzeilen bei der „Bild“ bewundere ich dafür sehr. Insofern habe ich diese Arbeit nie als Makel empfunden.
Über eine Schlagzeile wie „Wir sind Papst“ können Sie sich also freuen?
Ja, darüber kann ich mich richtig freuen! Sie ist grammatikalisch vielleicht nicht lupenrein, für Einfallsreichtum und Sprachwitz aber definitiv ein gutes Beispiel.
Menschen in ihrer Ausdrucksweise zu korrigieren, stößt nicht immer auf Beifall. Tun Sie das?
Nein, das mache ich nicht. Ich bin weder Deutschlehrer noch Linguistikexperte, sondern einfach jemand, der gerne mit Sprache umgeht und sich seinen Teil dazu denkt. Ich fürchte nur, dass in absehbarer Zeit eine Generation heranwächst, die gar nicht mehr lernt, sich richtig auszudrücken, Briefe zu schreiben und Bücher zu lesen. Wenn diese dann wiederum Kinder bekommt, wird das Ausdrucksvermögen immer eindimensionaler. Ich belehre niemanden, hoffe aber, den ein oder anderen zum Nachdenken über Sprache anzuregen.
Gibt es denn irgendwelche Fehler oder Begriffe, bei denen Sie sich einen Kommentar nicht verkneifen können?
Naja, wenn jemand nicht mehr in vollständigen Sätzen sprechen kann, Artikel weglässt, oder sich nur in Anglizismen ausdrückt, sage ich schon etwas. Aber letzten Endes entscheidet jeder für sich selbst, wie er sich artikulieren möchte. Nur: Wenn jemand den ganzen Tag Facebook-Posts absetzt, verlernt er irgendwann, sich auszudrücken. Kommuniziert er dann nur noch in Abkürzungen, sollte man ihn darauf aufmerksam machen.
Apropos: Sind Sie selbst in den sozialen Medien unterwegs?
Ich habe ein Buch über die Auswüchse von Facebook und Co. geschrieben und mich während der Recherche tunlichst abgemeldet. Nicht nur, weil ich kein Interesse daran habe, dass mir jedes Mittagessen von Freunden in der Chronik erscheint, sondern vor allem aus Datenschutzgründen. Wenn ich mich mit jemandem austauschen möchte, treffe ich mich lieber mit ihm oder rufe ihn an. Ich finde es schlimm, sich nur noch über soziale Netzwerke zu verständigen und dabei zu glauben, man nehme am realen Leben teil.
Gibt es aus dem PR-Bereich für Sie ein persönliches Unwort?
Was ich ganz schlimm finde, ist, dass grundsätzlich nur noch von „Brands“ gesprochen wird, anstatt von Marken. Plötzlich ist alles „gebranded“ – dabei braucht die deutsche Sprache dieses Wort überhaupt nicht.
Mir geht es ähnlich mit dem Wort „Content“.
Stimmt. Ich finde, wir sollten wieder mehr auf Inhalte und weniger auf Content setzen.
Was ist Ihr Lieblingswort?
Die deutsche Sprache kennt sehr viele schöne Wörter, ein spezielles habe ich da nicht. Aber ich habe ein Lieblingsunwort: die „Abstandseinhaltungserfassungsvorrichtung“. Das ist feinstes Beamtendeutsch und beschreibt schlicht ein Radargerät. Dass Menschen Zeit dafür haben, sich solche Wörter auszudenken, lässt mich erschaudern.
Zum Abschluss eine letzte Frage: Wer soll Ihr Buch lesen?
Jeder, der Freude an Sprache hat. Man kann damit übrigens auch anderen einen zarten Hinweis geben, ihre Ausdruckweise zu überdenken … Lesen bildet, egal ob es sich um Karl May, Harry Potter oder Sachbücher handelt. Das ist viel besser, als den ganzen Tag auf Facebook zu posten.
Dieses Interview erschien ursprünglich auf der Webseite unseres Schwestermagazins „pressesprecher„. Dort finden Sie auch eine Rezension zu Herrn Hocks Buch „Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?„.