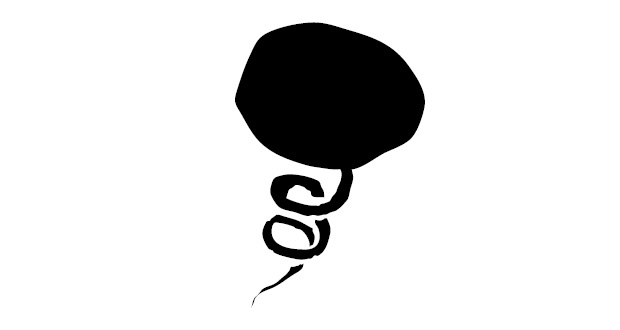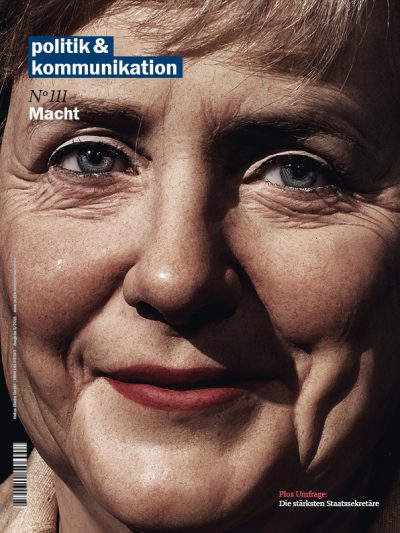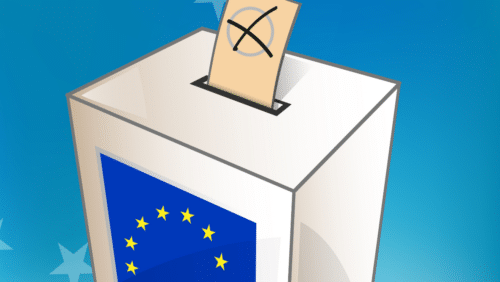Also sprach Josef Ackermann, damals Chef der Deutschen Bank, im Sommer 2008, im ersten Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise: „Wir werden unseren Kurs der zeitnahen Transparenz fortsetzen und uns unvermindert für zielführende Reformen des Finanzsystems insgesamt einsetzen.“ Auf dieses Zitat bin ich in dem Buch „Der Sprachverführer“ von Thomas Steinfeld gestoßen. Was will Ackermann mit diesem Satz sagen? Beziehungsweise: Was will er nicht sagen? Steinfeld urteilt: Dem Redner komme es vor allem auf eines an: „die Ermächtigung, weiter seinen Geschäften nachgehen zu können“ und „sich des Gehorsams der Zuhörer zu versichern“.
Derart den Blick geschärft, entdecke ich ständig weitere Beispiele für die Sprache der Macht. Zum Beispiel dieses hier: „Auf unserer Klausur Ende Januar wurde ich zum Sprecher gewählt. Das ist sowohl für das Heute als auch für das Morgen eine wichtige Aufgabe, die es mir ermöglicht, in vielen Politikfeldern für eine nachhaltige Entwicklung zu kämpfen.“ Noch so ein nichtssagendes, hochtrabendes Geschwurbel.
Wer sagt so etwas? Ein Ackermann-Typ? Ein Machtmensch? Ein arroganter Schnösel? Ein alter Sack? Nein. Solche Sätze schreiben dreißigjährige Frauen und Männer, offen, fröhlich, die gleich auf den ersten Blick sympathisch wirken. Warum schreiben junge Menschen solche Sätze? Sind sie doch Machtmenschen? Schreiben sie im Sinne ihrer Chefs, die Machtmenschen sind?
Wenn ich die Betroffenen darauf aufmerksam mache, wie elitär ihre Sprache wirkt, sind sie erschrocken. Sie wollen das nicht. Sie haben es nur so gelernt, in der Schule, in der Universität und in ihrem beruflichen Umfeld, wo alle voneinander abschreiben. Sie haben es einfach nie infrage gestellt. Es sind bei Weitem nicht nur Einzelne, die Machtsprache gebrauchen. Schon gar nicht nur die Mächtigen. Oder die Durchtriebenen. Es sind Leute wie du und ich. Aber sie sitzen an den Schalthebeln der Sprache, die in die Öffentlichkeit dringt.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie für Parteien, Gewerkschaften, Unternehmen, Behörden oder Universitäten arbeiten. Die meisten schreiben verschwurbeltes, fremdwortdurchsetztes, hauptwortdominiertes Deutsch. Wobei ich es erstaunlich finde, dass gerade Gewerkschafter und Sozialdemokraten so schreiben. Sie schreiben an denen vorbei, für die sie vorgeben, da zu sein. Die Christdemokraten sind nicht besser, aber bei ihnen fällt es weniger auf.
Sie benutzen Wörter wie Austerität, Hegemonie oder Primat, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass sie damit etwa 95 Prozent der Menschen ausschließen. Diese Zahl kann ich mit keiner Studie belegen, aber der gesunde Menschenverstand wird mal ausreichen dürfen. Auch Worte wie Partizipation, Teilhabe oder Transparenz grenzen unnötigerweise Menschen aus. Sie geben ihnen das Gefühl, ungebildet zu sein, jedenfalls nicht angesprochen zu werden. Außerdem sind diese Wörter hässlich.
Absichtlich elitär
Machtsprache? Ja. Von Machtmenschen? In der Regel nein. Eher von Mitläufern, die sich nicht fragen, was sie selbst für richtig halten. Doch es ist nicht nur Gedankenlosigkeit im Spiel. Einige Menschen schreiben absichtlich elitär. Nicht, weil sie elitär sind, sondern weil sie intellektuell erscheinen wollen. Sie fürchten, banal zu wirken, wenn sie leicht verständlich schreiben. So verrückt ist es wirklich! Sie versuchen, die Banalität ihrer Gedanken durch komplizierte Sprache zu vertuschen. Sie betreiben Augenwischerei. Oder um es drastisch zu sagen: Sie verarschen.
Hat das mit Machtbewusstsein zu tun? Eher mit Feigheit. Sie stellen sich nicht dem eigentlichen Problem: Dass sie wenig zu sagen haben oder sich nicht trauen, etwas zu sagen. Wenn sie wirklich etwas zu sagen hätten, würden sie es in einfachen Sätzen tun. Denn alles Komplizierte lenkt nur von wahren Aussagen ab. Und nichts Wichtiges ist so kompliziert, dass es sich nicht einfach ausdrücken ließe. Keine Ausreden.
Woran liegt es, dass wir so schreiben? Erhard Eppler behauptet in seinem Buch „Kavalleriepferde beim Hornsignal“, die deutsche Sprache habe sich in Schreibstuben und auf Paradeplätzen herausgebildet. Er folgert: „Wer es nicht nötig hat, andere zu überzeugen, braucht sich beim Reden und Schreiben keine Mühe zu geben.“ Und weiter: „Herren und Knechte sind selten gute Sprecher.“ Fühlen wir, die wir für die Öffentlichkeit schreiben, uns als Herren? Nein, aber wir gebärden uns so.
Mir reicht es nicht, nur darüber zu klagen. Ich will das ändern. Und ich weiß auch, wo wir ansetzen sollten: in der Schule. Denn dort fängt das Elend an. Wer es nicht glaubt, sollte die offiziellen Musterlösungen von Abiturarbeiten lesen. „Man kann meines Erachtens davon ausgehen, dass die Zuordnung zwischen Signifikat und Signifikanz in der Regel arbiträr ist – dies zeigen schon die gravierenden Unterschiede zwischen den Sprachen der Welt.“ Glauben Sie nicht, ich hätte böswillig diesen einen, schlimmen Satz mühsam ausgegraben. Die Prüfer wollen, dass wir so schreiben.
Ich fordere deshalb: Deutschlehrer müssen schreiben lernen. Das ist kein Vorwurf an Deutschlehrer. Auch sie haben es schließlich nicht besser gelernt. Aber bei ihnen müssen wir ansetzen. Sie sollten lehren, wie wir uns verständlich und wirkungsvoll ausdrücken – statt uns in Machtsprache zu üben.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation II/2015. Das Heft können Sie hier bestellen.