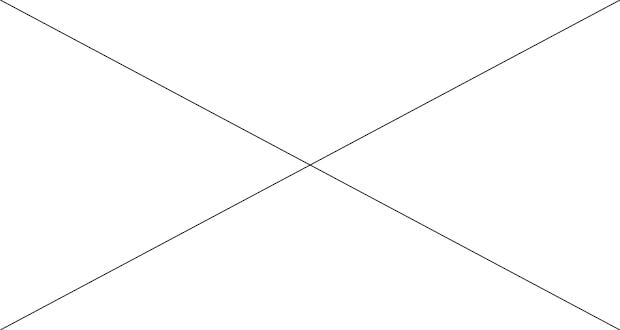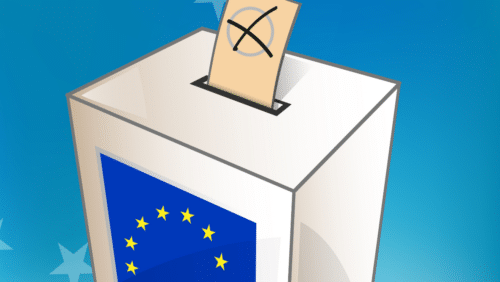Nayirah ist keine kuwaitische Krankenschwester. Nayirah ist nicht einmal eine real existierende Person. Doch ihre Geschichte, die sie dem Menschenrechtsausschuss des amerikanischen Kongresses und per Fernsehübertragung der ganzen Welt erzählte, gilt als Beschleuniger für den Start des ersten Irakkriegs – und ist sicher nicht unschuldig am Beigeschmack von Propaganda, der Public Diplomacy anhaftet.
Die angeblich 15-jährige Kuwaiterin berichtete an jenem 10. Oktober 1990, wie irakische Soldaten in ihrem Krankenhaus Neugeborene aus den Brutkästen gerissen hätten und sie auf dem kalten Boden sterben ließen. Der amerikanische Kongress hörte zu, Millionen US-Bürger verfolgten die Anhörung auf „ABC’s Nightline“. Niemand schien an der Wahrheit der Geschichte zu zweifeln, auch der damalige US-Präsident George Bush zeigte sich öffentlich entrüstet. Laut einer Umfrage des Gallup-Instituts sprachen sich nach der Verbreitung von Nayirahs Geschichte mehr als doppelt so viele US-Amerikaner für einen Militärschlag gegen den Irak aus, wie noch wenige Wochen zuvor. Auch der Kongress ließ sich auf die Tragödie ein: Die „Operation Wüstensturm“ begann nur drei Monate nach der Anhörung.
Erst später stellte sich heraus, dass Nayirahs Geschichte und Nayirah selbst erfunden waren. Die von der kuwaitischen Regierung unterstützte Organisation „Citizens for a Free Kuwait“ hatte im Frühsommer 1990 die US-Agentur Hill&Knowlton engagiert. Sie sollte Stimmung gegen den Irak machen. Also ließ sie Theater spielen. Als Nayirah in der Hauptrolle: die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA.
Den Esel vorantreiben
Für ihre Zwecke ist die Strategie Kuwaits aufgegangen. Der Public Diplomacy, die das Image eines Landes aufpolieren soll, legte sie Steine in den Weg. „Häufig setzen die Menschen Public Diplomacy mit Propaganda gleich“, sagt Henry Werner, Presseattaché bei der dänischen Botschaft in Berlin und Vorsitzender der Association for Place Branding & Public Diplomacy. Propaganda – sie beeinflusst die öffentliche Meinung und greift dabei nicht selten auf sozialpsychologische Erkenntnisse zurück. Zum Beispiel, indem sie auf die Tränendrüse drückt. Public Diplomacy sollte viel mehr mit „Soft Power“ überzeugen, sagt Werner. Es sei wie mit einem Esel. Man könne ihn mit der Peitsche vorantreiben oder ihn mit einer Möhre an der Angel vor dem Kopf locken. „Intuitiv halten wir die Möhren-Lösung für ethisch und moralisch besser“, sagt Werner. Soft Power sei das trotzdem nicht, da auch die Androhung, die Möhre bei Nicht-Kooperieren vorzuenthalten, eine Sanktion sei. „Soft Power bedeutet, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das so stark ist, dass sich der Esel allein durch gutes Zureden bewegt.“
Unterstützer ins Boot holen
Public Diplomacy ist keine Strategie für schnellen Erfolg. Sie will Klischees über das eigene Land gerade rücken. Das geht nicht von heute auf morgen, ist aber wichtiger denn je. „Die traditionelle Rolle der Botschaft und der Außenpolitik hat sich geändert“, sagt Anna Schwan, Beraterin für Standortkommunikation bei Scholz&Friends-Agenda. Vor 50 Jahren waren es ausschließlich Diplomaten und Botschafter, die mit ausländischen Regierungen interagierten und Informationen austauschten. „Inzwischen ist der Informationsfluss über die Medien so schnell, dass sie sich etwas neues überlegen müssen.“ Bilaterale Diplomatie allein reicht nicht mehr aus. Was die Öffentlichkeit denkt, kann die Politik in einer Demokratie nicht ignorieren: „Ein privates Blog kann politische Entscheidungen beeinflussen“, sagt Werner.
Um am öffentlichen Bild des eigenen Landes zu feilen, braucht es eine Strategie, Geduld – und Unterstützung. „Es nützt nichts, wenn alle ihre kleinen Brötchen backen“, sagt Schwan. Public Diplomacy ist mehr als klassische PR, Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs. Sie agiert mehr als dass sie reagiert. Bei der Fülle an Feldern und Zielgruppen, die Public Diplomacy bedient, sei es sinnvoll für die politischen Akteure, sich jemanden von Außen zu holen, sagt Daniel Florian, der den Bereich Public Diplomacy bei dimap Communications leitet: „Man kauft sich kulturellen Sachverstand.“ Organisationen, Verbände und auch Agenturen vor Ort kennen Land und Leute. Sie wissen, wie sie die Zielgruppen in ihrem Land ansprechen müssen, welche Themen wichtig sind und wo Fallstricke sind. Neben der Expertise haben sie bereits das Vertrauen der Menschen und sind gut vernetzt.
Nichtregierungsorganisationen sind eine gute Anlaufstelle, um Themen zu besetzen. Internationales Engagement bei Amnesty, Greenpeace oder Oxfam im Kampf für Frieden, Menschenrechte und Naturschutz mag kitschig klingen, zeigt aber dennoch Einsatz über die eigenen Grenzen hinaus. Die kanadische und norwegische Regierung haben zum Beispiel gemeinsam mit verschiedenen Anti-Landminen-Organisationen das Verbot von Landminen als Thema auf die internationale Agenda gebracht.
Inwieweit Kommunikationsagenturen in der Public Diplomacy involviert sind, ist von Land zu Land verschieden. In den meisten Fällen übernehmen sie die Medienarbeit und Umsetzung einzelner Kampagnen. „Politische Mandate machen nur einen kleinen Teil aus“, sagt Florian. Er betreut bei dimap Communications seit dem G8-Gipfel in Sankt Petersburg 2006 die Public Diplomacy Russlands in Deutschland. „Strategiefähigkeit, Kampagnenfähigkeit und Krisenkommunikation“ sind aus Florians Sicht die großen Vorteile von Agenturen. Sie könnten den Auftraggeber beraten, gemeinsam Botschaften und eine Kommunikationsstrategie entwickeln. Sie könnten in einem nächsten Schritt Lobby- und Medienkampagnen entwickeln und letztendlich im Falle einer Krise diese kommunikativ begleiten. Anders als im inszenierten Fall der kuwaitischen Krankenschwester hat die Glaubwürdigkeit hohe Priorität: „Ein über Jahre aufgebautes Image kann durch eine schlechte Politik schnell zerstört werden.“
Die dänische Regierung behält die Fäden gern selbst in der Hand. „In Dänemark ist man der Auffassung, dass die Public Diplomacy bei der Regierung bleiben sollte“, sagt Werner. Lediglich bei der Pressearbeit im kulturellen Bereich und der gestalterischen Umsetzung von Kampagnen arbeiten die Dänen manchmal mit Agenturen zusammen. Nicht ohne Grund würden Botschafter so gut geschult und auf ihre Aufgaben vorbereitet. Strategische Entscheidungen und direkte Kommunikation von Regierung zu Regierung blieben Aufgabe der Botschaften, sagt Werner.
Ähnlich arbeitet auch die deutsche Botschaft in Washington. Anna Schwan hat dort drei Jahre lang im German Information Center gearbeitet und den Bereich Bildung geleitet. „Wir wollten Deutschland in die Klassenzimmer bringen.“ Mit Deutschland und den Deutschen verbinden viele Amerikaner nach wie vor kaum mehr als den Zweiten Weltkrieg. An diesem Bild lässt sich nicht so leicht rütteln. Mit einem Newsletter für etwa 8000 interessierte Lehrer, Präsenz auf Messen für Fremdsprachenstudien und Sozialwissenschaften, Vorträgen, Konferenzen, Publikationen in den Medien und einem Wettbewerb, bei dem Schüler eine Deutschlandkampagne entwerfen sollten, wollte Schwan Struktur in den Bildungsbereich bringen. Die deutsche Botschaft arbeitet mit einer Subagentur von Weber Shandwick zusammen, die sich hauptsächlich um die grafische Umsetzung kümmert.
Von Außen betrachtet
Die deutsche Public Diplomacy steckt noch in ihren Kinderschuhen. Die Goethe-Institute fördern seit Jahren die deutsche Kultur und Sprache im Ausland. Auch die Parteistiftungen im Ausland und die Deutsche Welle tragen ihren Teil bei. „Aber es gibt noch keine Strategie“, sagt Florian. Im Auswärtigen Amt kümmert sich seit Kurzem eine neue Arbeitsgruppe genau darum. Mit der Initiative „Deutschland – Bild im Ausland“ setzen sie da an, wo jede gute Strategie beginnt: dem Ist-Zustand. Mit Hilfe privater Akteure will das Auswärtige Amt das Image der Regionen Deutschlands herausfinden. „Das ist ein sehr guter Ausgangspunkt“, sagt Florian. Denn wer die Ausgangssituation falsch einschätzt, wird sie nur schwerlich ändern können.
Für die Kommunikationsstrategie, die auf dieser Analyse aufbauen sollte, gibt es kein Patentrezept. Jedes Land bringt andere historische, kulturelle und geografische Voraussetzungen und Ziele mit. „Norwegen hat eine gute Strategie gefunden, indem es sich auf eine Botschaft und sechs Kernstaaten konzentriert“, sagt Florian. Norwegen wirbt für sich als Kämpfer für den Weltfrieden, vor allem in den USA, Russland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Japan. Die Strategie zahlt sich aus, obwohl dem Land viele Faktoren fehlen, die es anderen Ländern leichter machen: Norwegisch ist keine internationale Sprache, als Reiseland liegt Norwegen relativ ungünstig, und es hat keine international starken Marken oder Unternehmen. Andererseits kann das auch ein Vorteil sein, denn, so Florian: „Norwegen muss auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen.“
Als Reiseland punktet hingegen Dänemark bei den Deutschen. Sie mögen Dänemark, und das sei eine gute Voraussetzung für erfolgreiche Public Diplomacy, sagt Henry Werner. „Doch das ist oft nur touristisch begründet. Für uns ist aber entscheidend, mit welchen Themen wir wann gehört werden.“ Toleranz, Gleichberechtigung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind langfristig auf der deutsch-dänischen Agenda. Aktuelle Themen sind Innovation – am 18. Juni eröffnete das dänische Innovationszentrums in München – sowie Klima und Energie. Im Dezember 2009 findet schließlich der UN-Klimagipfel in Kopenhagen statt. Dänemark ist eben mehr als Holzhütten, Hotdogs und Lego-Bausteine.
Public Diplomacy ist, wie so vieles, ein Exportschlager aus den USA. 1965 tauchte der Begriff dort erstmalig auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die USA weltweit ein gutes Image. „Mit der Public Diplomacy kamen McDonald’s, Coca Cola und der American Way of Life“, sagt Florian. Inzwischen aber leidet das Image, Anitamerikanismus macht sich breit. Der 11. September, der zweite Irakkrieg – Amerika mit seinen zunehmenden Sicherheitsbestimmungen schottet sich immer mehr vom Rest der Welt ab. Die Public Diplomacy leidet darunter, ebenso wie die öffentliche Meinung im Ausland.
Nach hinten losgehen
Nordkorea dagegen investiert zunehmend in seine Public Diplomacy, entschied sich allerdings für eine falsche Strategie. Die Regierung lud Journalisten ins Land – und wollte ihnen eindringlich nahe legen, wie die Berichterstattung aussehen sollte. „Die Medien zu sich einzuladen reicht nicht aus und führt zu kontraproduktiven Ergebnissen, wenn man sie auch noch steuern will“, sagt Werner. Auch ein nordkoreanisches Internetportal, das landestypische Produkte anbot, erregte mehr Spott als Lob, nicht zuletzt, weil die Technik katastrophal war und die Internetseite wieder und wieder abstürzte.
Zwang funktioniert genauso wenig wie die Idee, das Image eines Landes komplett umkrempeln zu wollen. Daran ist auch die Kampagne „Cool Britannia“ gescheitert. In den Neunzigern sollte sie unter der Labour-Regierung Tony Blairs den Briten ein junges und trendiges Image verpassen. Doch sie hatten die Rechnung ohne die Briten gemacht. Die Inselbewohner hingen an ihren Traditionen, sie stehen zu dem, was sie darstellen. Mit dem coolen Image konnten sie nichts anfangen. Die Kampagne wurde gestoppt. „Cool Britannia“ sei nach innen kollabiert und gelte allgemein als Worst Case, sagt Werner. Dabei sei es ein gutes und lehrreiches Beispiel dafür, wie es nicht gehen kann: „Wenn man nach außen geht, ist es wichtig, dass man sein eigenes Land auch mitnimmt.“ Heute verzichten die Briten auf einen flotten Spruch, ein Logo, konzentrieren sich auf ihre strategische Kommunikation – und sind zufrieden mit ihrem leicht schrägen Image.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Rutschgefahr – bitte bleiben sie politisch korrekt. Das Heft können Sie hier bestellen.