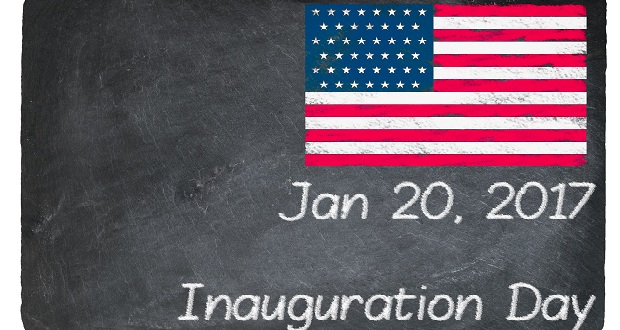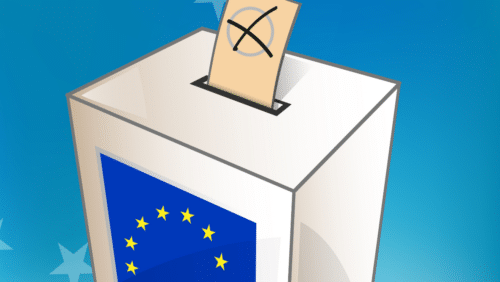Es hatte etwas von einer Reality-Fernsehshow, als president-elect Donald Trump eineinhalb Wochen vor seiner Amtseinführung zum ersten Mal nach seinem Wahlsieg in der marmorverzierten Lobby seines Hochhauses vor die Presse trat. Wer sich einen moderaten Ton erhofft hatte, wurde enttäuscht.
Schnell wurde deutlich, Trump meint es ernst mit vielen seiner Versprechen: An der Grenze zu Mexiko soll eine Mauer gebaut werden, um illegale Einwanderer abzuhalten. Obamacare, die politisch umstrittene Krankenversicherung, soll so bald wie möglich abgeschafft und ersetzt werden, auch wenn bislang noch keine Alternative ausgearbeitet ist. Medienvertreter von traditionsreichen Zeitungen und Nachrichtensendern bezeichnete der Präsident als fake news, zu Deutsch „Lügenpresse“, und verbot manchem Journalisten gänzlich das Wort. Trump gab sich, wie ihn die Weltöffentlichkeit bereits von Twitter kennt: provozierend, selbstbezogen, chaotisch und kämpferisch – und das über 140 Zeichen hinaus.
Hauptsache dagegen
Dass dieser Mann nun das mächtigste Amt der Welt übernimmt, ist die Krönung des Protests gegen Washington, gegen die politischen Eliten und gegen den sogenannten Mainstream. Die Exekutive liegt jetzt in der Hand von Donald Trump, der diesen Widerstand wie kein anderer im Wahlkampf verkörperte. Rebellen, political insurgents, hätten die Regierung übernommen, sagte der außenpolitische Berater des neuen Secretary of State, Rex Tillerson, kurz vor der Amtseinführung bei einem Besuch in Berlin. Ebenso wirkte die erste Pressekonferenz des designierten Präsidenten – jegliche politische Spielregeln setzt er außer Kraft.
Donald Trump ist das Endgame einer populistischen Revolte, die einst mit einem Wutausbruch eines Wirtschaftsjournalisten wenige Tage nach der ersten Amtseinführung von Barack Obama Anfang 2009 begann. Rick Santelli echauffierte sich damals im US-Fernsehen über die milliardenschweren Subventionen für Hauseigentümer, die von der US-Regierung im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise erlassen wurden. Der Reporter fragte, warum die Regierung Verlierer unterstütze, deren Häuser hypothekenbelastet seien, und das Geld nicht lieber in Menschen investiere, die langfristig etwas daraus machen würden – dann rief er zu einer neuen Tea Party auf.
Trumps Aufstieg begann mit der Entstehung der Tea Party
In den ersten Monaten des Jahres 2009 mobilisierte sich eine Bewegung aus enttäuschten Konservativen unter dem Hashtag #tcot (top conservatives on twitter) virtuell über das soziale Netzwerk. Wenig später marschierten sie in der wirklichen Welt – gegen den jungen Präsidenten Obama, gegen Steuererhöhungen, gegen die allgemeine Gesundheitsreform und gegen eine Ausweitung des Staatsdefizits. Obwohl die Tea Party zu ihren aktiven Zeiten nur ungefähr eine halbe Million Mitglieder verzeichnete und die Marke „Tea Party“ in der zweiten Amtszeit Barack Obamas kaum noch eine Rolle spielte, hatten die Ideen und Strategien der Bewegung einen weitreichenden und langfristigen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft und die politischen Strukturen.
Donald Trump erinnert in vielerlei Hinsicht an die „Tea Party“-Bewegung. Im Wahlkampf griff der Unternehmensmagnat immer wieder die Sorge und Nöte der Wählergruppe auf, die sich von den etablierten Politikern schon lange nicht mehr ernstgenommen und verstanden fühlt – eben die „forgotten men and women of our country – people who work hard but not longer have a voice“. Trump thematisierte Einwanderung weitaus stärker als die übrigen republikanischen Kandidaten, womit er gerade die Wähler überzeugte, die im Laufe der Präsidentschaft Barack Obamas immer missgünstiger gegenüber Einwanderern und immer nationalistischer geworden sind.
Wie auch Bernie Sanders auf der linken Seite präsentierte sich Trump als Verfechter der unteren Mittelschicht. Er versprach, mehr Gerechtigkeit für die Vernachlässigten und mehr Jobs in strukturschwachen Bundesländern zu schaffen. Er wandte sich gegen das Partei-Establishment, gegen die Politik der US-Hauptstadt und gegen die Eliten. Er kritisierte Freihandel und Globalisierung. All das kam im amerikanischen Heartland gut an – auch bei denen, die traditionell demokratisch wählen.
Authentisch, unabhängig, direkt
Weniger als zehn Prozent der Amerikaner vertrauen ihrer Regierung – der geringste Wert seit 50 Jahren. Sie glauben mehrheitlich, Washington sei korrumpiert und nur ein Außenseiter könne aufräumen. Trumps Wähler charakterisierten den Präsidentschaftskandidaten als authentisch, unabhängig und direkt. Eine weitere überzeugende Eigenschaft des Präsidentschaftskandidaten, von der ehemalige „Tea Party“-Anhänger erzählten: „Trump is so rich he can’t be bought“, deshalb könne nur er der politischen Korruption entgegentreten.
Trump nutzte die Mischung aus Misstrauen, Argwohn und Sorge im Wahlkampf gezielt aus. Dabei half ihm seine Wahlkampfsprecherin Katrina Pierson ebenso wie viele andere ehemalige „Tea Party“-Aktivisten, die im US-Fernsehen als Kommentatoren für Trump warben. Pierson beispielsweise, eine ehemalige Demokratin, die 2009, enttäuscht von Obama, der Tea Party beitrat, sprach die Sprache der ehemaligen Graswurzel-Aktivisten fließend. Die Grenzen des politischen Diskurses beachtete sie ebenso wenig wie ihr Boss – zusammen zweifelten sie im Wahlkampf wissenschaftliche Erkenntnisse an, verhöhnten ganze Bevölkerungsgruppen und schürten Angst vor dem Islam, Migranten und dem Zerfall des Landes – und all das im Namen des American Dream.
Konfrontation statt Kompromiss, Gefühle statt Fakten
Vieles von dem, was Trump sagte und machte, hatte sich vor ihm noch kein Präsidentschaftskandidat getraut – unprecedented, beispiellos, kommentierten US-Medien. Funktioniert hat es trotzdem, beziehungsweise gerade deshalb. Trump verstand es, konservative Nachrichten- und Onlinekanäle wie Fox News oder Breitbart gezielt zu manipulieren. Und viele der übrigen Fernsehsender waren bereit und sogar begierig, stundenlang ohne Unterbrechung über den auffälligen Präsidentschaftskandidaten zu berichten – kein Kontext, dafür Quote.
Über eineinhalb Jahre brannten sich Trumps populistische Slogans im Wahlkampf oft ungefiltert in die Köpfe potenzieller Wähler. Konfrontation statt Kompromiss, Gefühle statt Fakten – diese Strategien haben mit der Tea Party Einzug in den politischen Alltag der USA gefunden. Denn schon bei ihren Anhängern blieb kaum etwas ungesagt: Obama als Hitler, die Gesundheitsreform als Euthanasie, Europas Sozialstaaten als Kommunismus. Tabus oder politische Korrektheit gehören nicht länger zur politischen Kultur. Donald Trump ist die logische Konsequenz der Tea Party, die den Ton in der politischen Debatte nicht nur verschärft, sondern radikalisiert hat.
Platz für politische Außenseiter
Im Wahlkampf sagte Trump nicht nur, was er wollte, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern vor allem ohne Rücksicht auf die republikanische Partei, unter deren Banner er gewählt wurde. Seit mehr als fünf Jahrzehnten kokettiert die republikanische Partei mit Anti-Intellektualismus – schon Eisenhower, Nixon und Reagan präsentierten sich als „Männer von nebenan“. Da wundert es kaum, dass diese Strategie nun von einem politischen Außenseiter auf die Spitze getrieben wurde. Mit der Tea Party hatte seit den Kongresswahlen 2010 die schleichende Infiltrierung der Partei begonnen. Von den Regionalparlamenten bis in den Kongress – true conservatives fanden Einzug in das Repräsentantenhaus und den Senat und fühlten sich wohl in der Rolle der laut bellenden Opposition.
Ehemalige Senatoren kommentierten die politische Atmosphäre auf dem Hill in Washington, DC: Republikaner und Demokraten hätten sich schon immer bekämpft, aber wenigstens seien Kompromisse und Fortschritt früher noch möglich gewesen.
Trump wird ohne Parteiloyalitäten regieren
Die Tea Party hat Rechtspopulismus in den USA wieder salonfähig gemacht und professionell organisiert. Von Protestmärschen über Graswurzel-Kampagnen, Tür-zu-Tür-Wahlkampf, umfangreichen Email-Listen mit potenziellen Wählergruppen bis hin zur Erneuerung der republikanischen Partei mit „wahrhaft konservativen“ Abgeordneten – die Tea Party hat die Basis aufgerüttelt und mobilisiert. Darauf konnte Donald Trumps Wahlkampfteam zurückgreifen.
Trump wird kein „Tea Party“-Präsident sein. Er wird auch kein republikanischer Präsident sein. Er wird ein Präsident sein, der gegen den Status Quo regiert – ohne Parteiloyalitäten. Gerade deshalb sehen ehemalige „Tea Party“-Anhänger die Chance, von jetzt an ihre ganz persönliche konservative Agenda voranzutreiben. So zum Beispiel Dustin Stockton, ein ehemaliger Aktivist, der zeitweise beim konservativen Nachrichtenportal „Breitbart News“ als Reporter arbeitete und nun seine Beraterfirma mit eigenem Nachrichtenportal unter dem Namen America First Project gegründet hat, mit der er „Trumps populistisch-nationalistische Agenda“ vorantreiben will.
VP Mike Pence – ein „Tea Party“-Anhänger erster Stunde
Weitaus größeren Erfolg, eine wahrhaft konservative Agenda voranzubringen, dürfte Trumps Vizepräsident Mike Pence haben, einer der ersten republikanischen Abgeordneten, der sich 2010 der Tea Party anschloss und ihre Positionen im Kongress vertrat. In der Trump-Administration wird der ehemalige Gouverneur von Indiana einen enormen Handlungsspielraum haben – wie die „New York Times“ vor ein paar Monaten berichtete, wurde Pence der Job zusammen mit dem Versprechen angeboten, dass „er einer der mächtigsten Vizepräsidenten in der Geschichte sein würde… federführend in nationalen und internationalen Angelegenheiten“.
Mit Donald Trump, Mike Pence und weiteren Erzkonservativen wie dem neuen Chefberater Stephen Bannon ist die politische Rebellion, die 2009 mit der Tea Party begann, im Weißen Haus angekommen. Wenn sich der neue Chef in der Pennsylvania Avenue weiterhin nicht an die politischen Spielregeln hält, könnten zwei „Tea Party“-Aktivisten Recht behalten, die nach der Entstehung der neuen „Tea Party“-Bewegung schrieben: Die erste amerikanische Revolution habe 1775 mit einem Gewehrschuss begonnen, die zweite Revolution mit einem Hashtag.

Charlotte Potts: „Protest im Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Nomos Verlag, 84 Euro.