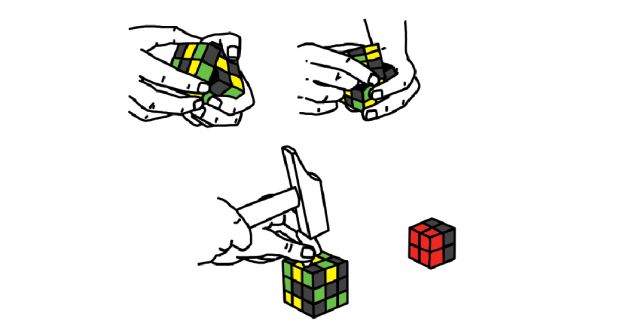Die Deutschen wählen alle vier Jahre einen neuen Bundestag. Dabei sind sich die führenden Politiker von Union und SPD heimlich schon lange einig, dass es klüger wäre, nur alle fünf Jahre wählen zu lassen. Aber die Verlängerung der Legislaturperiode, die es in fast allen Bundesländern schon gegeben hat, fand aus Mangel an Mut wieder keinen Eingang in den neuen Koalitionsvertrag.
Diesmal wird die Regierung aber noch kürzer regieren. Nur noch dreieinhalb Jahre bleiben bis zur nächsten planmäßigen Bundestagswahl im Herbst 2021, denn es hat diesmal fast ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt eine Regierung zu bilden. Das war außergewöhnlich, liegt aber dennoch im Trend: Vergingen seit der Wende im Schnitt 46 Tage zwischen Bundestagswahl und Amtseid der Kanzler, so stellte die Große Koalition schon 2013 mit 86 Tagen einen neuen Rekord auf.
Vorher wurde dieser interessanterweise von der sozialliberalen Koalitionsverhandlung von 1976 gehalten. Damals brauchte ein Bündnis, das sich politisch eigentlich schon auseinandergelebt hatte, mehr als 70 Tage, um sich noch einmal zusammenzuraufen. Prinzipiell scheint für politische Ehen die Dauer der Anbahnung ein ziemlich verlässlicher Indikator für deren Haltbarkeit zu sein: Sowohl die erste rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer (1998) als auch die erste gewählte schwarz-gelbe unter Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher (1983) sowie die erste sozialliberale unter Willy Brandt und Walter Scheel (1969) brauchten nur 30 Tage oder weniger, um sich zu finden. Auch politische Liebesheiraten werden stürmischer geschlossen als Vernunftehen.
Aber wie geht das überhaupt, eine Koalition zu schmieden? Im Sozialkundebuch meines Sohns kann ich nachlesen: Die Parteien vergleichen ihre Programme und setzen um, was sie gemeinsam haben. Aber das kann nicht stimmen, denn dann hätten zumindest CDU und SPD für die Regierungsbildung diesmal höchstens zwei Stunden gebraucht. Denn die Parteiprogramme der Volksparteien haben sich in der Ära Angela Merkel bis zum Verwechseln angeglichen. Dies führte in den Groko-Verhandlungen teilweise zu absurden Szenen. Nach einer langen Nachtsitzung der AG Familie in der bayerischen Landesvertretung twitterte der SPD-Sprecher Serkan Agci: „Manuela Schwesig und Hubertus Heil verkünden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Well done, SPD!“ Agci handelte sich postwendend die Antwort von CDU-Sprecher Jochen Blind ein: „Stand ja auch in unserem Regierungsprogramm!“
Die Fachpolitiker der großen Parteien ticken mittlerweile so ähnlich, dass sie sich schneller miteinander als mit Parteifreunden anderer Spezialgebiete einigen. In den Verhandlungen 2013 türmten Christ- und Sozialdemokraten in den Arbeitsgruppen so viele Vorschläge für neue Gesetze und Wohltaten aufeinander, dass Merkel nach einer Woche die Notbremse ziehen musste und alles demonstrativ unter Finanzierungsvorbehalt stellte. Auf der AG-Ebene wird nur dort gestritten, wo noch weltanschauliche Differenzen übrig sind: So knallte es 2013 in der AG Familie, in der die CSU damals noch nicht bereit war, der für die SPD federführend verhandelnden Manuela Schwesig die Dauerkinderbetreuung durch den Staat und die Homo-Ehe zuzugestehen.
In dieser Koalitionsverhandlung stritten dann Männer: Der stellvertretende SPD-Chef Ralf Stegner und die CSU-Vertreter Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer gerieten in der Flüchtlingspolitik heftig aneinander und warfen sich gegenseitig Tricksereien vor. Schließlich nahmen ihnen die Fraktionschefs Andrea Nahles und Volker Kauder die Entscheidung über den Familiennachzug für subsidiär Anerkannte ab.
Erst der Rahmen, dann das Bild
Die Fachpolitiker können sich aus Sicht der Parteiführung also sowohl zu viel als auch zu wenig einig sein. Wichtig ist das Vertrauen zwischen den „Chefs“. Schon lange vor den eigentlichen Koalitionsverhandlungen und sogar vor den Sondierungsgesprächen muss zwischen den entscheidenden Politikern klar sein, wohin die Reise geht. So einigten sich Angela Merkel und Sigmar Gabriel vor den Koalitionsverhandlungen 2013, was dabei für die SPD herausspringen müsse: ein Mindestlohn und die Rente mit 63. Die CSU bekam eine Rentenerhöhung für ältere Mütter und die umstrittene Maut. Die CDU war damit zufrieden, dass die SPD ihre Forderung nach Steuererhöhung fallen ließ.
Der Rahmen steht also schon, bevor das Bild gemalt wird. Auch in der neuen Groko gab es eine frühe Absprache: Nur mit einer europapolitischen Wende könne die SPD-Basis motiviert werden, noch einmal mitzumachen. Interessanterweise trat der langjährige Europapolitiker Martin Schulz in diese Absprache nur nachträglich ein. Zunächst hatten diesen Plan wieder Merkel und Gabriel ausgeheckt. Es ist eines der letzten offenen Rätsel über die gescheiterte Jamaika-Sondierung: Warum gab es diesmal keine Vorfestlegung der Parteiführungen auf große Linien? Oder – wenn es sie doch gab – warum hielt sie nicht?
Die eigentlichen Koalitionsverhandlungen funktionieren dann nach einem hierarchischen Verfahren: In den Arbeitsgruppen handeln Fachpolitiker Kompromisse für ihre jeweiligen Themenfelder aus. Jeder darf Lieblingsprojekte hineinschreiben, bei echten Streitfällen wird um Kompromissformulierungen gerungen. Werden diese nicht gefunden, kommen „eckige Klammern“ ins Spiel. Sie umschließen die im Jargon „nicht geeinten“ Streitfälle.
Die Arbeitsgruppen liefern sodann ihre Textbausteine (geeint oder nicht geeint) in die sogenannte „große Runde“. In diesem Gremium – bei der Groko waren es zuletzt 15 Personen – werden fachgebietsübergreifende Kompromisse versucht: Eine eckige Klammer im Energiepapier wird vielleicht eher in Richtung der SPD aufgelöst, wenn in der Innenpolitik im Gegenzug ein strittiger Punkt nach den Vorstellungen der Union geklärt wird.
Deshalb ermuntern die Parteiführungen die Fachpolitiker nicht immer zu Kompromissen. Eckige Klammern können Tauschmaterial sein, um an anderer Stelle Zugeständnisse heraushandeln zu können. Es gibt aber auch das gegenteilige Phänomen: dass sich Arbeitsgruppen gegen ihre Parteiführungen verbünden. So galt 2009 die Arbeitsgruppe Innenpolitik als die Achillesverse der werdenden schwarz-gelben Koalition. Doch die führenden Unterhändler – Wolfgang Schäuble und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger produzierten in Rekordzeit ein völlig sauberes Papier: ohne eine einzige eckige Klammer. Die Vollprofis wollten ihre Kompromisse lieber selbst machen – und selbstbewusst in der Öffentlichkeit vertreten.
Das Gegenteil geschah bei den geplatzten Jamaika-Sondierungen Ende 2017: Als der FDP-Vorsitzende Christian Lindner die Bundeskanzlerin in der Landesvertretung Baden-Württemberg zurückließ, enthielt das Sondierungspapier noch mehr als 200 eckige Klammern.
Selbstverständlich haben Koalitionsverhandlungen noch eine weitere Funktion: ein Schau- und Warmlaufen für die Postenvergabe. Wer mit der Leitung einer AG beauftragt wird und dies gut macht, könnte das Ressort auch kurz darauf als Minister übernehmen. Sicher ist das aber keineswegs.
So erlebte etwa der junge CDU-Hoffnungsträger Jens Spahn bei den Koalitionsverhandlungen 2013 eine echte Achterbahnfahrt: Zunächst war er nur unter ferner liefen eingeplant. Dann entriss Merkel die Verhandlungsführung zum wichtigen Thema Gesundheit einer bereits dafür eingesetzten Politikerin und gab sie Spahn. Der hatte sich schon als Abgeordneter einen Namen in diesem Themenfeld gemacht, verhandelte jetzt und sah sich – da das Gesundheitsressort anschließend an die CDU ging – schon damals als gesetzter Minister. Der Anruf der Kanzlerin ereilte allerdings Hermann Gröhe, der vorher nie als Gesundheitspolitiker aufgefallen war. Spahn musste vier weitere Jahre auf das Ministeramt warten und ging 2013 sogar bei der Verteilung der Trostpreise „Parlamentarischer Staatssekretär“ leer aus.
Der Koalitionsvertrag als To-do-list
Die Frage, wie wichtig ein Koalitionsvertrag tatsächlich für die Arbeit einer Regierung ist, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Es gibt Minister, die ihren Teil des Koalitionsvertrags tatsächlich wie einen Arbeitsauftrag Punkt für Punkt abarbeiten: Ein Beispiel dafür war Gesundheitsminister Gröhe in der vergangenen Legislaturperiode. Der Merkel-Vertraute agierte dennoch nicht ohne Kreativität: Gröhe konzentrierte seinen Ehrgeiz auf das Timing. Nicht zufällig wurden die großen Pflegereformen, die Verbesserungen für Hunderttausende Familien bedeuten, ausgerechnet im Jahr der Bundestagswahl Gesetz.
Die fast sklavische Abarbeitung des Koalitionsvertrags in der vergangenen Groko war einerseits Ausdruck des großen Misstrauens zwischen den Koalitionspartnern; man hielt sich lieber an einen Vertrag, als neue politische Debatten zu wagen. Der zweite Grund hat einen Namen: Peter Altmaier. Der ehemalige Kanzleramtschef hatte die Koalitionsvereinbarung haarklein in eine Vorhabenplanung übersetzt, die schon äußerlich wie eine To-do-list daherkam.
Nicht binden lässt sich hingegen die Kanzlerin. Die großen Strukturentscheidungen der Ära Merkel (Euro-Rettungsschirme, Atomausstieg, Abschaffung der Wehrpflicht und Grenzöffnung) haben alle eines gemeinsam: Sie standen in keinem Koalitionsvertrag.
In der Schlussphase verengen sich Koalitionsverhandlungen immer stärker: Dann tagen die AGs nicht mehr und irgendwann auch nicht mehr die „große Runde“. Nun machen es die Parteichefs unter sich aus; manchmal ziehen sie noch den Finanzminister hinzu, der oft im allerletzten Moment noch einen zusätzlichen Finanzspielraum findet, um mit Geld die Kompromissfindung zu ölen. Die letzten eckigen Klammern werden verdealt, dann geht es an die Ressortverteilung. Die erfolgt klassisch nach dem Zugriffsprinzip: Die größte Partei darf sich zuerst einen Posten aussuchen, dann die zweitgrößte und so weiter.
Das führt – paradoxerweise – dazu, dass CDU-Politiker sich hinten anstellen müssen. Denn als erster Zugriff wird das Kanzleramt gewertet. Die schönen Ministerien bekommen dann die kleineren Partner, die größte Partei ist erst in der zweiten Runde dabei. Bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen trieb Martin Schulz das auf die Spitze, indem er drei Top-Posten für seine SPD forderte und sogar das Angebot ausschloss, in der ersten Runde des Zugriffsverfahrens zweimal zugreifen zu dürfen.
Falls sich die Spitzenpolitiker nach den anstrengenden Verhandlungen so aneinander gewöhnt haben sollten, dass sie einander vermissen, können sie beruhigt sein: Der Koalitionsausschuss tritt auch in der Legislaturperiode zusammen. Wann und wer sich dort trifft, ist allerdings sehr verschieden: Bei Schwarz-Gelb rangen große Runden miteinander – und bescherten den Journalisten schöne Geschichten, wer wen über den Tisch gezogen habe. In der letzten Groko setzte Angela Merkel durch, dass sie sich nur noch mit Horst Seehofer und Sigmar Gabriel treffen musste. Feste Termine dafür gab es nicht.
In der neuen Groko ist diese nicht unwesentliche Frage erstaunlicherweise offengelassen worden. Der Koalitionsausschuss tritt zusammen, falls eine Partei dies wünscht, heißt es nur. Über die Zusammensetzung des Gremiums wolle man „einvernehmlich“ entscheiden. Das bedeutet: In den Koalitionsverhandlungen konnte man sich über den Koalitionsausschuss noch nicht einigen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe N° 122 – Thema: Wie sich das politische Berlin neu aufstellt. Das Heft können Sie hier bestellen.