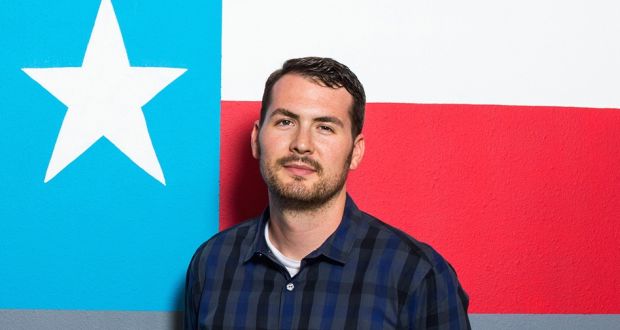Herr Harris, können Sie uns ein Beispiel dafür geben, wie Social Tools neue Möglichkeiten in der digitalen politischen Kommunikation eröffnen, wenn es um das Targeting bestimmter Zielgruppen geht?
Wir hatten als erste überhaupt einen politischen Filter. Das war während der ersten Debatte der Republikaner in Ohio und etwa um die Zeit des Atomabkommens mit dem Iran. Dafür haben wir einen Snapchat-Filter mit einem Pfeil verwendet, der auf den Satz „Wie ich das schlechte Atomabkommen mit dem Iran finde“ zeigte. Die Leute haben Pferdeäpfel fotografiert oder sich selbst mit dem Stinkefinger, lächelnd oder mit dem Daumen nach unten … In Ohio hatten wir an einem Tag mehr als 130.000 Aufrufe. Sehr viele Leute haben den Filter genutzt, aber im Vergleich zu einem Giganten wie Facebook ist das gar nichts. Tatsächlich verliert Twitter jetzt auch etwas an Bedeutung. In den USA hat Instagram mehr aktive Nutzer als Twitter. Twitter ist nach wie vor wichtig für die politischen Eliten, für die Journalisten und für das politische Personal, also natürlich für Leute wie Präsident Donald Trump, aber wenn man eine Nachricht an eine große Anzahl von Wählern bringen möchte, muss man als erstes auf Facebook gehen und wahrscheinlich als zweites auf Instagram.
Was für eine Datenerfassungsarbeit ist durch Instagram möglich?
Da Instagram zu Facebook gehört, gibt es dort eine Menge Informationen über einzelne Wähler. Angenommen wir haben eine Liste für Florida, da können wir ganz ausgeklügelt vorgehen, wir wissen, wer in dem Bundesstaat vorzeitig und wer per Briefwahl wählt. Also können wir eine Liste von Menschen in Florida auf Facebook und auf Instagram ansprechen, die schon einmal per Briefwahl gewählt haben und sie zu dem Zeitpunkt, zu dem sie wieder per Briefwahl abstimmen, mit bestimmten Werbeinhalten adressieren. Das Targeting funktioniert auf individueller Basis, auf Haushaltbasis, anhand der E-Mail-Adresse, der Telefonnummer. Und auf jeden Fall kann man Informationen über bestimmte Personen sammeln, man kann E-Mail-Adressen sammeln, wenn einem jemand per Opt-in über Facebook Informationen gibt, man kann Profilinformationen bekommen und diese in die eigene Datenbank einpflegen.
Wie wirken sich die unterschiedlichen internationalen Ansätze in Sachen Datenschutz auf Ihre Arbeit aus?
In Europa variieren die Bestimmungen je nach Land, es gibt wesentlich fortgeschrittene Datenschutzgesetze. In den USA läuft es in etwa so: „Fragen Sie nicht nach Datenschutz, und Sie können die Informationen abgreifen.“ Hier heißt es: „Fragen Sie zuerst nach dem Datenschutz.“ Auf jeder Webseite, die Sie besuchen, steht: „Ihre Informationen werden möglicherweise erfasst.“ In den USA ist das nicht möglich. Manche Staaten fangen jetzt damit an – Kalifornien hat andere Datenschutzgesetze für Webseiten als alle anderen Bundesstaaten. Aber generell kann man viele Informationen online erfassen, und man kann die Leute mit fast jedem Attribut und fast allem, was sie anklicken, targeten.
Als Marketer, könnte ich mir vorstellen, bevorzugen Sie sicher die US-amerikanische Variante, aber finden Sie es als Privatperson gut, dass Europa strengere Datenschutzvorkehrungen hat?
Da bin ich geteilter Meinung. Als Marketer in den USA bin ich froh, dass wir diese Offenheit haben, aber als Privatperson wären die Gesetze, die Deutschland zum Schutz der Privatsphäre des Einzelnen hat, für mich in Ordnung. In Deutschland kann man zum Beispiel keine Remarketing-Anzeige schalten, das heißt, wenn jemand auf die Webseite der CDU geht, dann können Sie keinen Cookie in dessen Browser setzen und ihm dann im Internet hinterherjagen. In den USA ist das mehr oder weniger das Einmaleins des Marketings.
In welchem Maße ist das Internet für den Erfolg von populistischen Parteien verantwortlich?
Die populistischen Parteien profitieren von den sozialen Medien und davon, dass das Internet zunehmend als Hauptinformationsquelle dient. Früher wurde manches von dem, was die populistischen Parteien von sich gaben, in den Mainstream-Medien abgeschmettert. Aber die Leute, die online sind, brauchen sich ihre Informationen nicht mehr von den Mainstream-Medien zu holen, sie können sich auf Plattformen wie Facebook oder in Whatsapp-Gruppen organisieren, und dann miteinander kommunizieren, ob sie wählen gehen, ob sie ehrenamtlich tätig werden, über Spendenkampagnen. Den ganzen Apparat der traditionellen politischen Parteien brauchen sie nicht.
Laufen Reizthemen auf digitalen Medien besser als andere Themen?
Man muss irgendetwas sagen, was die Leute online anheizt, was sie dazu bringt, den Teilen-Button zu klicken. Man klickt auf „Teilen“, wenn einen etwas leidenschaftlich bewegt. Eine der wichtigsten Kennziffern in der politischen Meinungsumfrage ist der „Passion Index“. Wie leidenschaftlich empfinden die Leute einen Politiker oder ein bestimmtes Thema? Finden Sie es „irgendwie wichtig“ oder brennen sie dafür?
Schadet dieses Anstacheln nicht letztendlich der politischen Debatte?
Leidenschaft und Anheizen funktionieren online. So kann man Geld sammeln, so bekommt man Anteile. In der Politik organisiert man die Leute zu solchen aufgeladenen Themen, seien es linke Themen, wie Abtreibung, oder rechte, wie Waffen, das sind motivierende Diskurse, zu denen die Menschen sehr leidenschaftlich Meinungen vertreten. Aber als Bürger der USA, der die westliche Demokratie unterstützt, macht diese übermäßig gespaltene politische Landschaft mich traurig, in der Leute dafür belohnt werden, dass sie einen Keil zwischen sich und andere treiben. Die digitalen Medien ermöglichen es Marketern, Öl auf heiße Themen zu gießen, und im Internet bekommen reißerische Meldungen am meisten Aufmerksamkeit.
Was sind die Konsequenzen?
Wir alle müssen uns fragen – und das ist eine philosophische, eine ethische und vielleicht eine religiöse Frage – ist das für uns aus der Perspektive der Kommunikation in Ordnung? Ein Politikwissenschaftler aus Princeton, Marcus Prior, hat ein wunderbares Buch mit dem Titel „Post-Broadcast Democracy“ geschrieben, in dem er zeigt, wie sich die Wähler, vor die Wahl zwischen Nachrichten, Sport und Unterhaltung gestellt, gegen Nachrichten entscheiden. Die Leute haben eine große Auswahl, was aus demokratischer Perspektive ein Problem ist, weil sie sich den politischen Nachrichten und Informationen lieber entziehen. Wie erreichen wir sie also? Mit reißerischen Meldungen. Und bis sich das ändert, brauchen wir, wenn wir online die Aufmerksamkeit der Wähler erregen wollen, ein leidenschaftlich diskutiertes Thema.
Führt Microtargeting dazu, dass der politische Diskurs parteiischer geführt wird?
Natürlich. Durch Microtargeting können zum Beispiel Waffenbesitzer angesprochen und zum Thema Gesetzgebung aufgestachelt werden, indem man sagt: „Die Linken wollen euch die Waffen wegnehmen.“ Wir können LGBT-Vertreter anvisieren und sagen: „Dieser oder jener Republikaner will euch das Recht zu heiraten absprechen.“ Mit Microtargeting kann man den Leuten leichter Angst einjagen. Aber auf der positiven Seite ermöglicht es einem, den relevanten Leuten genauere Informationen zukommen zu lassen. Wir sind jetzt in der Lage, den Leuten, die tatsächlich auf der Empfängerseite bestimmter Politikmaßnahmen sind, komplexe Informationen zu liefern.
Besteht eine Möglichkeit, dass die digitalen Medien entgegengesetzte politische Interessen näher zusammenbringen können?
Es gibt eine Theorie, dass das Internet dazu beiträgt, die politische Spaltung aufzuheben. Diese Theorie heißt „incidental exposure“ (zufälliges Ausgesetztsein). Das heißt, wenn man links ist und MSNBC guckt und alle Freunde auch links sind und man in New York City wohnt, dann würde man normalerweise vielleicht nie zu hören bekommen, was ein Republikaner zu sagen hat. Aber wenn die eigene Schwester in Florida wohnt, dann wird man zufällig oder unabsichtlich Informationen ausgesetzt, die man normalerweise nicht online sehen würde. Diese beiden konkurrierenden Vorstellungen – selektives Ausgesetztsein, bei dem wir in einer Echokammer leben, und zufälliges Ausgesetztsein – bekämpfen einander aus der Kommunikationsperspektive, und im Moment weiß niemand in den westlichen Demokratien genau, welche von beiden die Oberhand gewinnt.
Hinweis: Dieses Interview entstand, bevor bekannt wurde, dass die Firma von Vincent Harris für die AfD arbeitet.