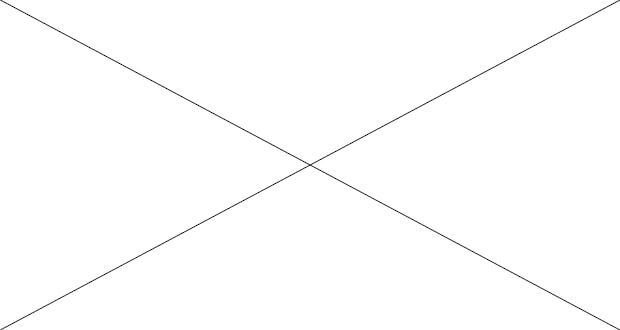p&k: Herr Professor Bieber, welche Lehren können die deutschen Parteien aus dem Online-Wahlkampf in den USA ziehen?
Bieber: Der Lerneffekt ist meiner Meinung nach begrenzt. Denn die wichtigste Innovation des US-Wahlkampfes – der Umgang mit großen Datenmengen – lässt sich nicht auf Deutschland übertragen, weil es bei uns keine kommerziellen Datenhändler gibt. Es gab aber durchaus Kampagnentrends in den USA, an denen sich deutsche Parteien orientieren können.
Zum Beispiel?
Ich glaube, dass man das in den USA praktizierte Microtargeting auch in Deutschland verfolgen wird. Aber weniger in digitaler Form, sondern unter anderem durch Canvassing. Das war nämlich die zweite Lehre des US-Wahlkampfes: Neben dem Digitalen muss das Analoge wieder in den Mittelpunkt rücken. Dass diese Botschaft auch in Deutschland angekommen ist, zeigen nicht zuletzt die Wohnzimmer-Gespräche von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück: Man möchte in den Alltag der Bürger zurück.
Werden wir in Deutschland eine Professionalisierung des Online-Wahlkampfes in Deutschland erleben?
Man sollte den Begriff der Professionalisierung nicht überstrapazieren. Auch 2009 waren keine Amateure am Werk. Im bevorstehenden Bundestagswahlkampf werden normale Lernschritte stattfinden, wie alle vier Jahre. Einen amateurhaften Online-Wahlkampf haben 2009 nur die Piraten gemacht – und genau dies war damals das Erfolgsrezept. Bei ihnen werden wir auch dieses Jahr keine massive Professionalisierung durch Agenturen und Berater erleben, das wäre kontraproduktiv für das Selbstverständnis und die Arbeitsweise der Partei.
Welchen sozialen Medien wird vermutlich die größte Bedeutung zukommen?
Facebook wird auf Bundesebene zum ersten Mal wirklich wichtig werden. 2009 war Facebook nur eines der kleineren sozialen Netzwerke und hat keine nennenswerte Rolle gespielt. Auf Facebook den richtigen Ton zu finden, ist für Politiker jedoch alles andere als einfach.
Warum?
Weil sie dort eine Konkurrenzsituation bewältigen müssen: Sie dürfen die Adressaten in den sozialen Netzwerken den Parteimitgliedern gegenüber nicht bevorzugen. Deshalb werden sich die Parteien hierzulande nicht so massiv an Facebook orientieren wie in den USA. Innovative Impulse erwarte ich hier nicht.
Wie sieht es mit Twitter aus?
Twitter halte ich für deutlich spannender, weil es persönlicher ist, inzwischen auch von den etablierten Medien registriert wird und man damit besser Themen setzen kann. Dennoch hat Twitter das Problem zu geringer Reichweiten. Eine größere Rolle als bisher werden Online-Videos spielen, die bislang im Wahlkampf eher ein Schattendasein fristeten.
Welche Rolle spielt der sogenannte Peer-Pressure-Effekt in den sozialen Netzwerken?
Studien aus den USA zeigen, dass Freunde auf Facebook dazu beitragen können, eine Parteipräferenz zu verstärken. Politikern, die in diese persönlichen Öffentlichkeiten eindringen wollen, sollte aber bewusst sein, dass sie damit Druck ausüben. Dass das nicht unproblematisch ist, hat das Beispiel USA gezeigt. Dort hat man es mit dem Peer Pressure teilweise übertrieben, nach dem Motto „Geh doch mal zu deinem Nachbarn drei Häuser weiter, der war die letzten Male nicht wählen.“ Da wurde es einigen schon etwas mulmig, was die Kampagnenakteure alles wussten.
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ist kein Freund der sozialen Netzwerke. Ein Nachteil für den Internet-Wahlkampf der SPD?
Überhaupt nicht. Wenn man wie die SPD klar kommuniziert, dass man die sozialen Medien instrumentell und selektiv nutzt, dann braucht man sich keine Sorgen zu machen. Steinbrück als Online-Kandidat zu inszenieren, wäre der falsche Weg. Ihn durch Aktionen wie den „Peerblog“ von außen zu unterstützen, allerdings auch. Im Übrigen: Auch Angela Merkel ist keine versierte Social-Media-Politikerin.
Welche Chancen bietet der Online-Wahlkampf für die Wählermobilisierung?
Angesichts der schwindenden Zahl der Parteimitglieder und der sinkenden Wahlbeteiligung sollten sich die Parteien das Ziel setzen, möglichst viele Bürger für Politik wiederzugewinnen und sie zurück an die Urne zu bringen. Die Dialog-Projekte und das kollaborative Schreiben an Parteiprogrammen sind dabei nicht so hilfreich, da sie auf eine recht kleine Klientel zielen. Insgesamt sollte man versuchen, etwas niedrigschwelligere Angebote zu machen und dadurch höhere Reichweiten zu erzielen – das gelingt bei jüngeren Wählergruppen bereits ganz gut.
Kann das Internet wahlentscheidend sein?
Der tatsächliche Einfluss des Internets auf den Wahlausgang lässt sich bislang nicht wirklich messen. Einiges spricht aber dafür, dass bei knappen Wahlausgängen das Internet sehr wohl eine Rolle spielen kann. In Deutschland wird dies durch das Aufkommen der Piratenpartei unterstrichen. Auch wenn die Piraten bei der Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde verfehlen würden, so binden sie doch einige Wählerstimmen. Und im Fall eines knappen Wahlausgangs könnten genau dies entscheidende Stimmen sein.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Im Auftrag des Herrn – wie die Kirche ihre Macht wahrt. Das Heft können Sie hier bestellen.