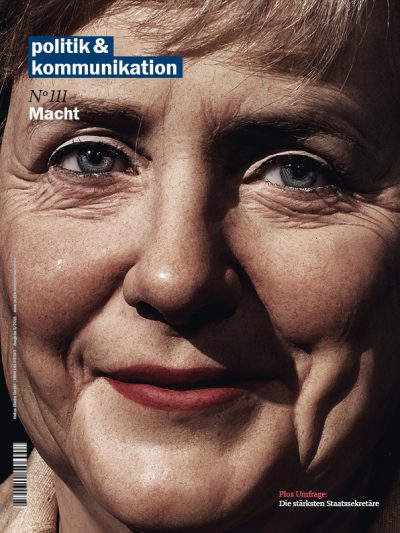Bush gegen Clinton? „Die Neunziger haben angerufen, sie wollen ihre Präsidentschaftswahl zurück“, witzeln Amerikaner schon jetzt, mehr als 500 Tage vor dem nächsten Urnengang. Tatsächlich mutet es seltsam an, dass 2016 trotz Beschränkungen von Amtszeiten dieselben Familiennamen auf dem Wahlzettel stehen könnten wie vor 25 Jahren. Gerade weil es unwahrscheinlich ist, dass Jeb Bush – Sohn des 41. und Bruder des 43. Präsidenten Bush – der 45. Präsident der Vereinigten Staaten wird, ist es vor allem Hillary Clinton, die an diesem Spin am meisten zu verlieren hat – und bereits verloren hat.
Image der intransparenten Familie
Die Hürde, die Clinton bei den Vorwahlen 2008 nicht überwinden konnte, ist der Hunger der Wähler nach etwas Neuem. Deshalb hat sie sich für diese Wahl neu aufgestellt: Ihr Team besteht aus einer neuen Generation von Wahlkampfberatern; ihre Kampagne wirkt optisch und strategisch jung und frisch; die Themen, zu denen sie sich äußert, sind betont fortschrittlich.
In vielen Bereichen holt Clinton jedoch die Tatsache ein, dass sie und ihr Mann seit Langem in der Öffentlichkeit stehen und in unterschiedlichen Funktionen aktiv waren: Kürzlich erschien ein Buch, in dem behauptet wird, die Clinton Foundation habe von internationalen Regierungen für den Zugang zur damaligen Außenministerin Geld genommen. Auch wenn der Großteil der Anschuldigungen faktisch nicht haltbar ist, verstärken sie doch das Image der intransparenten Familie.
Auch der Schachzug Jeb Bushs, der vor Monaten seine E-Mails aus seiner Zeit als Gouverneur veröffentlichte, ist zu einem Großteil seinem Nachnamen und der politischen Vergangenheit seiner Familie geschuldet. Doch natürlich hat es bei Weitem nicht nur Nachteile, eine Clinton oder ein Bush zu sein. Der erste Schritt jeder Kandidatur besteht darin, die eigene „Name ID“ zu stärken, um in einer Umfrage erkannt zu werden. Das kostet viel Geld und Zeit – zumindest diejenigen, deren Name niemand kennt.
Vor diesem Hintergrund war die Überraschung groß, als 2011 der letzte Kennedy beschloss, nicht mehr zu kandidieren: Zum ersten Mal seit 1947 diente im US-Kongress damit kein Kennedy mehr. Die Pause währte dann allerdings nur zwei Jahre: Seit 2013 ist Joe Kennedy Kongressabgeordneter für Massachusetts. Bei einigen ausgewählten Namen fungiert die Dynastie nämlich als Ersatz für Parteien. In Massachusetts wird noch immer oft nicht die Demokratische Partei gewählt, sondern man wählt die Kennedys. Doch Branding alleine ist als Erklärung nicht genug. Auch der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo und der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, gehören zum Kennedy-Clan, ohne den Namen zu tragen.
Familien im Rampenlicht
Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass uns Dynastien in den USA mehr auffallen als hierzulande: Die Persönlichkeitswahl ist natürlich ein entscheidender Faktor. Bei jeder Wahl, also nicht nur beim höchsten Amt, sondern ebenso beim sprichwörtlichen Hundefänger, School Board oder Sheriff werden Namen und nicht Parteien gewählt. Dementsprechend müssen sich Kandidaten vor allem auf ihre persönlichen Netzwerke und nicht auf die ihrer Partei verlassen. Je teurer Kampagnen werden, desto schwerer haben es die ohne Netzwerk. Wer allerdings nicht der erste in seiner Familie ist, der für ein Amt kandidiert, kann sich beim Fundraising und Einholen sonstiger Gefallen natürlich auf einen Startvorteil verlassen.
Auch im Regierungshandeln liegt der Fokus auf individuellen Personen: Während hierzulande, zumindest formal, Parteigremien über viele wichtige Angelegenheiten abstimmen, entscheiden diese Dinge in den USA Einzelpersonen. Dementsprechend werden politische Erfolge auch Personen zugeschrieben. Letztlich ist es auch auf eine mediale Dynamik zurückzuführen, dass Dynastien in den USA präsenter sind als bei uns: Die Familie eines Politikers steht automatisch in der medialen Öffentlichkeit und kann dieses öffentliche Kapital zu einem späteren Zeitpunkt in politische Macht umwandeln.
Die politische Wiege
Doch ist das US-amerikanische politische System tatsächlich anfälliger für Dynastien oder fällt es bloß mehr auf, weil bei Präsidentschaftswahlen Familiennamen auf dem Wahlzettel stehen? Deutschland hat ja durchaus auch die eine oder andere Dynastie anzubieten – man denke nur an die Familien von Weizsäcker, zu Guttenberg oder de Maizière.
Und ab wann ist eine Dynastie eine Dynastie? Zwischen Jeb Bush und Hillary Clinton besteht ja ein wesentlicher Unterschied: Der eine ist der Enkel eines Senators, der Sohn eines Präsidenten, der Bruder eines zweiten und der Vater eines texanischen Politikers. Die andere ist die erste in ihrer Familie und lediglich die zweite in ihrer angeheirateten Familie, die präsidiale Ambitionen hat. Eine politische Karriere wurde Clinton also keineswegs in die Wiege gelegt, wie ein direkter Vergleich mit Bush zu unterstellen versucht.
Die ehemalige First Lady ist auch nicht so abhängig von der Karriere ihres Mannes, wie manche gern behaupten: Tatsächlich hätte Hillary Clintons Karriere wahrscheinlich sogar viel früher begonnen, wäre sie ihrem Freund Bill nicht nach Arkansas gefolgt, sondern in Washington geblieben. Es ist also Taktik, wenn Bush und Clinton vor allem von anderen republikanischen Kandidaten in einen Topf geworfen werden.
Sich von ihrer gemeinsam erschaffenen Stärke zu distanzieren, ergibt für Hillary Clinton aber dennoch keinen Sinn. Allein deshalb, weil Bill schon jetzt die Rolle besetzen kann, die normalerweise Vizekandidaten ausüben – also Wählerschichten ansprechen, die der Kandidatin selbst skeptisch gegenüber stehen. Und im Gegensatz zu George W. Bush muss man Bill Clinton im Hinblick auf seine Beliebtheitswerte nicht verstecken.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation II/2015. Das Heft können Sie hier bestellen.