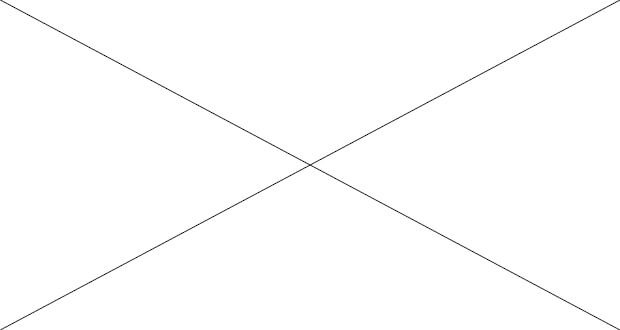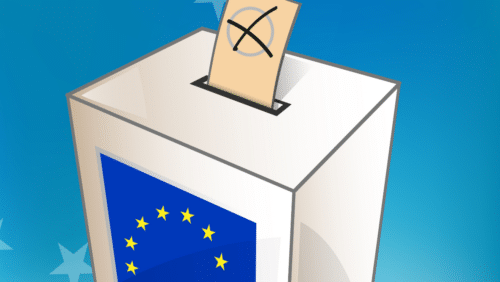Als der Finanzausschuss des Bundestags über das Wachstumsbeschleunigungsgesetz beriet, lud er 16 Sachverständige zur öffentlichen Anhörung. Die Experten kamen an einem Montagvormittag im vorigen November ins Marie-Elisabeth-Lüders-Haus an der Spree. Dort diskutierten sie den Gesetzentwurf mit den Abgeordneten – und nahmen auch Stellung zu der darin enthaltenen Mehrwertsteuer-Ermäßigung für Hoteliers: „Das ist eine Subvention, die nicht in das Umsatzsteuergesetz gehört“, meinte der Herr von der Deutschen Steuergewerkschaft. Ein Wirtschaftsprofessor merkte an, es liege wohl eher ein „Subventionswachstumsbeschleunigungsgesetz“ vor, die Vergünstigung sei jedenfalls „aus steuersystematischen Gründen nicht zu rechtfertigen“. Und der Vertreter des Steuerberaterverbands beklagte, dass der Steuernachlass dem Bürokratieabbau entgegenstehe, da er die Abrechnung für Hoteliers doch arg verkompliziere. Am Ende sprachen sich 15 der 16 Sachverständigen dagegen aus, und nur die Vertreterin des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes fand sie, nicht gänzlich überraschend, gut.
Und dennoch: Gegen den Rat der Experten beschloss der Bundestag dann im Dezember das Geschenk an die Hoteliers, das volkswirtschaftlich sinnlos ist; wenige Monate, nachdem die Große Koalition per Grundgesetzänderung die Schuldenbremse eingeführt hatte. Trauten die Koalitions-Abgeordneten im Ausschuss sich nicht, vom Kurs ihrer Regierung abzuweichen? Ging die Koalitionsräson über die Vernunft? Dann läuft womöglich etwas schief beim deutschen Gesetzgeber.
Schon Bismarck sagte, dass Gesetze wie Wurst seien: Man sei besser nicht dabei, wenn sie gemacht werden. Nun könnte der Bürger sich auf den Standpunkt stellen: Hauptsache, sie schmeckt. Doch die unter der Kuppel des Reichstags produzierte Wurst schmeckt immer seltener richtig gut. Im Falle des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes wurden sogar die begünstigten Hoteliers mit der vermeintlichen Wohltat nicht wirklich glücklich.
„Wir machen zu viele und qualitativ zu schlechte Gesetze“, konstatiert der Hamburger Rechtsprofessor Ulrich Karpen, der früher Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft war. „Gesetzesvorhaben werden zu oft in großer Hektik durch das Parlament gejagt“, sagt er. Karpen hat vor drei Jahren den Versuch unternommen, die Qualität von Gesetzen systematisch zu untersuchen. Mit einer Arbeitsgruppe der Universität Hamburg nahm er die in den ersten beiden Jahren der Großen Koalition (2005 bis 2007) entstandenen Rechtsnormen unter die Lupe, insgesamt 198 Gesetze und 500 Verordnungen. Die Ergebnisse waren nicht schmeichelhaft für Parlament und Regierung: Danach verursachten über drei Viertel der Gesetze neue Bürokratiekosten für Unternehmen, weil sie diesen Informations- und Meldepflichten auferlegten. Fast 60 Prozent der Gesetze seien nach kurzer Zeit wieder geändert worden, und ebenfalls knapp 60 Prozent hätten weitere Regelungen notwendig gemacht. Die Hälfte der Texte sei überdies sprachlich unverständlich gewesen.
Polizisten statt Normen
Karpens Schlussfolgerung: „Wir sollten das parlamentarische Verfahren entschleunigen, Gesetze öfter auf ihre Wirkung hin evaluieren – und im Zweifel auch einmal darauf verzichten, neue zu beschließen.“ Viele seien überflüssig, sagt er und nennt als Beispiel das Gesetz, das der Bundestag 2008 aus Furcht vor Neonazi-Aufmärschen erlassen hat, um den Pariser Platz in Berlin in die Bannmeile ums Parlament einzubeziehen. Karpen: „Solchen Problemen kann man durchaus auch mit den Mitteln beikommen, die der Exekutive zur Verfügung stehen.“ Polizisten statt Normen.
So vernichtend die Ergebnisse der Hamburger Studie auch sind: Die Politik ist sich des Qualitätsproblems zumindest bewusst. So installierte die Große Koalition im August 2006 per Gesetz den Normenkontrollrat, ein beim Bundeskanzleramt angesiedeltes Gremium, das ermittelt, in welchem Maß Gesetze die Wirtschaft belasten. Der aus acht ehrenamtlichen Mitgliedern bestehende Rat – Vorsitzender: der ehemalige Bahnchef Johannes Ludewig – gibt Empfehlungen ab, die mit Regierungsentwürfen an den Bundestag geleitet werden. Für seine Arbeit erntet er überwiegend Lob, und auch Karpen meint: „Die große Stärke des Normenkontrollrats besteht darin, dass er vom Parlament eingesetzt wurde und von der Regierung unabhängig ist.“
In diesem Juni hat die Regierungskoalition denn auch die Kompetenzen des Rats erweitert: Er prüft künftig nicht mehr nur die reinen Bürokratiekosten, sondern die wirtschaftliche Gesamtbelastung von Unternehmen durch Gesetze. Und während dem Gremium bisher nur Regierungsentwürfe zugeleitet wurden, können ihm künftig auch Bundestagsfraktionen Gesetze zur Prüfung vorlegen.
Politisch nicht bindend
Bleibt allerdings ein Haken: Die Empfehlungen sind nicht bindend, und kein Politiker wird sich an sie halten, wenn es ihm politisch nicht gerade in den Kram passt. So führte CSU-Chef Horst Seehofer im vorigen Jahr nicht nur die Bundeskanzlerin und den damaligen Umweltminister Sigmar Gabriel vor, als er das seit langem geplante Umweltgesetzbuch aus parteipolitischem Kalkül verhinderte. Er demonstrierte auch, dass ihn die Empfehlung des Normenkontrollrats kalt ließ: Dieser hatte berechnet, dass das Gesetz Bürokratiekosten in Höhe von 27 Millionen Euro sparen würde. Seehofer aber ließ seinen Umweltminister Markus Söder gar behaupten, es schaffe eine neue „Monsterbürokratie“ (> Seite 18). Mit solcher Missachtung wird der Rat allerdings leben müssen: Er verfügt über keine eigenen Kompetenzen im Gesetzgebungsverfahren.
Während beim Umweltgesetzbuch Parteienkalkül besseres Recht gezielt verhindert hat, fehlt oft der politische Wille, neue, einfachere Regeln zu schaffen. „Wir haben die Fähigkeit zur Kodifikation verloren“, sagt der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Günter Krings, der auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung ist. „In der Großen Koalition hätten wir nicht nur ein Umweltgesetzbuch, sondern auch ein neues Arbeitsvertragsrecht schaffen können.“
Seit den 20er Jahren diskutieren Politiker und Wissenschaftler in Deutschland darüber, das zersplitterte Arbeitsrecht zu vereinfachen. Auch Willy Brandt hatte in seiner ersten Regierungserklärung angekündigt, dieses „in einem Arbeitsgesetzbuch zusammenzufassen“. Ohne greifbare Folgen. In den 70er Jahren setzte die Bundesregierung noch einmal eine Kommission ein, die sie später wieder auflöste.
Jahrzehntelange Diskussion
Zuletzt wollte die Bertelsmann-Stiftung die Diskussion wieder anschieben und beauftragte im Jahr 2005 die Kölner Rechtsprofessoren Martin Henssler und Ulrich Preis, einen Entwurf für ein Arbeitsvertragsgesetz zu erarbeiten. Sieben andere Gesetze hätte dieser überflüssig gemacht, und die beiden Juristen erhielten dafür den „Preis für gute Gesetzgebung“, den die Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung verleiht. Doch obwohl Politiker aller Parteien eine Neuregelung befürworteten, fürchteten offenbar zu viele, den Interessen ihrer jeweiligen Klientel nicht gerecht werden zu können – schließlich würde ein solches Gesetz Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen in hohem Maße berühren. So enthält der Professoren-Entwurf etwa eine Vorschrift, die dem Arbeitgeber erlaubt, Überstunden anzuordnen – andererseits aber schafft er auch für die Beschäftigten vorteilhafte Regeln wie das Verbot, einen Bewerber im Vorstellungsgespräch nach seiner Familienplanung zu fragen. Am Ende fehlte es am politischen Willen – oder am Mut. Krings: „Um langfristig klare und eindeutige Gesetze zu bekommen, müssen wir es auch einmal aushalten können, dass bestimmte Regelungen kurzfristig als ungerecht empfunden werden.“
Dass die Regierung oder eine Fraktion einen ausgeklügelten Entwurf ins Gesetzgebungsverfahren einspeist und dieser anschließend unverändert ins Bundesgesetzblatt gelangt, ist aber ohnehin Utopie. „Ein Regierungsentwurf ist in der Regel stringent“, sagt die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, die heute Justiziarin der SPD-Fraktion ist. „Das ,Strucksche Gesetz‘ hat aber weiterhin seine Gültigkeit.“ Der frühere SPD-Fraktionschef Peter Struck hat einmal den Satz geprägt, nach dem kein Gesetz das Parlament so verlässt, wie es hineingekommen ist.
Dass sich im Laufe eines Gesetzgebungsprozesses immer wieder teils drastische Änderungen ergeben, liegt zunächst einmal daran, dass er ein demokratisches Verfahren ist, an dem zwangsläufig eine Vielzahl von Beteiligten mitwirkt. Zu nennen sind vor allem die vier Verfassungsorgane Regierung, Parlament, Bundesrat und Bundespräsident, doch sind auch Interessengruppen beteiligt, deren Einbeziehung nach dem Gesetz sogar ausdrücklich erwünscht ist; schon im Stadium des Referentenentwurfs werden Gesetze von den Ministerien mit der Bitte um Stellungnahme an Verbände geschickt. Brigitte Zypries berichtet, sie habe sich als Justizministerin einmal erkundigt, wen ihre Mitarbeiter zu einem bestimmten Entwurf angehört hatten: Zu ihrem Erstaunen waren es ganze 150 Verbände. Das sei aber nur konsequent, findet die Sozialdemokratin: „Wenn man Gesetze im Konsens machen will, ist es vernünftig, so zu verfahren.“
Der Einfluss von Interessenvertretern geht manchen Politikern jedoch zu weit. So treibt den SPD-Bundestagsabgeordneten Marco Bülow seit langem der Einfluss der Lobby um. Besonders die „Profitlobby“ – also die Vertreter mächtiger Unternehmen – schaffe es, Gesetze in ihrem Sinne zu beeinflussen, sagt der Dortmunder, der sich mit regelmäßiger Kritik an der politischen Kaste auch in der eigenen Fraktion nicht nur Freunde gemacht hat – zuletzt mit seinem Buch „Wir Abnicker“. „Wer über die größten Ressourcen verfügt, setzt sich durch“, sagt Bülow. So könnten Nichtregierungsorganisationen mit den personell und finanziell gut ausgestatteten Hauptstadtrepräsentanzen von großen Unternehmen kaum mithalten. Aber auch die Abgeordneten hätten angesichts einer solchen Übermacht Probleme, Schritt zu halten. „Wir haben nur ein kleines Budget für Mitarbeiter, so dass die eigentliche wissenschaftliche Arbeit zu kurz kommt.“ Da die Ministerien und Ausschüsse zu einem Großteil eben Interessenvertreter als Experten anhören, müssen die Parlamentarier sich oft auf die Zahlen und Studien verlassen, die diese vorlegen. „Wir sollten den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags ausweiten oder stärker auf Kooperationen mit Hochschulen setzen“, schlägt Bülow vor. „Eigentlich müsste man das Mitarbeiterbudget erhöhen“, sagt er, schränkt aber sogleich ein: „Das wäre momentan wohl wenig populär.“ Doch kann sich ein deutscher Abgeordneter in der Tat im Schnitt auf nur drei Mitarbeiter stützen. Zum Vergleich: Ein amerikanischer Kongressabgeordneter verfügt über ein Team von 14 Personen.
Berthold Welling sieht die Beteiligung der Interessenvertreter im Gegensatz zu Marco Bülow eher als hilfreich an – kein Wunder, er ist selbst einer. Welling ist Leiter der Abteilung Steuern und Finanzpolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Er sagt: „Richtig verstandener Lobbyismus ist immer die fachliche Vorbereitung einer politischen Entscheidung.“ Welling meint, die Auffassung von Verbänden fände mitunter sogar zu wenig Beachtung beim Gesetzgeber. „Wenn der Referentenentwurf zum Kabinettsentwurf wird, werden Stellungnahmen in der Regel nicht berücksichtigt. Eine Änderung des Entwurfs aufgrund einer Stellungnahme würde man im Ministerium als Eingeständnis eines Fehlers betrachten“, meint er. Das Fachliche, die Suche nach zweckmäßigen Lösungen müsste beim Austausch zwischen Politik und Interessenvertretern im Vordergrund stehen, sagt der Lobbyist. Welling – der übrigens einer der 15 Experten ist, die bei der Anhörung im Finanzausschuss die Hotelier-Subvention ablehnten – sieht die Gefahren woanders: nämlich da, wo die Politik sich zu Aktionismus verleiten lasse.
„Florida-Rolf“ lässt grüßen
Nicht selten ist es der Zweck von Gesetzen, zu demonstrieren: „Wir tun was.“ Und dann tritt ein anderer Spieler auf den Plan, mit dem die Politik eine wechselseitige Abhängigkeit verbindet: die Medien. Der Einfluss von Zeitung, Internet und Fernsehen auf die Gesetzgebung ist nicht zu unterschätzen. So änderte die rot-grüne Koalition 2003 die Regeln für den Bezug von Sozialhilfe im Ausland, weil die „Bild“-Zeitung einen gewissen „Florida-Rolf“ entdeckt hatte, der auf Kosten des deutschen Steuerzahlers in dem amerikanischen Sonnenstaat lebte. „Bild“ prangerte den Fall von „Schmarotzertum“ publikumswirksam an. Da die rot-grüne Regierung in eben jener Zeit dazu ansetzte, Auswüchse des Sozialstaats zu beschneiden, war das Timing der Zeitung perfekt. Dass der Staat infolge des verschärften Gesetzes vielen der damals knapp 1000 Sozialhilfeempfängern im Ausland einen Umzug nach Deutschland und später die hierzulande höheren Lebenshaltungskosten zahlen musste – denn kaum einer lebte in Florida, viele aber in Polen –, das bedachten Regierung und Parlamentarier anscheinend nicht. Die Medien machten Druck, die Politiker beugten sich.
„Wenn einer Schlagzeile in der ,Bild‘ schon eine Gesetzesänderung folgt, dann stimmt etwas nicht“, meint Heribert Prantl, Innenpolitikchef der „Süddeutschen Zeitung“. Dann nämlich, so Prantl, betreibe der Gesetzgeber reine „Symbolpolitik“. Doch er fügt hinzu: „Wir Journalisten müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Wir fordern von den Politikern täglich schnelles Handeln und beklagen dann, dass es zu viele Gesetze gibt.“ Die „Hysterisierung der Medien“ habe insbesondere in Fragen der inneren Sicherheit dazu geführt, dass wir es mit einer „ständigen Ausnahmegesetzgebung“ zu tun hätten. „Das Bundesverfassungsgericht kommt mit der Korrektur kaum noch nach“, sagt der regelmäßig mit rechtspolitischen Fragen befasste Journalist.
Hysterisch geht es im politischen Berlin derzeit ohnehin zu, in diesen Tagen, in denen ein Krisenpaket das nächste jagt. Als der Bundestag im Mai über das Euro-Rettungsgesetz diskutierte, da hätte der Beobachter einen Moment lang meinen können, es sei um die Arbeit des Deutschen Bundestags bestens bestellt, lieferten sich Regierung und Opposition im Plenum doch eine engagierte Redeschlacht. Weil aber die Bundesregierung das Euro-Rettungspaket so schnell durch den Bundestag peitschte, dass sich kaum ein Abgeordneter über dessen Folgen klar werden konnte, drehte die Debatte sich auch um die Frage, ob das Parlament bei einem solchen Verfahren überhaupt „noch ein Parlament sei“, wie es der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Wolfgang Wieland bezweifelte.
Und der schwerste Mangel, den ein Gesetz überhaupt haben könnte, wäre in der Tat der: dass es nicht mehr demokratisch ist. Und eine solche Wurst dürfte auf Dauer nicht einmal mehr den Machern selbst schmecken.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Schlechte Gesetze – dank Lobby, Hektik und Symbolpolitik. Das Heft können Sie hier bestellen.