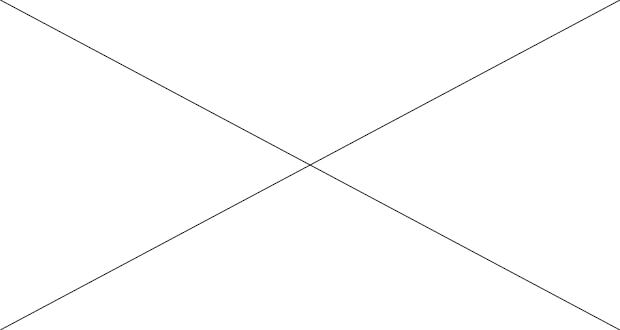Roland Claus hat sich die Szene gut gemerkt. War es auch nur ein Moment, so doch das Gefühl einer Allianz, die sonst undenkbar ist. Er, der Linke, und die CDU-Kanzlerin, verbunden in einträchtiger Erinnerung an alte Tage. Anfang des Jahres, beide lauschen im Publikum einer Ansprache anlässlich des fünften Jubiläums des Normenkontrollrats, ein Anti-Bürokratiegremium der Bundesregierung. Eine trockene Rede, die eingeleitet wird mit einem Verweis auf das Sputnik-Projekt der Sowjets. Und dann das. Claus ruft in den Saal: „Ein guter Anfang“. Und Merkel hinterher, so Claus‘ Erinnerung: „Ja, da verstehen wir was von“. Wir. Angela Merkel übte den Ossi-Schulterschluss und redet über früher. Nur kurz allerdings. „Man merkte sehr schnell, dass sie es lieber nicht gesagt hätte.“
Es ist nicht überliefert, dass Claus und Merkel Freunde sind, es ist sogar unwahrscheinlich. Doch eines wurde Claus an diesem Tag, mal wieder, klar. „Uns Politiker aus dem Osten verbindet eine gemeinsame Geschichte, und das über Fraktionsgrenzen hinweg.“ Selbst Angela Merkel findet so einen Draht zum Linken-Mann – und zu anderen Ost-Abgeordneten, die ihr politisch näher stehen, sowieso.
Ostdeutsche Alltagskultur
Ist das wirklich so? Und wenn ja, was bedeutet es, dass nun auch ein Ostdeutscher Bundespräsident ist? Wandert die Bonner Republik und damit der Abgeordnete klassischer – westlicher – Prägung auf direktem Weg aufs Abstellgleis? Und gibt es das überhaupt, diesen Faktor Ost?
Es lohnt ein Gespräch mit Elmar Brähler. Brähler ist Psychologe und Professor für Medizinische Soziologie an der Universität Leipzig und forscht seit Jahren über „alltagskulturelle Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschen“. Das diffuse Gefühl Claus‘, es gebe einen Kitt zwischen Ost-Parlamentariern, der stärker ist als Parteienbindung, kennt Brähler. „Ich habe schon den Eindruck, dass Abgeordnete aus dem Osten sich den Ostkollegen aus anderen Fraktionen näher fühlen als manchem Parteikollegen“, sagt er.
Gemeinsame Herkunft und eine ähnliche Sozialisation sind dabei laut Brähler nur eine Ursache. Die Abgeordneten aus der Ex-DDR verbinde mehr als die regionale Herkunft, nämlich eine ganz besondere Form der Elitenbildung. „Ostpolitiker, die nach der Wende Erfolg hatten, waren mit großer Wahrscheinlichkeit vorher nicht politisch tätig.“ Es sei kein Zufall, dass unter ostdeutschen Abgeordneten oft Theologen, Ingenieure oder Naturwissenschaftler zu finden seien. „Das waren die einzigen Berufsgruppen, die nach dem Fall der Mauer nicht desavouiert waren.“
Die Physikerin Merkel und der Pfarrer Gauck passen in diese Beschreibung, genauso wie die Theologin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) oder die ehemaligen Minister Wolfgang Tiefensee und Christine Bergmann (beide SPD), ein Elektrotechniker und eine Apothekerin. Auch in den ostdeutschen Ländern muss man bei der Suche nach Berufspolitikern eine Handvoll Ingenieure und eine Theologin beiseite schieben, um schließlich ganz im Norden auf einen klassischen Berufspolitiker zu stoßen: Erwin Sellering, SPD-Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern. Geboren und aufgewachsen im Ruhrpott. Der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) war zwar vor der Wende Mitglied der staatstragenden Blockpartei CDU, aber damit auch eines: Nicht in der SED und damit ohne Option auf eine politische Karriere.
Die zu Vorwendezeiten aufgedrängte Parteiferne konnte sich bei vielen ostdeutschen Politikern bis heute halten, so Brähler. „Das gehörte zum jahrelang eingeübten Selbstverständnis und wurde nicht einfach abgeschüttelt.“ Entsprechend fremdelten viele mit dem Parlamentsbetrieb Bonner Prägung, den starren Parteilinien und Berufspolitikern, die meist schon in der Pubertät begannen, in Organisationen, die mit „Ju“ beginnen, für ihren Aufstieg zu ackern.
Das muss ostdeutschen Politikern nicht schaden, zumindest, wenn es um die Wirkung auf den Wähler geht. Ein Blick auf die Umfragestatistiken bestätigt in schöner Regelmäßigkeit, dass Kanzlerin Merkel weitgehend unbeschadet von CDU-Werten die Beliebtheitsskala der Bundespolitiker anführt – wenn nicht gerade Joachim Gauck in die Liste aufgenommen wird. Die Vermutung liegt nahe, dass hier der pragmatische, oder negativ gewendet: beliebige Regierungsstil Merkels seinen Niederschlag findet. Ein Stil, der sich wenig um Parteiideologien kümmert, schon gar nicht um die der eigenen.
Fluch und Segen zugleich. So sehen das wohl nicht wenige in der CDU-Fraktion des Bundestages, die sich bis zur Unkenntlichkeit dahinpragmatisiert fühlen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Bergner – ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und Ostbeauftragter der Bundesregierung – erlebt es immer wieder in seiner eigenen Fraktion, vor allem, wenn die Chefin vorbeischaut. „Merkels undogmatischer Regierungsstil ist zur Lösung politischer Fragen vorteilhaft und eine große Chance“, sagt Bergner, der einräumt, einst selbst eher aus Zufall bei der CDU gelandet zu sein. Allerdings, so Bergner, liege darin auch eine Gefahr. „Die Konkurrenz von Ideengemeinschaften ist für unser politisches System konstituierend. Je volatiler man da auftritt, desto schwerer wird es.“
Neid, Erfolge und Soli
Soll heißen: Im Bundestag gelten nach wie vor die Regeln des alten Bonner Imperiums. Dass daran die Wahl Joachim Gaucks oder eine Angela Merkel was ändern kann, daran glaubt Bergner genauso wenig wie der SPD-Abgeordnete Carsten Schneider. „Natürlich finde ich diese Ossi-Nummer sympathisch“, sagt der gebürtige Thüringer über Gauck. Aber dass damit ein Bedeutungs- oder gar Machtzuwachs ostdeutscher Abgeordneter einhergehe, das kann sich Schneider nicht vorstellen. „Es ist ein ermutigendes Zeichen, aber mehr auch nicht.“ Schneider verweist darauf, dass in der Bundesregierung neben Merkel kein Ostdeutscher vertreten und auch die Fraktions- und Parteispitzen westdeutsch dominiert seien.
„Es geht um Politik“, sagt Schneider, und meint, dass eine ostdeutsche Kanzlerin und ein ostdeutscher Präsident für das Selbstbewusstsein der Abgeordneten aus den neuen Ländern zwar nicht dass schlechteste seien, sich für den praktischen Politikbetrieb aber wohl nicht viel ändern werde. „Wichtig ist auch in den Fraktionen eine Mehrheit“, und diese ergebe sich meist aus den Landsmannschaften. „Da hat NRW immer mehr als alle Ossis zusammen.“
NRW, ein gutes Stichwort, geht es um die Frage, ob der Gauck-Merkel-Effekt sich am Ende nicht sogar gegen die ostdeutschen Politiker richten könnte. Der SPD-Abgeordnete Wolfgang Tiefensee kann sich das gut vorstellen. Im Schlaf könne man ihn wecken, erzählt er, „und ich nenne ohne Zögern die finanziellen Kennzahlen der Städte Leipzig und Gelsenkirchen“. Das liegt daran, dass Tiefensee in seiner Zeit als Leipziger Oberbürgermeister und sein Gelsenkirchener Amtskollegen Oliver Wittke (CDU) in Diskussionsrunden „sich regelmäßig die Köpfe einschlugen“; es ging dann um den Soli und das Ausbluten des Westens. Eine immer wiederkehrende Debatte, sagt Tiefensee, die besonders gerne aufflamme, wenn der Osten Erfolge feiere, wie zum Beispiel 2003, als Leipzig sich als deutscher Olympiabewerber durchsetzte. Es gelte das Motto: „Denen aus dem Osten schieben wir gerne die Brosamen vom Tisch. Solange sie unter dem Tisch gegessen werden.“
Doch davon kann nun wahrlich nicht mehr die Rede sein, denkt man an die jüngste Personalentscheidung der Kanzlerin, mit der sie erneut eindrucksvoll bewies, dass ihr die Regeln des Bonner Systems und das innere Machtgefüge der CDU herzlich egal sind: Mit der demütigenden Entlassung von Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) brachte sie den mächtigen NRW-Landesverband ihrer Partei gegen sich auf und legte damit vielleicht den Grundstein für einen kalten Krieg zwischen Ost- und West-Christdemokraten. Dass die Entlassung eines Ministers ein legitimes Instrument der parlamentarischen Demokratie ist, mag ein richtiger Hinweis sein. Aber dass die NRW-CDUler darauf von einem ostdeutschen Pfarrer hingewiesen werden, kurz, bevor er die Entlassungsurkunde überreicht – daran müssen sich manche West-Abgeordnete wohl auch erst einmal gewöhnen. Die Frage, ob sie das wollen, muss noch beantwortet werden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Follow me – Das Lobbying der Sozialen Netzwerke. Das Heft können Sie hier bestellen.