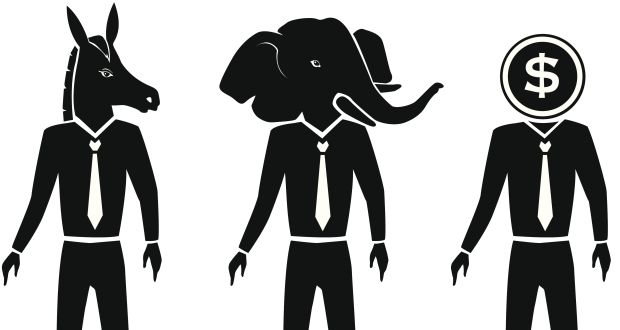Ein paar Tage vor der Präsidentschaftswahl im November 2012 machte mir Barack Obama ein schlechtes Gewissen. Der US-Präsident und Kandidat in Personalunion mailte mir, mehr als vier Millionen Menschen hätten für seine Wiederwahl-Kampagne bereits gespendet, von mir habe er jedoch „null Dollar“ bekommen. Vor diesem Hintergrund schlug Obama mir vor, mit einer Fünf-Dollar-Spende anzufangen. Die Wiederwahl schaffte Obama letztlich auch ohne mein Geld. Eine Milliarde Dollar reichte ihm zum Sieg.
Wer das Rennen im November 2016 machen wird, ist noch völlig offen. Bereits jetzt steht aber fest, dass es am Ende wieder einmal heißen wird: Das war der teuerste Wahlkampf aller Zeiten! Vor gut hundert Jahren begann der US-Präsidentschaftswahlkampf zu einer Geldschlacht zu werden. Die Kandidaten bereisten das immer größer werdende Land, sie schalteten Werbung in Zeitungen, im Radio und Fernsehen und nutzten schließlich das Internet. Woodrow Wilson gab 1916 bereits 2,28 Millionen Dollar für seine Kampagne aus, Kennedy fast zehn Millionen und Nixon bei seiner Wiederwahl mehr als 60 Millionen Dollar. Heute sind die Milliarden die neuen Millionen. 2008 investierten die Präsidentschaftskandidaten zusammen eine Milliarde US-Dollar, 2012 waren es bereits zwei Milliarden.
Geld ist in US-Wahlkämpfen kein Tabu, kein Thema, bei dem Politiker rot werden. Im Gegenteil: Die Kandidaten verschicken keine E-Mail, ohne um eine Spende zu bitten. Oft weisen sie ihre Anhänger sogar darauf hin, wenn der Gegenkandidat finanziell aufholt: „We got some unsettling news last week: Hillary Clinton announced that she had raised $45 million dollars in her first quarter“, schrieb Jeb Bush seinen Anhängern. Deshalb, so der eigentliche Grund der E-Mail, müssten 1.000 Republikaner innerhalb von 24 Stunden je drei Dollar oder mehr spenden, „to show Hillary that she’s in for a real fight“.
Von den kleinen Spenden profitieren allerdings hauptsächlich die Demokraten. Obama schaffte es 2008 durch Millionen von Kleinspende(r)n ins Weiße Haus. Sein Gehilfe: das Internet. Nicht nur die Republikaner hinkten in den vergangenen zwei Wahlkämpfen im Online-Spendensammeln und -Mobilisieren hinterher, auch Hillary Clinton setzte 2008 im Vorwahlkampf noch traditionell auf die Großspender – und verlor. Dieses Mal will sie es besser machen.
Eine ihrer wichtigsten Geldsammlerinnen, die Chefin des Super-PAC (Political Action Comittee) „Ready for Hillary“, Nicole Titus, spricht gerne über ihre Mission, Clinton zur reichsten Kandidatin zu machen. Der Erfolg einer Kampagne im Wahlkampf 2016 hänge von drei Faktoren ab: Geld, Daten und Menschen. Genau in dieser Reihenfolge, fügte Titus kürzlich bei einem Auftritt in Berlin hinzu. Nichts ist mächtiger als das Geld. Der enorme Geldfluss in US-Wahlkämpfen sei zwar nicht gut, führte Titus mit einem nachdenklichen Blick fort, solle aber für etwas Gutes genutzt werden.
Die sogenannten Super-PACs sind Gruppen, die Hunderte Millionen Dollar eintreiben. Sie sind formell getrennt von den offiziellen Kampagnen der Kandidaten oder Parteien, sie dürfen das Geld also nicht an die Kandidaten weitergeben, sondern müssen es selbst oder über andere Verbände investieren. Vor allem werden mit dem Geld TV-Spots finanziert, 2012 für fast 900 Millionen Dollar.
Die neuen Super-PACs stehen symbolisch für das Outsourcen der Wahlkampfspenden – eine Erfindung des Obersten Gerichts aus dem Jahr 2010. Der Supreme Court scheut sich davor, Millionenspenden von Konzernen an Kandidaten direkt zuzulassen, gewährt neuerdings aber das Schlupfloch Super-PAC. Damit wurden die Schleusen geöffnet; das Land und die Wahlkämpfe haben keinen Schutz mehr vor der Spendenflut durch Großspender und Konzerne.
Bedroht die Geldschlacht die Demokratie?
Diese gerichtlich angeordnete Geldschlacht mag auf uns absurd und abstoßend wirken, schließlich kosten die Kanzlerwahlkämpfe hierzulande heute so viel wie ein US-Präsidentschaftswahlkampf vor 50 Jahren. Wir schauen aber von einem (durch-)regulierten Land auf das Land der Freiheit – und damit auch auf das Land der unbegrenzten Wahlkampfspenden. Der Supreme Court interpretiert Artikel 1 der US-Verfassung – die Rede- und Meinungsfreiheit – auch als die Freiheit, im Wahlkampf Kandidaten finanziell zu unterstützen.
Freiheit bedeutet immer auch Risiko. Das Oberste Gericht der USA hat sich dafür entschieden, das Risiko einzugehen, Wahlkämpfe und Wahlen von einzelnen Großspendern steuern zu lassen. Von „Oligarchen“ ist bereits in US-Medien die Rede. Die 42 Milliarden schweren Koch-Brüder aus Kansas haben jetzt freie Hand, ihre marktradikalen Kandidaten zu unterstützen. Die Spezies „gemäßigte Republikaner“ lassen sie so aussterben; Demokraten können nur mithalten, wenn sie einen liberalen Oligarchen finden, der sie unterstützt. Bei den Zwischenwahlen 2014 investierten Charles und David Koch 300 Millionen US-Dollar in republikanische Kongresskandidaten. Die Brüder sind für viele Amerikaner zum Symbol der Einflussnahme geworden. Der führende Demokrat Harry Reid bezeichnet die beiden älteren Herren gar als Bedrohung für die Demokratie.
Von den aktuellen Präsidentschaftskandidaten im Vorwahlkampf kritisiert vor allem der Demokrat und Hillary-Clinton-Herausforderer Bernie Sanders das Oberste Gericht: „Redefreiheit bedeutet nicht, die Freiheit zu besitzen, die amerikanische Regierung zu kaufen.“ Sanders ist mit dieser Kritik authentisch, denn er will keine Unterstützung von Super-PACs, sondern ausschließlich (kleine) Spenden direkt an seine Kampagne.
Der Riss durchs Land geht bei diesem Thema bis an den Supreme Court selbst. In den vergangenen neun Jahren wurden sechs Entscheidungen zur Rechtsprechung von Wahlkampfspenden gefällt – alle (bis auf eine) mit dem knappen Ergebnis von fünf zu vier Stimmen. Die Grenze verläuft zwischen den konservativen und den liberalen Richtern. Der Graben zwischen ihnen ist so tief, dass der liberale Richter Breyer seine abweichende Meinung zum letzten Urteil nicht wie gewöhnlich einfach dem Protokoll übergab, sondern persönlich von der Richterbank aus vortrug. Seine Überzeugung: „Wo zu viel Geld im Spiel ist, wird das Volk nicht mehr gehört.“
Es ist ein ideologischer Streit, der in den siebziger Jahren einen Höhepunkt nahm, als zu Zeiten der Watergate-Affäre Korruption vorgebeugt werden sollte. Die Spenden von US-Bürgern an Kandidaten und Parteien sowie die Spenden von Konzernen wurden begrenzt. Seit 2006 werden diese Regeln nach und nach rückgängig gemacht – seitdem die Konservativen am Obersten Gericht eine feste Mehrheit besitzen. Zuletzt wurde im April 2014 ein weiterer Schritt vollzogen. Auf 88 Seiten begründeten die Richter ihre millionenschwere Entscheidung, wobei für Chief Justice John Roberts der Verweis auf das erste Amendment ausreichte: „There is no right in our democracy more basic than the right to participate in electing our political leaders.“ Der konservative Roberts wurde 2005 von George W. Bush nominiert. Roberts war der jüngste Chief Justice seit mehr als 200 Jahren, er könnte dieses Thema noch über Jahrzehnte am Obersten Gericht mitbestimmen.
Jeder im Land darf nun so vielen Kandidaten Geld spenden, wie er will, allerdings weiterhin jeweils nicht so viel wie er will: Kein Kandidat darf mehr als 2.600 US-Dollar erhalten. Der Supreme Court hat die Kehrtwende also noch nicht vollständig vollzogen. Der jetzige Stand ist weder verfassungsgestützte Freiheit noch sinnvolle Regulierung. Echte Freiheit wäre, transparente, unbegrenzte Spenden direkt an die Kandidaten zuzulassen – echte Regulierung wäre, Spenden von Konzernen grundsätzlich nicht zuzulassen, also die Super-PACs wieder abzuschaffen.
Der exklusivste Klub der Welt
Eine Mehrheit der Amerikaner (bei Demokraten und Republikanern) ist übrigens dafür, Spenden durch große Geldgeber und Lobbyisten zu begrenzen, fand vor wenigen Monaten eine Umfrage der „New York Times“ heraus. Das geht einher mit dem generellen Misstrauen gegenüber Politikern und vor allem dem Kongress. Seit Jahren schenkt nur noch etwa jeder zehnte Amerikaner seinen Volksvertretern in Washington Vertrauen. Der Senat gilt seit jeher als der exklusivste Klub der Welt – 100 mächtige Politiker, die Amerika regieren. Jetzt sind sie – und ihre Kollegen im Repräsentantenhaus – auch zum Klub der Millionäre geworden. Der durchschnittliche Abgeordnete war zuletzt 1.008.767 US-Dollar reich, errechnete das Center for Responsive Politics. Während wir alle vier Jahre mitbekommen, wie teuer der US-Präsidentschaftswahlkampf ist, regieren im Kongress-Dauerwahlkampf insgesamt viel größere Summen das Land: Senator zu werden, kostete 2012 etwa 10,5 Millionen Dollar, einen Sitz im Repräsentantenhaus gab es für 1,7 Millionen. Der Reichtum bei Demokraten und Republikanern im Kongress unterscheidet sich übrigens kaum. Wer denkt, die Republikaner stellten die noch reicheren Millionäre, irrt. In den vergangenen Jahren lagen die Demokraten meist etwas vorn.
Seit der Super-PAC-Erfindung 2010 nimmt die Spirale der immer teurer werdenden Wahlkämpfe weiter an Fahrt auf. Jeb Bush hat ausgerufen, in seinem Wahlkampf solle der Super-PAC „Right to Rise“ erste Anlaufstelle für Spenden sein. Die Spender hören auf Bushs Strategie: Jeb Bushs Kriegskassen sind laut „New York Times“ mit 120 Millionen Dollar gefüllt – davon wurden lediglich elf Millionen an den Kandidaten selbst gespendet. Der Rest – mehr als 108 Millionen Dollar – an ihm nahestehende Super-PACs und Unterstützergruppen. Keiner sammelt bisher so viel Geld wie Bush, er hat inzwischen mehr als alle Kandidaten der Demokraten zusammen.
Weit hinter ihm an zweiter Stelle steht Hillary Clinton mit etwa 68 Millionen US-Dollar, davon allerdings nur ein kleiner Teil von 20 Millionen Dollar über externe Gruppen wie den Super-PAC „Priorities USA“. Das ist aber erst der Anfang. Aus den eigenen Reihen ist zu hören, dass Clinton für ihre Kampagne und über PACs bis zur Wahl bis zu zwei Milliarden US-Dollar sammeln könnte.
Donald Trump hingegen könnte seine komplette Präsidentschaftskampagne aus der eigenen Tasche bezahlen. Laut Forbes ist Trump vier Milliarden US-Dollar schwer, Nummer 133 auf der Liste der reichsten Amerikaner. Trump selbst schätzt sein Vermögen sogar auf neun Milliarden Dollar, verkündete er erst kürzlich bei einer Wahlkampfveranstaltung. Womöglich wäre er letztendlich der transparenteste Kandidat.
Falls das Establishment die Vorwahlen gewinnt, könnte es 2016 zur Wahl zwischen den Dynastien kommen: Bush vs. Clinton. Die Kampagnen von Bill Clinton und George H. W. Bush kosteten 1992 inflationsbereinigt zusammen etwa 305 Millionen Dollar, beide gaben etwa gleich viel aus. 2016 könnten die Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Jeb Bush zusammen mehr als drei Milliarden Dollar kosten – zehnmal so viel.
Werden die beiden Politikveteranen Sieger der Vorwahlkämpfe? Wird einer von ihnen das Weiße Haus erobern? Viel zu früh für eine Vorhersage, die Stand hält. Ich würde jedenfalls noch kein Geld auf Bush oder Clinton verwetten. Nur eins ist sicher: Am 8. November 2016 geht der teuerste Wahlkampf der US-Geschichte zu Ende.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe politik&kommunikation III/2015 Geld. Das Heft können Sie hier bestellen.