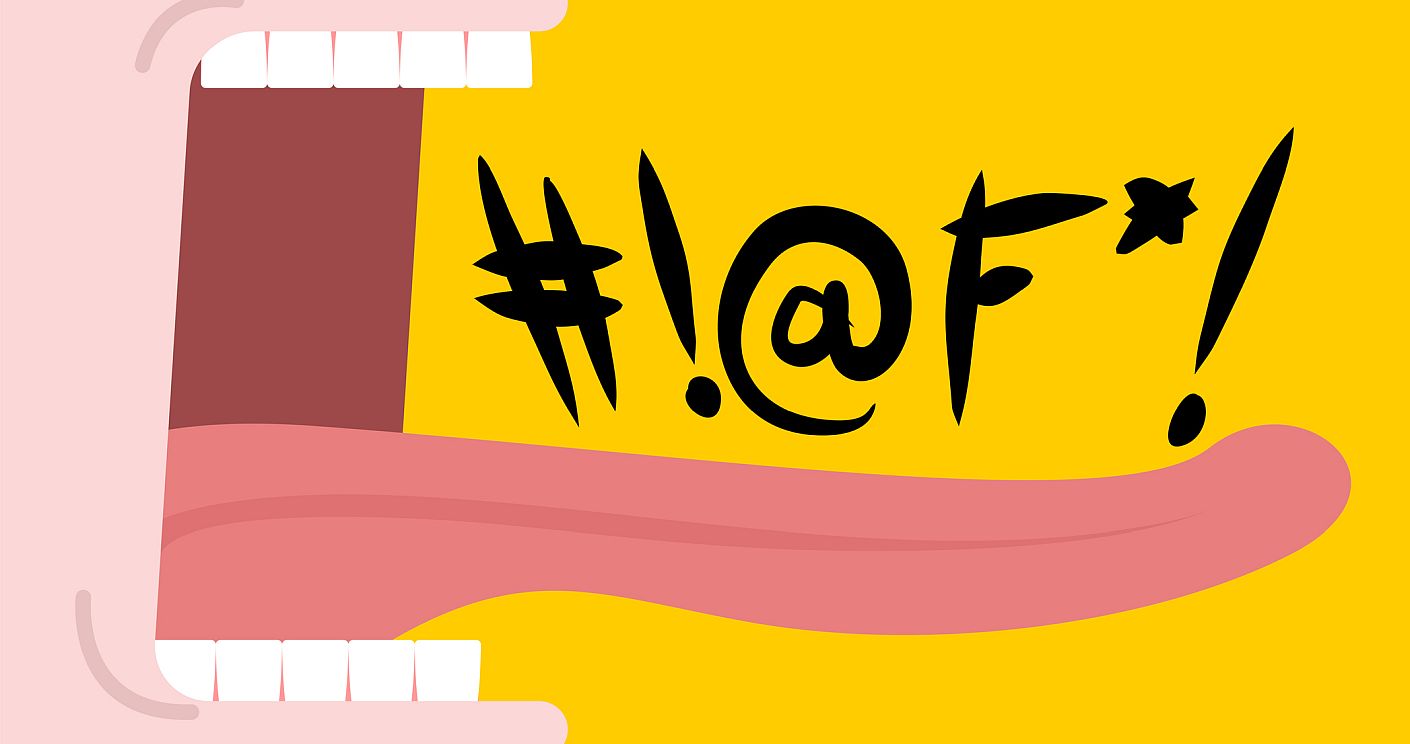Von einem „Stück Rechtsgeschichte im digitalen Zeitalter“, einem „Meilenstein“ und einem Urteil mit „wichtiger Signalwirkung“ war nach dem aufsehenerregenden Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 02. Februar 2022 die Rede (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 19. Dezember 2021 – 1 BvR 1073/20). In der öffentlichen Diskussion im Nachgang der Entscheidung wurde an Superlativen nicht gespart. Aber kann die Entscheidung diesen Erwartungen gerecht werden? Ihre praktische Bedeutung muss sich daran messen lassen, welchen Einfluss sie auf den Alltag von Politikerinnen und Politikern hat. Und natürlich auch, inwieweit sie für Betroffene von Hass und Hetze das Schutzniveau im Netz anhebt.
Denn genau das war das Ziel des langwierigen Verfahrens durch die Instanzen: Gegenüber dem Magazin „Der Spiegel“ äußerte die Beschwerdeführerin Renate Künast (Grüne), sie habe das Verfahren nicht für sich geführt. Stattdessen sei es ihr darum gegangen, eine Botschaft an Gerichte und Staatsanwaltschaft zu senden und so darauf aufmerksam zu machen, dass politisch engagierte Menschen im Netz geschützt werden müssten. Im ZDF sagte sie nach der Entscheidung, es handle sich um „ein Urteil für alle, alle die sich engagieren“.
Schaut man sich die Vorkommnisse der vergangenen Wochen an, hat sich das Klima gegenüber Politikerinnen zuletzt alles andere als entspannt. Nach dem Fackelzug vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) Ende letzten Jahres konnte ein weiterer derartiger Marsch auf das Wohnhaus des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) Mitte Februar nur knapp von der Polizei verhindert werden. Daneben sind die Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer (CDU) schon fast zum Alltag geworden. Es hat sich nicht viel getan, könnte man also meinen. Doch der Schein trügt. Jedenfalls könnte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einer Veränderung der aktuellen Lage führen.
Einmal durch alle Instanzen
Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg. Alles begann mit einem Falschzitat von Künast, das auf Facebook in Umlauf gebracht wurde. Es suggerierte, die Grünen-Politikerin hätte sexualisierte Gewalt mit Kindern verharmlost. Die Folge: Künast war über Wochen hinweg diffamierenden Kommentaren unter dem Post ausgesetzt. Dagegen wehrte sie sich. Zuerst vor dem Landgericht, dann vor dem Kammergericht Berlin. Das Ziel: Die Herausgabe der Klarnamen derjenigen, die die jeweiligen Kommentare gepostet hatten. Denn diese hielt Facebook bis zu diesem Zeitpunkt unter Verschluss.
Die Instanzgerichte stuften aber nicht alle Kommentare als rechtswidrig ein, was jedoch Voraussetzung für den geltend gemachten Auskunftsanspruch nach § 14 III TMG a.F. gegenüber Facebook gewesen wäre. Daher zog Künast mit einer Verfassungsbeschwerde vor das Bundesverfassungsgericht und rügte die Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 I GG iVm. Art. 1 I 1 GG. Mit Erfolg: Das Bundesverfassungsgericht gab ihr Recht, und hält die Urteile für fehlerhaft.
BVerfG-Entscheidung gibt neue Kriterien für Abwägung an die Hand
Nach Auffassung des Ersten Senats beruht der Fehler auf der fehlenden Abwägung der widerstreitenden Grundrechte: Die Gerichte hätten es bei der Beurteilung der Rechtswidrigkeit der Kommentare versäumt, das Grundrecht auf Meinungsfreiheit der Facebook-Nutzerinnen und Nutzer mit dem Persönlichkeitsrecht von Renate Künast abzuwägen. Dies sei aber zwingend erforderlich gewesen. Es liegt daher ein klassischer Fall des Abwägungsausfalls vor, der die Urteile verfassungswidrig werden lässt.
Die Entscheidung betrifft somit nicht die Frage der Strafbarkeit der Facebook-Kommentare selbst, sondern sie stellt vielmehr klar, dass bei der Prüfung der Rechtswidrigkeit von Kommentaren im Netz stets eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter erforderlich ist. Und nicht nur das: Auch neue Kriterien für eine solche Abwägung werden den Instanzgerichten an die Hand gegeben.
Bislang: Im politischen Meinungskampf muss man viel hinnehmen
Klar ist aber schon jetzt: Hinnehmen müssen auch Politikerinnen und Politiker nicht alles. In der Vergangenheit betonte das BVerfG häufiger, dass zwar der Schutz der Meinungsfreiheit gerade auch vor dem Hintergrund sogenannter „Machtkritik“ wichtig sei. So müsse es Bürgerinnen und Bürger möglich sein, Machtausübung angreifen zu können. Dieser Aspekt führte in früheren Entscheidungen häufig dazu, dass der Meinungsfreiheit der Vorrang eingeräumt wurde. Prominentes Beispiel hierfür ist der Beschluss des BVerfG aus dem Jahr 1990 (Beschluss vom 26. Juni 1990, 1 BvR 1165/89): Damals stellte das Gericht klar, dass es Franz Josef Strauß (CSU) hinnehmen müsse, als jemand bezeichnet zu werden, der sich nur unter Zwang oder aus opportunistischen Gründen habe zur Demokratie bekehren lassen. Und auch der Bundesgerichtshof entschied vor fast 40 Jahren ähnlich. So machte er in einem Fall, an dem ebenfalls der damalige bayerische Ministerpräsident beteiligt war, deutlich, dass derjenige, der am „öffentlichen Meinungskampf“ teilnehme, allein deshalb erhebliche Beeinträchtigungen seiner Ehre hinzunehmen habe, dazu würden auch Polemik und Überspitzungen gehören (BGH, Urteil vom 15.11.1983, Az. VI ZR 251/82).
Entscheidendes Kriterium: Persönlichkeitsschutz erhöht Bereitschaft für Engagement
Zwar war auch dies längst noch kein Freibrief für die Zulässigkeit von Beleidigungen und Hass gegenüber Politikern. In dem Künast-Beschluss betont das Gericht nunmehr aber ausdrücklich, dass „der wirksame Schutz der Persönlichkeitsrechte von Amtsträgerinnen und Amtsträgern sowie von Politikerinnen und Politikern über die Bedeutung für die jeweils Betroffenen hinaus im öffentlichen Interesse liegt“. Denn eine Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft könne nur erwartet werden, wenn für diejenigen, die sich engagieren und öffentlich einbringen, ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährleistet sei.
Kommunalpolitik am Scheideweg
Dass das ein wichtiges Zeichen ist, zeigt der Blick auf die Kommunalpolitik: In der nun schon knapp zwei Jahre andauernden Corona-Pandemie hat sich die Lage hier, was Hass und Hetze angeht, mehr und mehr verschärft. Der Ton im Internet – aber auch in der realen Welt – wird rauer und beeinflusst insbesondere Politikerinnen und Politiker in ihrem Handeln. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung aus dem Frühjahr 2021. Danach wurden über die Hälfte der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen. Jüngstes Beispiel ist der Bürgermeister der Gemeinde Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Er sah sich Mitte Februar mit hunderten Demonstrantinnen und Demonstranten in bedrohlicher Kulisse vor seinem privaten Wohnhaus konfrontiert. Der Hass hat sich also schon jetzt seinen Weg aus dem Netz in die Realität gebahnt.
Und das hat Folgen: Um sich und ihr Umfeld zu schützen, gaben in der Umfrage über ein Drittel der Befragten an, aus Angst vor den Folgen die Nutzung sozialer Medien völlig eingestellt zu haben. Zudem fand die Umfrage heraus, dass ein knappes Fünftel der Befragten wegen der Sorge um die eigene und die Sicherheit der Angehörigen schon einmal darüber nachgedacht hat, sich aus der Politik zurückzuziehen. Weitreichende Schritte, die die Betroffenen letztendlich in Betracht ziehen.
Die Sorgen sind aber keineswegs unbegründet. Gerade bei Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die ihre Mandate zum Teil ehrenamtlich ausüben, sind die Mittel, um sich juristisch zur Wehr setzen zu können, noch weniger verfügbar als bei Mandatsträgern auf Bundes- oder Landesebene.
Verbesserter Rechtsschutz durch Karlsruher Urteil
Diese Situation wird auch das Urteil der Karlsruher Richterinnen und Richter nicht ändern können. So viel ist klar. Dennoch bietet es Chancen für einen verbesserten Rechtsschutz. So fügt sich die Entscheidung in einen Prozess ein, der bereits im vergangenen Jahr mit einem Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz der damaligen Bundesregierung begonnen hat. Durch dieses sollen Menschen, die im Netz bedroht und beleidigt werden, effektiver geschützt werden. Auch hier war nach der damaligen Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) die Erkenntnis entscheidend, dass es eine ernste Bedrohung der demokratischen Gesellschaft darstellt, wenn Menschen im Netz mundtot gemacht werden, weil sie sich politisch äußern oder gesellschaftlich engagieren. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurden in dem Paket insbesondere Erweiterungen und Verschärfungen des Strafgesetzbuches beschlossen, die es den Behörden ermöglichen sollen, entschiedener gegen Hetze vorgehen zu können.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist nun ein weiterer Stein in einem Mosaik der vielen notwendigen Maßnahmen, die zusammengenommen dazu beitragen können, die besorgniserregenden Entwicklungen der letzten Jahre einzudämmen. Eine weitere Novellierung des NetzDG beziehungsweise ein Inkrafttreten des Digital Services Act (DSA) können dabei ebenso helfen, wie eine bessere personelle Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden, um der Flut an justiziablen Äußerungen überhaupt nachkommen zu können. Die Entscheidung des BVerfG hat jedenfalls klargemacht: Bei Hass und Hetze im Netz gegen Politikerinnen und Politiker kann nicht pauschal damit argumentiert werden, dass diese Personen derartige Angriffe im öffentlichen Meinungskampf allein aufgrund ihrer Tätigkeit hinnehmen müssten. Vielmehr ist immer eine Abwägung im Einzelfall erforderlich, zu der die Gerichte nun noch einmal ermahnt wurden.
Die praktische Bedeutung der Entscheidung darf also nicht unterschätzt werden. Denn sie setzt gewissermaßen an der niedrigsten Eskalationsstufe an. Getreu dem Grundsatz „Wehret den Anfängen!“ können sich Betroffene sicherer als zuvor sein, dass sie auch bei Anfeindungen im Netz rechtliche Möglichkeiten haben, gegen diese vorzugehen.