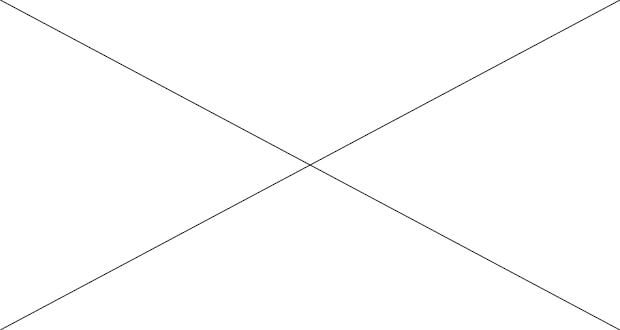Berlin-Mitte, Alte Schönhauser Straße: Wer neue Entwicklungen aufspüren will, der ist hier genau richtig. An diesem Ort begegnen einem aus aller Welt hippe und trendbewusste junge Leute. An der Alten Schönhauser Straße befinden sich auch die Büroräume von Liquid Democracy – eines Vereins, der mit Mode nichts am Hut hat. Liquid Democracy will die Demokratie verändern und verfolgt dabei einen pragmatischen Ansatz: „Die größte Herausforderung besteht für uns in der Frage: Wie kann man das gesellschaftliche Engagement politisch machen?“, erklärt Daniel Reichert, Politikstudent und Vorsitzender des 2009 im Umfeld der Piratenpartei gegründeten Vereins.
Mit dem Konzept der Liquid Democracy – der „fließenden Demokratie“ – soll laut Reichert eine „diskursive Demokratie“ entstehen, in der jeder mit jedem wann und wo er will kommunizieren kann. Woher der Begriff Liquid Democracy eigentlich stammt, ist unklar, vermutlich leitet er sich ab von der Vorstellung einer „Liquid Society“, die der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman im Jahr 2000 in seinem Werk „Liquid Modernity“ beschreibt. In diesem skizziert er das Bild einer modernen Gesellschaft, die sich nicht in starre Konventionen einfügt und traditionellen Lebensweisen skeptisch gegenübersteht.
Liquid Democracy strebt eine Mischform aus repräsentativer und direkter Demokratie an. Die zeitlichen, inhaltlichen und partizipatorischen Begrenzungen der parlamentarischen Demokratie sollen dabei „verflüssigt“ werden: Abstimmungen und Wahlen sollen permanent möglich sein, die politische Repräsentation kein Monopol der Parteien bleiben und die Erarbeitung von Gesetzen nicht den Politikern überlassen werden. Die praktische Umsetzung dieser neuen Form der Demokratie erfolgt durch die digitalen Kommunikationstechniken. Spezielle Softwarelösungen wie die vom Liquid-Democracy-Verein entwickelte Anwendung „Adhocracy“ oder das von der Piratenpartei verwendete „Liquid Feedback“ kommen hier zum Einsatz.
Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“
„Adhocracy“ ist das am meisten verbreitete Liquid-Democracy-Tool. Wie Daniel Reichert betont, wurde bei der Software „sehr großer Wert auf eine einfache Bedienung“ gelegt. Das prominenteste Beispiel der Nutzung einer „Adhocracy-Anwendung“ in der Politik ist bisher die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des Deutschen Bundestags. Diese besteht aus 17 Abgeordneten und 17 Sachverständigen. Über die Plattform „enquetebeteiligung.de“ können seit Februar 2011 Bürger, aber auch Verbände oder NGOs die Arbeit der Kommission als „18. Sachverständiger“ aktiv mitgestalten. Und dies funktioniert denkbar einfach: Jeder, der sich für die Arbeit der Kommission interessiert und eine E-Mail-Adresse besitzt, kann sich ohne Authentifizierung anmelden und mitdiskutieren. Auf enquetebeteiligung.de gibt es – wie bei Adhocracy üblich – sowohl die Möglichkeit, fremde Texte zu kommentieren als auch eigene Vorschläge einzubringen. Stimmt das Gremium ab, so entstehen daraus dann Papiere mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Kommission. Bisher fällt die Beteiligung allerdings bescheiden aus, knapp über 2500 Mitglieder – bei über 80 Millionen Bundesbürgern – zählte die Plattform Ende Februar.
Positives Feedback der Abgeordneten
Dennoch wird die Online-Bürgerbeteiligung von den Abgeordneten fast unisono begrüßt. „Adhocracy ist eine Bereicherung für die Arbeit der Kommission, weil die Diskussion geöffnet und das Verfahren der Entscheidungsfindung transparenter wird“, meint etwa Konstantin von Notz, Abgeordneter der Grünen und Mitglied der Kommission. Seiner Meinung nach darf sich Politik „nicht länger in Hinterzimmern abspielen“. Die Politik müsse offen sein für neue technische Möglichkeiten. Von Notz empfindet die Arbeit der Enquete-Kommission in diesem Punkt daher als „vorbildhaft, denn es gibt nur wenige andere Länder, in denen auf parlamentarischer Ebene Vergleichbares stattfindet.“ Ähnlich sieht das sein Kollege Lars Klingbeil von der SPD – ebenfalls Mitglied der Enquete-Kommission: „Ich halte es für sehr wichtig, dass wir neue Räume für Partizipation schaffen. Dafür sind Liquid-Democracy-Tools gut geeignet.“ Der Netzpolitiker verweist auch auf ein Projekt aus der eigenen Fraktion , den „Zukunftsdialog online“. Der Dialog der SPD-Bundestagsfraktion, an dem sich auch Nicht-Parteimitglieder beteiligen können, wird ebenfalls über die Plattform Adhocracy geführt. Klingbeil ist der Ansicht, dass sich mit den neuen Kommunikationsangeboten der Parteien an die Bürger über kurz oder lang auch die innerparteiliche Demokratie verändern werde. „Für uns als Netzpolitiker ist das erst einmal gut, aber es bedeutet auch einen Spagat zwischen der Fraktionsdisziplin einerseits und der Diskussion mit den Bürgern andererseits.“ Er glaube jedoch daran, dass Liquid Democracy für eine höhere Akzeptanz von politischen Entscheidungen sorgen könne. Voraussetzung: „Es darf keine Partizipationsillusion entstehen. Es muss sich lohnen, bei Liquid-Democracy-Angeboten mitzumachen, da müssen wir als Politiker liefern.“ Nicht nur die SPD setzt auf die digitale Beteiligung der Bürger an parteiinternen Entscheidungsprozessen, auch andere Parteien haben die Zeichen der Zeit erkannt: Die Linke startete vergangenes Jahr eine elektronische Programmdebatte, die FDP ließ vor kurzem ihr neues Grundsatzprogramm online diskutieren, und die Kanzlerin lädt seit Februar auf der Internetseite „Dialog über Deutschland“ zum Zukunftsdialog. Befinden wir uns also bereits im Übergang zur Liquid Democracy?
Konzept im Anfangsstadium
„Liquid Democracy wird sich sicher nicht schnell etablieren – und auch ein flächendeckender Einsatz ist sehr fraglich“, sagt der Politologe Christoph Bieber von der Universität Duisburg-Essen. Die Beratungsfunktion, die Liquid Democracy liefere, sei zwar wichtig, jedoch werde sich das demokratische System nicht von heute auf morgen ändern. Für Bieber ist Liquid Democracy „ein spannendes Projekt an der Grenze zwischen Technologie und Politik“ – allerdings mit noch vielen Fragezeichen: Eines davon betreffe das sogenannte „Delegated Voting“ – ein Kernelement der Liquid Democracy. Dieses sieht vor, dass die eigene Stimme bei einer Abstimmung flexibel an eine andere Person delegiert werden kann. Wie sich Leute verhalten, die viele Stimmen auf sich vereinen; ob es zu einer Hierarchiebildung im Netz kommt – diese Fragen seien völlig offen, so Bieber. Strittig ist auch, ob Klarnamen auf Liquid-Democracy-Plattformen für eine höhere Transparenz sorgen könnten. So forderte etwa Axel E. Fischer (CDU), der Vorsitzende der Enquete-Kommission, ein „Vermummungsverbot im Internet“. Auch radikale Verfechter von Liquid Democracy inerhalb der Piratenpartei fordern, dass Abstimmungen auf Liquid-Democracy-Plattformen öffentlich und transparent sein müssen. Trotz dieser Streitfragen ist Christoph Bieber überzeugt: „Digitale Kommunikation wird in politischen Prozessen immer wichtiger werden – das zeigt nicht nur Liquid Democracy, sondern auch die Nutzung von Wikis oder Etherpads“ (Editoren zur gemeinsamen Bearbeitung von Texten, d. Red.). Interessant an den Liquid-Democracy-Tools sei die Tatsache, dass die Software frei verfügbar ist – eine wichtige demokratische Vorbedingung. Auch Daniel Reichert ist sich sicher: „Liquid Democracy wird stärker werden. Wenn Jugendliche heute lernen, dass sie nicht unbedingt zu Parteien gehen müssen, um 20 Jahre später mitzuentscheiden, dann ist unserer Demokratie bereits viel geholfen.“
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Hier lang – Wege in politische Berufe. Das Heft können Sie hier bestellen.