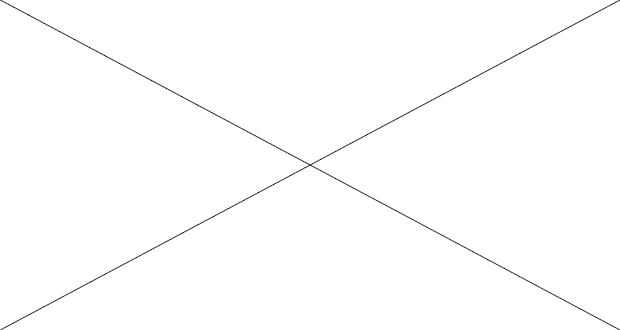Erfolgreiche Kampagnenprofis haben es schon immer gewusst: Der frühere österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky und sein Wahlkampfleiter Anton Benya hatten für die Wähler immer drei Themen parat: „Eines für das Portemonnaie, eines für das Hirn, und eines für das Herz“. Bestätigt werden sie durch die enormen Fortschritte in den Neurowissenschaften in jüngster Zeit, durch die klar geworden ist: An allen menschlichen Entscheidungen ist letztlich auch das „Herz“ beteiligt.
Die moderne Hirnforschung lokalisiert die emotionalen Entscheidungszentren allerdings nicht mehr im Brustkorb, sondern in Hirnarealen mit klingenden Namen wie „Limbisches System“ und „Mandelkern“. Wie wichtig die Gefühlszentren für alle unsere Entscheidungen sind, zeigt sich auf dramatische Weise bei Patienten, bei denen die entsprechenden Hirnareale aufgrund von Krankheit oder Verletzung nicht mehr ihren Dienst tun. Der Neuroforscher Antonio Damasio schildert den Fall eines Patienten, der zwar normale Intelligenzwerte besaß, aber selbst einfache Entscheidungen wie die über den nächsten Termin nicht zu fällen imstande war – das rationale Abwägen zwischen den möglichen Alternativen fand kein Ende, weil nie ein Gefühl sagte: „Das will ich jetzt!“. Es ist nicht vermessen anzunehmen, dass die Entscheidungen für eine Partei oder ein bestimmtes Produkt ohne diese stammesgeschichtlich uralten Hirnareale ebenso wenig zustande kommen können.
Einen ganz anderen Beleg für die Bedeutung von Emotionen für Kampagnenprofis erwähnt Drew Westen in seinem lesenswerten Buch „The Political Brain“: Versuchspersonen in einem Experiment zeigen sich durchaus bereit, ihren Eigennutzen zugunsten des Gemeinwohls zurückzustellen. Wenn jedoch eine kleine monetäre Belohnung zusätzlich in Aussicht gestellt wird, verhalten sich zahlreiche Probanden nicht mehr altruistisch. Die Erklärung dafür liegt im sogenannten Nucleus Accumbens, unserem vor Urzeiten wohl für Tätigkeiten wie Beerensammeln eingerichtetem Belohnungszentrum – heute feuert es beim Glücksspiel oder in freudiger Erwartung neuer E-Mails in unserem Posteingang. Dieses Areal reagiert sehr stark auf finanzielle Anreize, überdeckt aber dann offenbar zur Gänze die Tätigkeit von Hirnarealen, die uns Befriedigung verschaffen, wenn wir etwas für die Gemeinschaft tun. Konsequenz: Wer bei einer Spendenkampagne als zusätzliches „Incentive“ Meilengutschriften für jeden gespendeten Euro verspricht, bringt der guten Sache vermutlich mehr Schaden als Nutzen.
Auch durch zahlreiche andere Experimente – oft mittels bildgebender Verfahren, die die Hirnaktivität plastisch darstellen – ist mittlerweile hinreichend geklärt, dass auf das Verhalten von Zielgruppen abzielende Kommunikation erfolglos bleiben muss, wenn sie nicht unsere emotionalen – und damit of unbewussten – Hirnareale anspricht. Damit hat sich für alle Zeiten die Debatte erübrigt, ob Kampagnen überhaupt Gefühle ansprechen dürfen – beliebt vor allem in Parteien, die sich in der Tradition der Aufklärung sehen, von den Grünen in Europa bis zu den Demokraten in den USA.
Insbesondere George Lakoff („Don’t Think of an Elephant“) hat den US-Demokraten den Spiegel vorgehalten: Sie seien – im Gegensatz zu den Republikanern – nicht in der Lage, an die unbewusst ablaufenden „Skripten“ der Wähler anzudocken. Diese Skripten sind kleine Erzählelemente und Rollenklischees, die in allen von uns – für wie vernünftig wir uns selbst auch halten – die Wahrnehmung der Wirklichkeit strukturieren. Eingebettet sind diese Skripten in größere Sinnzusammenhänge – „Frames“. Wer diese Frames bestimmen kann, gewinnt in der Regel die Debatte.
Obama blieb nach außen hin cool
Lakoff bezeichnet in seinem Bestseller „The Political Mind“, erschienen zu Beginn der Primaries für die US-Präsidentenwahl 2008, prophetischerweise Obama als einen Ausnahme-Demokraten, weil dieser die Kunst beherrscht, aus einem vorgegebenen Frame auszubrechen und durch „Re-Framing“ diejenige Debatte zu führen, bei der er auch gewinnen kann. Obama und seine Berater haben dann auch einen Wahlkampf hingelegt, der in punkto Emotionalität nichts zu wünschen übrig ließ – ein Meilenstein nicht nur für die immer wieder zu „verkopft“ agierenden Demokraten.
Bemerkenswertes Detail am Rande: Obama selbst blieb auch bei seinen mitreißendsten Reden nach außen hin zumeist relativ „cool“ – aber gerade damit wurde er zur idealen Projektionsfläche für die Emotionen seiner Anhänger. Und diese Gefühle evozierte er auf meisterliche Art mit seiner Rhetorik, die letztlich wiederum auf schlichtem Kalkül und viel Training beruhte. Politiker, die Emotionen für ihre Ziele nutzen wollen, müssen also keineswegs selbst emotional wirken.
Auf welche Emotionen kommt es in der politischen Werbung letztlich an? Ted Brader weist in „Campaigning for Hearts and Minds“ nach, dass zwei Gefühlszustände in der Wahlwerbung etwas bewirken können: Enthusiasmus und Furcht. Der mit einem starken Wir-Gefühl und Optimismus verbundene Enthusiasmus ist der ideale Boden für die Wirkung von Positivbotschaften à la „Change we can believe in“. Dagegen bietet der starke Effekt von Furcht wohl eine Erklärung dafür, dass in zahlreichen Wahlkämpfen mehr für Negativ-Werbung ausgegeben wird als für die Eigenwerbung (nicht zuletzt auch von der Obama-Kampagne, zumindest was die Fernsehspots betrifft).
Können wir damit das Ende der Rationalität in der politischen Werbung ausrufen? Selbst Sigmund Freud, der uns die Macht des Unbewussten vor Augen geführt hat, schrieb: „Die Stimme des Intellekts ist leise, aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör geschafft hat.“ Die neueste Kognitionsforschung spricht – ganz im Sinne Freuds – der Vernunft gar nicht ab, eine bedeutende Rolle zu spielen: Unsere emotionalen Zentren arbeiten mit den kognitiven Arealen eng zusammen, und mühsame Denkarbeit kann sich mit der Zeit in effiziente Intuitions-Entscheidungen wandeln. Kreisky hatte deswegen auch immer ein „Hirn-Thema“ mit im Angebot, aber eben stets in Kombination mit einem „Herz-Thema“: Denn darauf zu hoffen, dass „vernünftige Argumente“ die im Endeffekt entscheidenden Gefühlsregionen im Lauf einer Kampagne noch rechtzeitig beeinflussen können, ist eine äußerst riskante Strategie.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Zu Guttenberg – Politiker des Jahres. Das Heft können Sie hier bestellen.