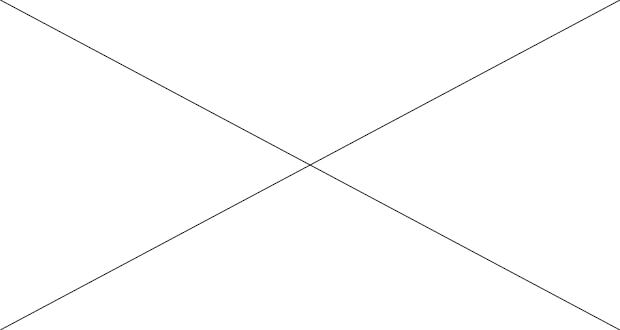Es geht wieder los. In Kneipen und Sälen im ganzen Land trifft sich das Parteivolk zu Wahlkreisversammlungen. Gesucht werden die Kandidaten für den Bundestag. Wer unumstritten ist, wird schnell auf den Schild gehoben. Andere müssen kämpfen – gegen Parteifreunde. Auf die Sieger wartet ein beschwerlicher Wahlkampf, die Verlierer müssen vier Jahre warten, bis sie es erneut versuchen können.
Bereits seit Juni läuft die Kandidatenkür der Parteien, erst im Frühjahr nächsten Jahres wird sie abgeschlossen sein. Wer in den Bundestag will, sollte tunlichst einer Partei angehören: Diese haben es in der Hand, ihre Wunschkandidaten ins Parlament zu bringen. Auch kleine Parteien können Bewerbern durch einen guten Listenplatz den Einzug ins Parlament praktisch garantieren – schon vor der Wahl, fünf Prozent der Stimmen vorausgesetzt. Dass Parteilose eine Chance haben oder Bewerber, die nicht wenigstens einer Partei nahe stehen, darüber sollte sich niemand Illusionen machen: Deutschland ist eine Parteiendemokratie.
Immun gegen Abwahl
„Versuchen Sie es erst gar nicht“, könnte man denn auch die Botschaft der Bundeszentrale für Politische Bildung übersetzen, die auf ihrer Internetseite über das deutsche Wahlsystem aufklärt: In einem Beispielfall dort will eine parteilose 40-jährige Grundschulrektorin in den Bundestag. Sie könne nun 200 Unterschriften sammeln und sich damit beim Landeswahleiter als Bewerberin um ein Direktmandat anmelden. Aber: „Ihre Aussichten, das Direktmandat zu gewinnen, sind gleich Null.“ Gegen die Konkurrenz aus den Parteien könne sie einfach nicht gewinnen – so schonungslos erklärt man dem Bürger, dass an den Parteien kein Weg vorbeiführt.
Diese Dominanz provoziert verstärkt Kritik. Einer der schärfsten Kritiker des deutschen Wahlsystems ist der Rechtsprofessor Hans Herbert von Arnim. Der Bürger hat seiner Meinung nach praktisch keinen Einfluss darauf, welche Personen ins Parlament einziehen. „Der Wähler weiß in der Regel nicht einmal, wen er mit seiner Zweitstimme ins Parlament wählt“, so von Arnim. Denn: „Auf dem Wahlzettel steht nur ein kleiner Teil der Kandidaten. Und wer nimmt schon Einsicht in die Wahllisten?“ Berufspolitiker würden sich gegen die Abwahl durch den Bürger „immunisieren“. Das gelte besonders dann, wenn Direktkandidaten durch Listenplätze abgesichert sind oder in einer Hochburg ihrer Partei kandidieren. So seien 2005 in einem sicheren SPD-Wahlkreis Laurenz Meyer (CDU) und Jörg van Essen (FDP) gegen den Sozialdemokraten Dieter Wiefelspütz unterlegen – und dennoch problemlos über einen sicheren Listenplatz in den Bundestag gekommen. „In solchen Fällen ist der Wahlkampf um das Direktmandat nur noch ein inszeniertes Scheingefecht“, meint von Arnim. Der Jurist schlägt daher eine Änderung des Wahlrechts vor, um die Demokratie zu stärken: „Gerecht wären Vorwahlen oder flexible Listen, bei denen die Wähler ihre Stimme auch den Kandidaten, nicht nur der Partei, geben können. Dann würden tatsächlich sie entscheiden, wer wie weit oben platziert ist.“
„Autistisches Subsystem“
Mehr Demokratie hat sich auch der Verein auf die Fahnen geschrieben, der eben diesen Namen trägt: „Mehr Demokratie“. Paul Tiefenbach, rechtspolitischer Sprecher des Vereins, schließt sich der Kritik an. „Die Platzierung der Kandidaten darf nicht allein Sache der Parteien sein“, sagt Tiefenbach. Er meint wie von Arnim, dass der Bürger Einfluss auf die Reihenfolge auf den Listen erhalten sollte: durch „Kumulieren und Panaschieren“ auch auf Bundesebene. Beim Kumulieren und Panaschieren kann der Wähler seine Stimmen auf mehrere Kandidaten verteilen und einem Kandidaten mehrere Stimmen geben. Dieser Wahlmodus ist in den süddeutschen Ländern und in Hessen bei Kommunalwahlen schon lange üblich, in Bayern auch auf Landesebene; im Februar wurde er erstmals bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg angewendet. Und siehe da: So gelang es in der Hansestadt dem 35-jährigen SPD-Politiker Bülent Ciftlik dank eines engagierten Haustürwahlkampfs nach amerikanischem Vorbild, trotz eines hinteren Listenplatzes an besser platzierten Genossen vorbeizuziehen. Jetzt ist er in der Bürgerschaft. Die Presse feierte Ciftlik als „Barack Obama von Altona“.
Doch müssten ein neues Wahlrecht im Bund gerade die beschließen, deren sichere Listenplätze dadurch in Gefahr geraten. Hat die Reform dann überhaupt eine Chance? Paul Tiefenbach ist zuversichtlich: „Bis zur übernächsten Bundestagswahl kann sich da durchaus etwas tun, denn die Unzufriedenheit mit der Politik ist groß.“ Mit der deutschen politischen Klasse geht auch Karl-Rudolf Korte hart ins Gericht, Professor an der NRW-School-of-Governance der Uni Duisburg-Essen. Die politische Führung des Landes sei „bevölkerungsverdrossen“; sie entwickele sich in Richtung eines „autistischen Subsystems“. Korte will jedoch nicht alles auf die Parteien schieben: „Eine Parteiendemokratie braucht Parteien. Eine andere moderne Form der Willensbildung ist nicht vorstellbar.“ Den Parteien müsse es jedoch gelingen, politische Mitwirkung wieder attraktiver zu machen. Korte: „Wir müssen die Fanmeile für die Parteien erweitern.“
Wolfgang Wieland, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, hält die Kritik an den etablierten Polit-Vereinigungen für „ein wenig wohlfeil“. Schließlich werde auch die Möglichkeit, neue Parteien zu gründen, von den Bürgern angenommen. „Schauen Sie sich an, wer regelmäßig bei der Bundestagswahl antritt“, sagt Wieland: „die Yogischen Flieger, die Familienpartei und die Tierschützer.“ Bei Kommunalwahlen seien zudem Wählerbündnisse außerordentlich erfolgreich. Gegen eine Änderung des Wahlrechts habe er nichts, meint Wieland. Es dürfe aber nicht verkompliziert werden. „Wenn Sie sich die Wahlzettel in Hamburg oder bei der Kommunalwahl in Hessen anschauen, dann ist das des Guten zu viel.“ In Hamburg bekam der Bürger in der Wahlkabine ein Wahlheft mit 30 Seiten zum Ausfüllen, 353 Kandidaten standen zur Wahl und 14 Parteien. Nach der Bürgerschaftswahl wurde die geringe Wahlbeteiligung auch darauf zurückgeführt, dass das Wählen so kompliziert war.
Brisant macht die Frage nach dem Wahlsystem auch die Veränderung der Parteienlandschaft: Seit dem Erstarken der Linken ist die Unsicherheit bei den etablierten Parteien groß; nichts ist mehr, wie es einmal war. Die in der Vergangenheit üblichen Bündnisse tragen nicht mehr. Angesichts dessen brachte auch Altbundespräsident Roman Herzog im März eine Änderung des Wahlrechts ins Gespräch. Das Fünf-Parteien-System verhindere sichere Mehrheiten und befördere schwache Minderheitsregierungen. Ein Bundeskanzler, der einer Minderheitsregierung vorstehe, werde international als „lahme Ente“ angesehen, auf deren Zusagen kein Verlass sei. Herzogs Vorschlag: Man solle über ein Mehrheitswahlrecht wie in Frankreich nachdenken. Dieses lasse den kleinen Parteien Chancen, verhindere aber instabile Mehrheiten.
Roman Herzogs Gedanken zum Wahlrecht wurden als Beitrag in der „Süddeutschen Zeitung“ veröffentlicht. In der „Bild“-Zeitung äußerte sich etwa zeitgleich auch Ernst Benda zu Gunsten eines Mehrheitswahlrechts, der wie Herzog ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist. Kurzfristig loderte die Diskussion um das Wahlrecht auf, stieß auf breite Ablehnung bei den Parteien – und erstarb wieder. Wie sähe das auch aus, wenn die regierenden Volksparteien sich unliebsamer Konkurrenz durch kleine Parteien durch einen Griff ans Wahlrecht entledigen würden. So dürfte man bei SPD und CDU gedacht haben. Die Diskussion ums deutsche Wahlsystem wird denn wohl bis auf weiteres ohne praktische Folgen bleiben – wenn nicht die Ergebnisse der nächsten Bundestagswahl zum Handeln zwingen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Rutschgefahr – bitte bleiben sie politisch korrekt. Das Heft können Sie hier bestellen.