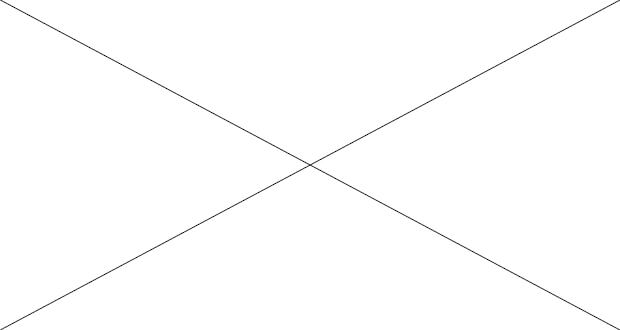p&k: Herr Bernschneider, als Sie 1986 geboren wurden, war Herr Klose seit drei Jahren im Bundestag und hatte vorher schon eine politische Karriere gemacht, unter anderem als Erster Bürgermeister von Hamburg. War Herr Klose Ihnen vor diesem Treffen ein Begriff?
Florian Bernschneider: Ja, natürlich. Er hat ein ähnliches Schicksal geteilt wie ich. Ich glaube, er war damals der jüngste Chef einer Landesregierung. Ich bin der jüngste Bundestagsabgeordnete.
Hans-Ulrich Klose: Genau. Ich war der jüngste, den es je in Hamburg gab.
Der jüngste überhaupt in einem deutschen Bundesland.
Klose: Das kann sein. Ich war gerade 37.
Herr Klose, wenn Sie so einen jungen Kollegen treffen, der offenkundig für die Politik brennt – erkennen Sie sich darin ein bisschen wieder?
Klose: Nur in Grenzen, denn ich war ja immerhin schon 27 Jahre alt, als ich 1964 in die SPD eintrat. Ich hatte lange gezögert und war mir auch nicht sicher, ob ich mehr zur FDP neige oder zur SPD. Richtig aktiv geworden bin ich sogar erst ab etwa 1966, das hing mit der Studentenrevolte zusammen.
Die Studentenrevolte hat Sie zur Politik gebracht?
Klose: Ich hatte am Anfang überhaupt nicht geplant, Politiker zu werden. Ich war damals Jugendstaatsanwalt in Hamburg und habe mich irgendwann für die SPD entschieden, weil ich glaubte, man müsse mehr tun, als nur eine Meinung haben. Ein Satz des französischen Schriftstellers Anatole France schubste mich in Richtung SPD. France sagte: „Die Majestät des Gesetzes verbietet sowohl Reichen wie Armen, unter den Brücken zu schlafen und Brot zu stehlen.“ Für ihn war klar, dass Gesetze und die Verfassung alleine nicht ausreichen, um Freiheitsrechte wahrzunehmen. Mit den Zielen der SPD stimmte ich etwa 70 Prozent überein – was völlig ausreichend ist. Eine Partei, die man 100 Prozent unterstützen könnte, kenne ich nicht. Später kam dann die Studentenrevolte, und ich war in der SPD plötzlich einer von den Jungen‚ einer, „der doch mit denen mal reden“ kann. Im Dialog mit den Studenten habe ich dann ein neues Universitätsgesetz formuliert.
Herr Bernschneider, was hat Sie zur Politik gebracht?
Bernschneider: Ich war Schulsprecher und deswegen zwangsläufig immer wieder in politische Debatten verwickelt. Irgendwann habe ich dann einmal einen kleinen Schubs von einem Politiklehrer bekommen. Wir haben im Politikunterricht diskutiert, und der Lehrer sagte zu mir: „Florian, Du argumentierst wie jemand von der FDP.“ Dann habe ich noch etwa ein halbes Jahr gewartet, bis ich tatsächlich in die Partei eingetreten bin. In der Zwischenzeit habe ich recherchiert, was die FDP genau macht, und habe das dann immer wieder mit meinen Positionen verglichen. Irgendwann habe ich mich überwunden und bin zu den Jungen Liberalen gegangen. Dort musste ich feststellen, dass mein Lehrer Recht hatte: Es gab tatsächlich eine relativ große Schnittmenge. Aber ich teile die Meinung von Herrn Klose: Man wird wohl mit keiner Partei eine völlige Übereinstimmung finden.
Wie viel Prozent Zustimmung waren es bei Ihnen?
Bernschneider: Bei den Jungen Liberalen sind es schon 85 Prozent gewesen. Deswegen war ich da ganz gut aufgehoben.
Herr Klose, wenn Sie Ihrem Kollegen einen Tipp geben müssten: Was ist das Wichtigste, worauf man als Politiker achten muss?
Klose: Da zögere ich etwas. Ich muss nämlich an den Spruch von Johannes Rau denken, nach dem „auch Ratschläge Schläge sein können“. Ich hatte das Glück, dass mein Vater, der Lehrer war, mir nicht allzu viele Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat, dazu war er zu klug. Einen Tipp hat er mir aber doch gegeben: „Wenn Du nicht willst, dass rote oder braune Banausen es machen – dann mach es selbst.“ Das war ein guter Ratschlag. Ansonsten muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ich sage im Nachhinein immer, aber nur für mich, nicht für Herrn Bernschneider: Eigentlich war ich für das Amt des Bürgermeisters zu jung. Denn die größte Verführung, die es in der Politik gibt, ist ja nicht Geld oder materielle Vorteile, sondern das Prestige, jemand zu sein, der etwas zu sagen hat. Und das war mein Fehler: Ich glaubte, es gäbe nichts Wichtigeres als Politik, und außerdem hielt ich mich für ungefähr so bedeutend wie das Amt, das ich innehatte. Beides war falsch.
Und wie schützt man sich vor solchen Fehleinschätzungen?
Klose: Mein Schutz war die Erfahrung, eben noch Erster Bürgermeister gewesen zu sein, plötzlich aber kein Amt mehr zu haben und wieder ein ganz normaler Bürger zu sein. Ich nenne das immer meinen dritten Bildungsweg. Das hat mir sehr geholfen.
Herr Bernschneider, wie lange planen Sie denn, in der Politik zu bleiben?
Bernschneider: Ach, ich bin ja gerade drei Wochen dabei. Wenn ich jetzt schon planen würde, wann ich wieder aussteige, dann würde ich wohl etwas falsch machen. Politik sollte in jedem Fall nicht mein einziger Lebensinhalt sein. Ich studiere ja noch, und mir ist wichtig, das Studium zu Ende zu führen, damit ich die Möglichkeit habe, auch etwas anderes im Leben zu machen. Und ich möchte noch etwas anderes im Leben machen.
Befürchten Sie nicht, dass die Politik Sie eines Tages so ganz und gar in Anspruch nimmt, dass Sie am Ende gar nicht mehr herauskommen?
Bernschneider: Das wurde ich schon öfter gefragt. Natürlich macht man sich darüber Gedanken, und mir ist bewusst, dass man nur auf eine bestimmte Zeit gewählt ist. Darauf muss man sich vorbereiten. Jetzt bin ich aber erst einmal froh, vier Jahre im Bundestag arbeiten zu dürfen. Ich bin nicht in die FDP eingetreten, weil ich unbedingt Berufspolitiker werden wollte. Die Inhalte und das Miteinander haben mich überzeugt.
Wie wollen Sie trotz Bundestagsmandats am Boden bleiben?
Bernschneider: Ich glaube, ganz wichtig sind Freunde und Familie. Ich habe den großen Vorteil, dass mein Wahlkreis in Braunschweig ist. Das ist von Berlin aus eine Fahrt von einer Stunde und zwanzig Minuten mit dem ICE. Meine Freunde und meine Familie haben mir schon am Wahlabend den Ratschlag gegeben, bodenständig zu bleiben. Ich glaube, sie werden mir auch rechtzeitig Bescheid geben, wenn sie sehen, dass ich mich verändere oder dabei bin, abzuheben.
Herr Klose, widerlegt Herr Bernschneider das Vorurteil, dass sich junge Menschen gar nicht mehr für Politik interessieren?
Klose: Ich glaube, dass junge Menschen sich in jedem Fall interessieren. Sie sind nur nicht von den Formen der politischen Mitwirkung begeistert. Ohne irgendjemandem nahetreten zu wollen, vor allem nicht meiner eigenen Partei: Das Mitwirken der Parteien bei der Willensbildung des Volkes ist verbesserungsfähig.
Herr Bernschneider, sind junge Leute wirklich an Politik interessiert?
Bernschneider: Die Jungen Liberalen stehen vor einem historischen Hoch von annähernd 11.000 Mitgliedern. Daher kann ich nicht sagen, dass es wenig politisch interessierte Jugendliche gibt. Es kommt immer darauf an, wie man das aufbereitet. Die neuen Medien sind sicherlich ein guter Zugang. So hat Guido Westerwelle mit seinem Profil bei StudiVZ nach Angela Merkel die meisten Unterstützer. So einen direkten Kontakt zwischen Spitzenpolitikern und ganz normalen jungen Menschen, die eine Ausbildung machen oder studieren, den hat es vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Gerade dieser Wahlkampf hat gezeigt, wie viele junge Menschen eigentlich an Politik interessiert sind.
Hat man Sie im Wahlkampf jemals gefragt: Was wollen Sie junger Mensch eigentlich in der Politik?
Bernschneider: Das gehört zwangsläufig dazu. Allerdings gibt es auch ältere Menschen, die mir gesagt haben, dass sie sich freuen, dass auch mal ein junger Mensch in die Politik geht. Eine ältere Dame hat zu mir gesagt: „Lassen sie sich nicht verunsichern, wenn die Leute immer so viel über Lebenserfahrung reden. Ich bin 1930 geboren. Die Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe, kann ich heute gar nicht mehr anwenden. Die Zeiten haben sich doch völlig geändert.“
Herr Klose, als jüngster Abgeordneter führt Herr Bernschneider nun täglich Interviews. Muss er eigentlich aufpassen, dass er in dieser Hinsicht nicht zu viel macht?
Klose: Je älter ich geworden bin, umso zurückhaltender wurde ich. Was die neuen Medien betrifft, Facebook, Twitter und so weiter, habe ich mich vor dem Wahlkampf intensiv mit meinen Mitarbeitern beraten. Ich habe entschieden, es nicht mitzumachen, denn ich habe soviel an Quatsch in diesen Medien gelesen. Unsere Analyse war: Wenn man es vernünftig machen wollte, dann müsste ich drei Stunden am Tag vor dem Computer sitzen. Die Zeit habe ich nicht, die verbringe ich lieber im richtigen Leben. Auch deswegen bin ich direkt gewählt worden.
Bernschneider: Ich glaube, dass das jeder für sich entscheiden muss. Twittern ist für mich eine Sache von zwei Minuten. Ich hole das iPhone raus, schreibe eine Nachricht und schicke sie ab. Wenn man ein Interview gibt, kann es passieren, dass man am nächsten Tag in der Zeitung Sachen liest, die man gar nicht so gesagt hat. Mit Twitter kann ich meine Meinung klar mitteilen. Und ich bekomme mit, dass immer mehr Menschen darauf reagieren.
Würden auch Sie zwischen dem virtuellen und dem richtigen Leben unterscheiden wie Herr Klose?
Bernschneider: Nein. Das greift ja alles nahtlos ineinander. Dann müsste man auch den traditionellen Briefverkehr vom normalen Leben trennen.
Klose: Da haben Sie wahrscheinlich Recht. Meine Kinder und Enkelkinder sehen das genauso.
Kann man als Politiker seine Medienpräsenz auch sparsam dosieren?
Klose: Ich glaube, dass das gar nicht geht, denn Politiker wie Medien haben ein gegenseitiges Interesse aneinander. Ich kann mir das erlauben, zu sagen: „Ich mache das Interview nicht.“ Herrn Bernschneider würde ich das noch nicht raten.
Herr Bernschneider, dem Deutschlandfunk haben Sie gesagt: Im Reichstag habe ich mich auf dem Weg zum Klo verlaufen. Kennen Sie sich mittlerweile schon ein bisschen besser aus?
Bernschneider: Ja, etwas besser. Durch den großen Interview-Trubel in den ersten zwei Wochen hatte ich kaum Zeit, mich in aller Ruhe zu orientieren und zu schauen, wo welche Büros liegen, wie die Strukturen sind. Ich musste sogar von der Pressestelle betreut werden, weil so viele Anfragen kamen, die ich allein nicht bewältigen konnte. Das war dann so, als ob ich von einem Navigationssystem gesteuert würde. Die ganze Zeit hatte ich jemanden, der mich begleitet, durch den Bundestag führt und die Wegrichtung angibt. Die Wege habe ich mir dabei gar nicht eingeprägt. Irgendwann habe ich dann aber gesagt, dass ich mir jetzt die Zeit nehmen und auch mal ganz alleine durch die Parlamentsgebäude gehen muss.
Klose: Richtig kompliziert wird es, wenn man sein Büro im Jakob-Kaiser-Haus hat. Wo sitzen Sie denn?
Bernschneider: Im Jakob-Kaiser-Haus. Mir haben schon ältere Abgeordnete gesagt: „Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wie die Raumnummerierung hier funktioniert.“
Herr Klose, gibt es Orte, die Ihr Kollege sich auf jeden Fall einmal anschauen sollte?
Klose: Es gibt dieses wunderbare Eckzimmer, ganz oben im Jakob-Kaiser-Haus, von dem man auf den Reichstag gucken kann. Da muss er mal hingehen. In der Hauptstadt an sich gibt es natürlich Dutzende von interessanten Orten. Es ist völlig ausgeschlossen, sich in Berlin zu langweilen. Das geht gar nicht. Auch die Umgebung ist unglaublich schön. Sie können Fontane nehmen, die „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, drei Viertel davon stimmen immer noch.
Herr Klose, mussten Sie lange darüber nachdenken, ob Sie noch einmal für den Bundestag kandidieren?
Klose: Das war gar nicht meine Planung. Eigentlich hatte ich vor aufzuhören. Aber da es der SPD bekanntlich nicht gut geht, und ich der Einzige war, der beim letzten Mal noch über 50 Prozent der Stimmen erhielt, habe ich mich überreden lassen. Ich habe zuerst ein Weilchen überlegt und dann gesagt: „Gut, ich will in Frieden mit meiner Partei aufhören, also mache ich es.“ Und Frieden bedeutet: Entweder ich gebe mir Mühe und gewinne, und dann ist es gut – oder ich gebe mir Mühe und verliere, und dann ist es auch gut. Dann kann ich wenigstens mit dem Gefühl ausscheiden, dass ich es versucht habe. Ich bin dann nicht so wie Wolfgang Clement und diese Leute, die die Partei im Zorn verlassen. Das will ich nicht.
Wenn es darum geht, sein eigenes Abgeordnetenbüro aufzubauen und Mitarbeiter einzustellen, welche Tipps würden Sie Herrn Bernschneider an die Hand geben?
Klose: Personal einzustellen, ist das Schwierigste, das es überhaupt gibt, denn es ist eine sehr persönliche Arbeitsbeziehung. Der Mitarbeiter ist völlig abhängig vom Abgeordneten, umgekehrt muss sich der Abgeordnete völlig auf seinen Mitarbeiter verlassen können. Da muss es ein hohes Maß an Vertrauen geben. Mit einer meiner Mitarbeiterinnen arbeite ich seit über 20 Jahren zusammen, da habe ich sehr viel Glück gehabt. Man muss das Personal ganz sorgfältig aussuchen. Das ist besser, als ständig seine Leute auszutauschen.
Herr Bernschneider, haben Sie schon Mitarbeiter gefunden?
Bernschneider: Ich bin gerade auf der Suche. Mir fällt es auch schwer und ich will mir damit etwas Zeit lassen.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Politiker – wie sie leben und arbeiten. Das Heft können Sie hier bestellen.