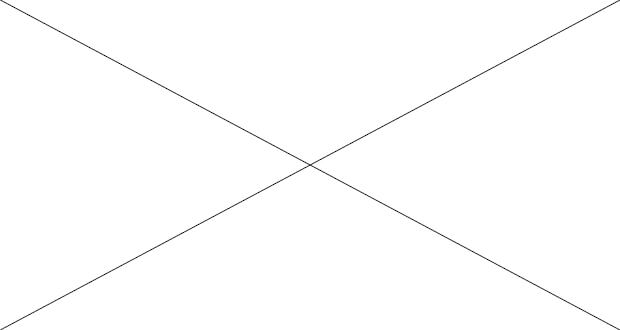Registrierungsbögen und Wahlgesetze statt Latte Macchiato: Es muss wohl schon um die ganz wichtigen Dinge gehen, wenn ein paar amerikanische Studenten den vielleicht letzten sonnigen Spätsommertag lieber hinter einem Informationsstand verbringen als im schicken Café nebenan. Vor einer Buchhandlung im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg wollen sie ihr Land verändern. Sie wünschen sich Barack Obama ins Weiße Haus und betreiben dazu Wahlkampf: Tausende von Kilometern fern ihrer Heimat helfen sie Landsleuten, sich für die Briefwahl zu registrieren.
„Es ist noch nicht zu spät für Massachusetts“, beruhigt Emily Sanford den an den improvisierten Registrierungstisch gekommenen Mann. Er ist Mitte 50, braungebrannt, in auffällig gelbem T-Shirt. Der US-Amerikaner mit südamerikanischen Wurzeln fürchtete, er könne sich nicht mehr zur Briefwahl in seinem heimatlichen Wahlkreis anmelden. Auf Emilys Knien liegt ein dickes Buch. Es ist der „Voting Assistant Guide 2008-09“ und das wichtigste Werkzeug für die 26-jährige Studentin aus dem Bundesstaat New York. Das amerikanische Wahlrecht sieht komplizierte Regeln und unterschiedliche Fristen für die Registrierung zur Briefwahl vor.
Helfer sollen neutral sein
Engagiert beantwortet Emily alle Fragen des Exil-Amerikaners mit einem einnehmenden Lächeln und streicht sich dabei durch ihr lockiges rotes Haar. Einer der letzten Punkte auf dem Registrierungsbogen ist die freiwillige Angabe der Parteienpräferenz. In großen Lettern trägt der Mann „Democrats“ ein. Jetzt lässt Emily ihre Neutralität fallen und lädt den Mann zu den monatlichen Treffen der Berliner Democrats Abroad ein, einer Vereinigung von Exil-Amerikanern, die Anhänger der Demokratischen Partei sind. Damit bewegt sie sich in einer rechtlichen Grauzone: Denn bei der Registrierung von Briefwählern darf eigentlich kein Wahlkampf betrieben werden, weil die Registrierung nicht im Namen der Demokraten oder Republikaner geschieht. Gibt der Wähler sich aber offen als Anhänger einer Partei zu erkennen, wird nachlässig über diese Regel hinweg geschaut. Der Mann scheint froh über den Kontakt zu Gleichgesinnten: „Wenn McCain gewinnt, gehe ich nicht mehr zurück in die Staaten“, sagt er und verabschiedet sich mit seinem Registrierungsbogen in der Hand in Richtung des gegenüberliegenden Postamts. Damit keine Wahlfälschung betrieben werden kann, muss jeder zukünftige Briefwähler den Anmeldebogen selbst in seinen County, sozusagen seinen Bezirk, schicken.
Emily ist nicht allein. Sie ist Mitglied der Young Democrats. Der Young Dems, wie sie sich selbst nennen, einer Jugendgruppe innerhalb der weltweit aktiven Democrats Abroad. Diese kann man sich als ausländischen Landesverband der Demokratischen Partei vorstellen. „Wir sind zwar nicht viele, aber ich verstehe die Young Dems als Motor innerhalb der Democrats Abroad. Wir sind jünger und vielleicht ein bisschen schneller“, sagt Alex Zimmerman, 26 Jahre wie Emily. Mit frischen Bagels und Kaffee für seine Helfer kommt er an den Stand. Er ist zwar der Vorsitzende der Young Dems in Berlin, doch die eigentliche Arbeit machen die Leute am Stand, gibt er zu.
Aber Zimmerman hält den Laden zusammen. Er ist hauptverantwortlich dafür, dass es die Young Dems überhaupt wieder gibt. Der 26-jährige Student des Wirtschaftsingenieurwesens gründete sie im vergangenen März wieder neu. Wie viele der von Studenten initiierten Projekte ist es irgendwann einfach eingeschlafen. Natürlich hat niemand der etwa 30 losen Mitglieder persönlichen Kontakt zu Obama. Doch der Hype um den charismatischen Spitzenkandidaten der Demokraten entfachte bei vielen die Lust, sich politisch zu betätigen. Sogar Deutsche wollten Mitglieder der Democrats Abroad werde. Doch das lässt das amerikanische Parteienrecht nicht zu.
„Jeder fragt sich, was sich ändert, wenn Obama wirklich gewinnt. Ich glaube fest daran, dass es außenpolitisch einfacher wird. Die USA hat durch die Bush-Regierung viel an Ansehen in der Welt verloren. Mit Obama wird das besser“, sagt Alex Zimmerman fast schon staatsmännisch mit leichtem Berliner Dialekt. Er ist das Kind einer deutschen Mutter und eines amerikanischen GI.
Über die wichtigste Bedeutung einer möglichen Wahl Obamas werden sich die jungen Demokraten am Stand aber schnell einig: Sie wäre ein Symbol, das Amerika verändern würde. Ein Afro-amerikaner hätte es ins höchste Amt der USA geschafft. Dann wäre alles möglich. Der amerikanische Traum würde ein bisschen mehr Realität werden.
Vom republikanischen Gegenkandidaten hält Zimmerman nicht viel: „John McCain ist ein Antipol in sich.“ Er hält für opportunistisch. Auch zu seinem Kandidaten geht er in manchen Fragen auf kritische Distanz. Dass ein Staat seine eigenen Bürger tötet, lehnt Zimmerman ab. So fordert er – wie die meisten Auslandsdemokraten – die Aufhebung der Todesstrafe, während beide Kandidaten sie weiter gutheißen. Zimmerman vermutet dahinter jedoch weniger Obamas Überzeugungen als vielmehr ein wahltaktisches Manöver des Kandidaten, um auch konservative Wähler für sich zu gewinnen.
Es wird unruhig am Informationsstand. Eine blonde Frau möchte sich für die Briefwahl registrieren. Ihr Englisch ist von einem starken deutschen Akzent durchsetzt. Sie hat einen deutschen Mann geheiratet und lebt seit über 15 Jahren in Deutschland. „Ich weiß gar nicht mehr, wo ich zuletzt gemeldet war. Darf ich die Adresse meiner Eltern angeben? Die leben in Florida.“ Sie darf. Die angegebene US-Adresse entscheidet, wo die Stimme gewertet wird. Der Bundesstaat im äußersten Südosten der USA gilt als umkämpfter Swing-State. Stimmen dort können die Wahl entscheiden, so wie bei der ersten Wahl von George W. Bush. Florida! In dem Gefühl, den Ausgang der Wahl mitbestimmen zu können, widmen sich die jungen Demokraten der Wählerin mit noch größerer Aufmerksamkeit: Sie hat sich im Gespräch als Demokratin zu erkennen gegeben. Doch die Frau ist unsicher, in welchem County die Eltern wohnen und muss deshalb den Briefwahlbogen mit nach Hause nehmen. Alex und seine Helfer hoffen darauf, dass sie ihn wirklich ausfüllen wird.
Wählerregistrierungen sind nicht die einzigen Aktionen der Young Dems. Sie veranstalten Diskussionsrunden, halten den Kontakt zu den anderen Obama-Unterstützern oder arbeiten mit den Jusos in Fragen des deutsch-amerikanischen Verhältnisses zusammen. Bis zur Wahl am 4. November hat allerdings der Kampf um die Stimmen absolute Priorität. Im Foyer eines Kinos registriert auch die Organisation American Voices Abroad für die Briefwahl. Im Saal läuft „Uncounted“, ein Dokumentarfilm über nicht gezählte Stimmen bei den letzten Wahlen. Emily ist auch da. Sie geht mit einem mulmigen Gefühl in den Saal: Heute hat sie ein Dutzend Menschen registriert und hofft, dass deren Stimmen zählen werden.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe 27 – Sonntag. Das Heft können Sie hier bestellen.