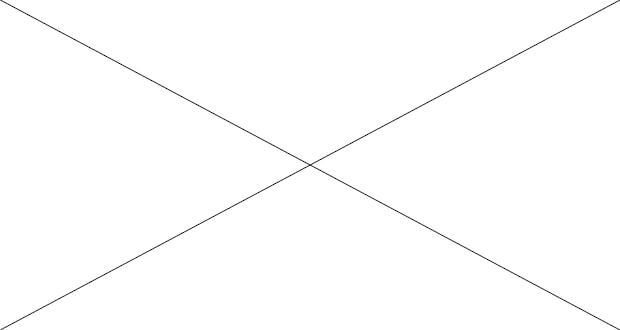Es waren nebulöse Andeutungen, die Jaroslaw Kaczynski in seinem Buch machte. Ohne allzu konkret zu werden, schrieb er, Bundeskanzlerin Angela Merkel sei mit Hilfe der Stasi in ihr Amt gelangt und betreibe eine Politik der „weichen Unterdrückung“ Polens. Kaczynskis Absicht war klar: Mit dem Werk „Das Polen meiner Träume“ wollte er vor der Wahl Anfang Oktober noch einmal kräftig Ressentiments schüren, und er zeigte keine Scheu, dies auch in Interviews zu tun. Kaczynski war überzeugt von diesem Kurs, und noch wenige Tage vor der Wahl zeigte er sich auf einer Parteiveranstaltung noch siegesgewiss: Zu den Tönen des Queen-Krachers „We will Rock You“ badete er im rhythmischen Beifall seiner Anhänger.
Doch die Rechnung ging nicht auf: Noch vor der Wahl zeigte sich, dass der Spitzenkandidat der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) sich mit seinen Verschwörungstheorien ins Knie geschossen hatte. Seine Deutschfeindlichkeit stieß bei den Polen nicht auf Zustimmung, bei vielen löste sie sogar Empörung aus. So schrieben fünf ehemalige polnische Außenminister des Landes, darunter Wladyslaw Bartoczewski, Auschwitz-Überlebender und Berater von Ministerpräsident Donald Tusk, einen offenen Brief gegen Kaczynskis Angriffe auf Merkel. Darin beklagten die früheren Minister, dass dessen Anspielungen „schädlich für Polen“ seien. Sie fühlten sich in der „moralischen Verpflichtung, Frau Bundeskanzlerin Merkel zu sagen: Wir erklären uns mit Ihnen solidarisch. Die Polen und die Deutschen haben noch viel gemeinsam zu tun. Nicht nur in unseren bilateralen Beziehungen, sondern für das Wohl eines geeinten Europa.“
Die Wähler straften die PiS bei der Wahl ab: Vor Kaczynskis Merkel-Äußerungen lag die nationalkonservative Partei Kaczynskis mit der regierenden Partei von Präsident Donald Tusk Kopf an Kopf, bei der Wahl betrug der Abstand dann zehn Prozentpunkte (39 gegenüber 29 Prozent). Die Ressentiments scheinen als Mittel des polnischen Wahlkampfs nicht mehr zu funktionieren. Für den wiedergewählten Ministerpräsidenten Donald Tusk kann sich das Ergebnis sehen lassen. Er erkannte die Zeichen der Zeit, baute während seiner ersten Amtszeit eine starke Partnerschaft zu Deutschland auf, und wurde mit einem historischen Wahlsieg belohnt – seit der Unabhängigkeit des Landes wurde noch kein Präsident wiedergewählt. Und vieles hatte mit seinem Mut zu tun, sich nicht auf die Deutschlandkritik einzulassen.
Und damit liegt er im Trend: Eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach macht deutlich, dass sich die Sympathien für das jeweils andere Land in den vergangenen Jahren zum Teil erheblich gesteigert haben. Die Studie zeigt, dass die Sympathien für Deutschland seit den 90er Jahren kontinuierlich gewachsen sind, obwohl die Wiedervereinigung auf polnischer Seite zunächst viele Ängste und Sorgen hervorrief. Eine Studie der Meinungsforscher aus dem Jahr 1990 zeigte, dass sich damals sehr viele Polen von Deutschland persönlich bedroht fühlten. Und mehr noch: 85 Prozent waren der Auffassung, dass infolge der Wiedervereinigung die Gefährdung Polens gestiegen sei. Nur sechs Jahre später wuchsen bereits Vertrauen und Sympathie zum westlichen Nachbarn. Im Jahr 1996 hielten drei Viertel aller Polen die Wiedervereinigung für eine gute Sache, ein deutlicher Meinungsumschwung. Aber auch wenn die Sympathien für die Deutschen grundsätzlich angestiegen sind, fällt das Urteil der Polen nicht eindeutig aus. Insgesamt überwiegt eher ein neutrales Bild. Doch verglichen mit dem Jahr 1966 ist die Entwicklung beachtlich: Damals ergab eine Studie, dass nur 7 Prozent der befragten Polen überhaupt Deutsche mögen.
Gespür der Medien
Der Wahlkampf zeigte, dass die polnischen Medien ein feines Gespür für die Stimmung der Bevölkerung haben. Sie versagten Kaczynski weitgehend die Unterstützung. „Redakteure wissen sehr gut, was der Leser hören will“, sagt Tomasz Dąbrowski, Leiter des Polnischen Instituts Berlin. In diesem Sinne werde der Leser „in seiner Überzeugung nochmals überzeugt“. Um das Jahr 2007 herum habe es beim Deutschlandbild der Polen eine Art Stimmungswechsel gegeben, sagt Dąbrowski. In diesem Jahr wurde Donald Tusk Ministerpräsident. Tusk hat Sympathien für Deutschland und geht eher pragmatisch mit dem westlichen Nachbarn um.
Letzter Eklat vor drei Jahren
Noch vor Jahren wählten Journalisten bewusst „leidvolle“ Aspekte der deutsch-polnischen Vergangenheit als Thema, sagt Cezary Gmyz, Leiter der Abteilung Geschichte bei der Zeitschrift „Wprost“. Diese hätten sich einfach besser verkauft – vor allem bei denen, die den Krieg noch erlebt haben. Ironischerweise haben in der jüngeren Vergangenheit besonders die zum Springer-Verlag gehörenden Boulevardzeitungen „Bild“ in Deutschland und „Fakt“ in Polen gerne die Stimmung zwischen den Nationen anheizt. Bartosz Wielinski, Auslandskorrespondent der „Gazeta Wyborcza“, bestätigt, dass sich gerade zur Zeit Kaczynskis antideutsche Berichterstattung in Polen besonders gut verkauft habe. Der letzte Eklat liegt drei Jahre zurück: Damals heizten die Blätter vor dem Europameisterschaftsspiel der beiden Länder die Stimmung gehörig an, „Fakt“ zeigte eine Fotomontage von Polens Coach Leo Beenhakker, der abgeschnittene Köpfe von DFB-Spielern wie Trophäen mit sich trägt.
Doch würden die Polen solche Verirrungen nicht mehr so ernst nehmen, sagt Andrzej Szynka, Gesandter an der polnischen Botschaft in Berlin. Sie hätten inzwischen ein „erwachsenes, gefestigtes“ Bild der Deutschen, das sich nicht durch die Boulevard-Medien erschüttern lasse. Einzelfälle werde es aber sicher auch in Zukunft noch geben.
Der zwischen Frankfurt Oder und Słubice pendelnde Taxifahrer, der den Autor zu einer Tagung zum 25-jährigen Bestehen der Deutsch-Polnischen Gesellschaft bringt, drückt es wohl am besten aus: Es sei vor allem die junge Generation, die ein entspanntes Verhältnis zum Nachbarn hätte. Viele junge Polen sind bereits nach Frankfurt gezogen, aber auch Deutsche ziehen auf die polnische Seite der Oder. Es sei ein wahres Miteinander geworden. Auf der Konferenz sagt eine junge Frau aus Orlów in der Nähe von Łódź, das früher auch Litzmannstadt genannt wurde: „Ich glaube, beide Seiten streben eine Versöhnung nach deutsch-französischem Vorbild an.“ Und eine solche wäre wahrhaft historisch.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe SPD – Eine Partei baut sich um. Das Heft können Sie hier bestellen.