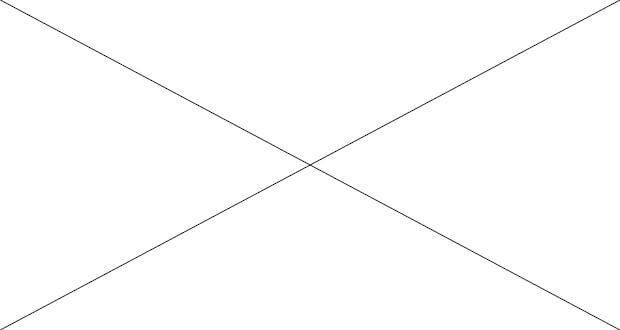p&k: Herr Kempe, im Juli lieferten sich Demokraten und Republikaner einen dramatischen Kampf um eine höhere Schuldengrenze; die USA standen kurz vor dem Staatsbankrott. Hat die Schuldenkrise das Ansehen der USA in der Welt beschädigt?
Frederick Kempe: Davon gehe ich aus. Die USA haben derzeit große wirtschaftliche Probleme: eine hohe Arbeitslosigkeit und ein schwaches Wirtschaftswachstum. Es ist zurzeit schwierig genug – kaum zu glauben, dass wir die wirtschaftliche Krise politisch noch verschärft haben. Von daher: Ja, der amerikanische Ruf in der Welt hat gelitten.
Dazu kommt, dass weltweit der Eindruck entstanden ist, dass es in Washington beinahe unmöglich geworden ist, einen Kompromiss zu schließen.
Ich beobachte die Politik in Washington seit mehr als 30 Jahren. Zunächst als Journalist, mittlerweile als Think-Tank-Vorsitzender. Ein so vergiftetes Klima habe ich noch nie erlebt. Beide Parteien versuchen, Kompromisse um jeden Preis zu verhindern. Dabei sind solche ein elementarer Bestandteil der Demokratie.
Wie viel Schuld trägt die Tea-Party-Bewegung an der Haushaltskrise?
Ich weiß nicht, wer mehr Schuld an der Krise hatte: Präsident Obama oder die Tea-Party-Bewegung. Obama hat es nicht geschafft, beide Parteien rechtzeitig von einem Kompromiss zu überzeugen. Die Tea-Party-Bewegung wiederum hat jeglichen Kompromiss als Schwäche verstanden. Beide Seiten haben die Krise ausgelöst.
Einer der Hauptakteure in Ihrem neuen Buch „Berlin 1961“ ist der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy. Obama und Kennedy: Dieser Vergleich wird oft gezogen. Zu Recht?
Ich sehe drei Ähnlichkeiten. Zunächst einmal sind beide Demokraten. Dazu kommt, dass sie in jungen Jahren ins Weiße Haus eingezogen sind. Obama mit 48 Jahren, Kennedy mit 43 Jahren. Und: Obama ist – wie Kennedy – ein Kopfmensch, kein instinktiver Politiker. Ein politischer Kopfmensch zu sein, hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass so jemand Krisen oft vermeiden kann. Steckt er jedoch in einer, hat er Schwierigkeiten, wieder herauszukommen.
Sie schreiben, dass Kennedys erstes Amtsjahr „eines der katastrophalsten ersten Amtsjahre eines US-Präsidenten“ gewesen sei.
Kennedy ist in der Tat desaströs gestartet: die gescheiterte Schweinebucht-Invasion, das Wiener Gipfeltreffen, bei dem er sich von Nikita Chruschtschow vorführen ließ, und schließlich der Bau der Mauer. Doch Kennedy konnte sich steigern. Die Kuba-Krise ist dafür ein gutes Beispiel, seine Berliner Rede im Jahr 1963 ebenfalls. Obama musste in seinem ersten Amtsjahr keine solche Krise meistern. Ein Glück für ihn, denn das erste Amtsjahr ist für einen neuen Präsidenten immer eine besonders gefährliche Zeit.
War Kennedy besser auf das Präsidentenamt vorbereitet als Obama?
Beide waren nicht bereit für das Amt. Kennedy ist ja immer noch der jüngste US-Präsident aller Zeiten. Aber er war erfahrener als Obama. Bis zum Einzug ins Weiße Haus war dieser nur knapp vier Jahre Senator gewesen, Kennedy konnte als Abgeordneter und Senator rund 13 Jahre politische Erfahrung sammeln.
Von Ihrem Buch geht eine klare Botschaft aus: Die Historiker bewerten Kennedys politische Leistung im Jahr 1961 zu positiv.
Die Deutschen verehren Kennedy weiterhin sehr. Das hängt natürlich mit seiner Rede im Jahr 1963 zusammen und seinem Ausspruch „Ich bin ein Berliner“. Ich glaube jedoch, dass die Geschichte zu gut zu Kennedy war. Wie gesagt, hat Kennedy im Jahr 1961 drei große Fehler begangen – den Bau der Berliner Mauer zuzulassen, gehört dazu. Ich bin der Meinung, dass Chruschtschow damals klar war, dass Kennedy die Lage nach dem Bau der Mauer nicht eskalieren lassen würde. In Wien müssen beide darüber gesprochen haben. Kein US-Präsident hat, was Ost-Berlin und Ost-Deutschland angeht, die Tür so weit aufgemacht wie Kennedy.
Sie haben Kennedys berühmte Rede vor dem Schöneberger Rathaus erwähnt. 2008 hat Obama als Präsidentschaftskandidat eine Rede vor rund 250.000 Berlinern gehalten. Gibt es einen Zusammenhang?
Europäer mögen demokratische US-Präsidenten mehr als republikanische. Kennedy wirkte in seinem Auftreten europäischer als Eisenhower, Obama europäischer als Bush. Gleichzeitig verband die Welt mit beiden Politikern die Attribute jung und hoffnungsvoll. Doch es gibt einen Unterschied: Kennedys Rede war so wichtig, weil Berlin im Jahr 1963 eine Bühne für die Weltpolitik war. Heute ist Deutschland in einer anderen machtpolitischen Konstellation. Ich denke, dass Obama Berlin deshalb so begeistern konnte, weil er das perfekte Gegenbild zum damals so unbeliebten George W. Bush war.
Die transatlantischen Beziehungen haben sich seit 1961 stark verändert. Mittlerweile wird von einer Krise im amerikanisch-europäischen-Verhältnis gesprochen.
Präsident Obama hat vor kurzem in einer Rede gesagt, dass die transatlantischen Beziehungen ein Eckpfeiler der amerikanischen Außenpolitik bleiben. Gleichzeitig hat Robert Gates, bis Juli US-Verteidigungsminister, festgestellt, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Europa verschlechtern werden, wenn wir sie nicht auf ein neues Fundament stellen. Beide haben Recht: Die transatlantischen Beziehungen sind für beide Partner ein bedeutendes Element ihrer jeweiligen Außenpolitik – aber das Fundament bröckelt. In einer Zeit wirtschaftlicher Unruhe ist es wichtig, dass wir die transatlantische Beziehung neu definieren. Was Demokratie und Menschenrechte angeht, ist der Westen der dominierende Akteur. Wir können uns hier keinen Streit leisten.
In diesem August jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 50. Mal. Spielt die Krise im Jahr 1961 heute noch eine Rolle im Gedächtnis der Deutschen?
Ich würde mich freuen, wenn wirklich allen Deutschen klar wäre, welche Rolle Berlin beim Aufbau der heutigen Demokratie gespielt hat, und was die Alliierten geopfert haben, um diese Stadt zu verteidigen. In meinem Buch schreibe ich zwar, dass Kennedy den Bau der Mauer nicht verhindert hat, aber es ist doch auch klar, dass die Amerikaner in dieser Stadt geblieben sind, um sie zu verteidigen – und um einen Sieg der Freiheit zu erringen.
Sie haben sieben Jahre an Ihrem Buch gearbeitet. Warum ausgerechnet Berlin im Jahr 1961?
Es gibt dafür drei Gründe. Der erste ist die erneute Analyse von Kennedys erstem Amtsjahr. Der zweite ist meine persönliche Geschichte. 1974 bin ich zum ersten Mal durch den Checkpoint Charlie gegangen, um meine Verwandten zu besuchen. Als amerikanischer Student fand ich es erschreckend, dass Leute in ihrem eigenen Land eingesperrt waren und immer darauf achteten, leise mit mir zu sprechen, damit kein Nachbar es mitbekommt. Der dritte Grund: Es ist eine unglaublich spannende Geschichte mit einer einmaligen Konstellation von Akteuren. Kennedy und Chruschtschow: Gegensätzlicher hätten die damals wichtigsten Männer der Welt nicht sein können.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Kampf ums Internet – Die Lobby der Netzbürger formiert sich. Das Heft können Sie hier bestellen.